
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerstenberg Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wir können uns nicht ewig damit rausreden, dass die anderen auch nichts tun. Dann ändert sich nie etwas." Emma Larsen hat sich entschieden, etwas zu tun, um unseren Planeten zu retten. Die mutige junge Aktivistin ist bereit, dafür notfalls ihr Leben zu riskieren. Nachdem ihr Freund bei einer aufsehenerregenden Kampagne gegen den Pharmakonzern PLS zu Tode gekommen ist, schließt sie sich NO ALTERNATIVE an und geht in den Untergrund. Eine halsbrecherische Aktion auf der Spitze des Frankfurter Messeturms macht die radikale Umweltschutzorganisation in der Öffentlichkeit bekannt. Doch das ist erst der Anfang … Spannend, brisant und hochaktuell – auch in seinem neuesten Roman trifft Dirk Reinhardt einen Nerv unserer Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Dirk Reinhardt
Inhalt
Emma
Finn
Emma
Manifest von No Alternative Teil 1: Ein ganz gewöhnlicher Tag
Finn
Emma
Finn
Emma
Manifest von No Alternative Teil 2: Die letzte Chance
Finn
Emma
Finn
Emma
Manifest von No Alternative Teil 3: Freut euch nicht zu früh
Finn
Emma
Finn
Emma
Manifest von No Alternative Teil 4: Wir wollen euch nicht
Finn
Emma
Finn
Emma
Manifest von No Alternative Teil 5: Die Hüter*innen sind wütend
Finn
Emma
Finn
Emma
Zitate im Text
Emma
»Falls es nicht Liebe ist«, sagt Nike, während sie über dem Abgrund schwebt, sich mit der einen Hand festhält und mit der anderen auf die Lichter der Stadt in der Tiefe zeigt, »falls es nicht Liebe ist, ist es der Tod.«
Sie lächelt, auf diese geheimnisvolle Art, die so typisch für sie ist, mehr mit den Augen als mit dem Mund, mit ihren dunklen, etwas schräg stehenden Augen über den hervortretenden Wangenknochen, die ihr Gesicht beherrschen, dieses schmale Gesicht, in dem es kein einziges Gramm Fett zu geben scheint. Dann lässt sie los. Sie lässt die Querstrebe, an der sie sich festhält, einfach los, indem sie die Finger auseinanderreißt. Für einen Moment steht sie bewegungslos da, auf dem vom Regen noch feuchten, röhrenförmigen Leuchtkörper, der die Pyramide des Messeturms auf allen Seiten umgibt und jetzt so hell strahlt, dass es kilometerweit zu sehen ist, dann zieht die Schwerkraft sie hinunter und sie droht, immer noch lächelnd, in den Abgrund zu stürzen.
Mit einem Schrei springt Emma, die auf der kleinen, geschützten Plattform hinter der Brüstung steht, zu ihr, greift ihre Hand und zieht sie zurück. Nike rutscht aus und fällt ihr in die Arme. Gemeinsam stürzen sie auf das Gitter der Plattform, das unter ihrem Aufprall zittert und bebt. Emma hält Nike fest und presst sie mit beiden Händen an sich.
»Warum machst du das?«, stößt sie hervor. Ihr Herz schlägt heftig, fast schmerzhaft, als hätte sie selbst über dem Abgrund geschwebt. »Es ist auch so schon gefährlich genug hier oben. Du musst unser Schicksal nicht noch herausfordern.«
Nike hebt den Kopf, stützt sich auf ihren Ellbogen und blickt Emma an. Im Gegensatz zu ihr wirkt sie ruhig, fast entspannt. »Ich habe keine Angst vor dem Tod«, sagt sie. »Wenn er zu mir kommen will, soll er es tun.«
»Ich will aber nicht, dass er zu dir kommt. Hörst du? Noch lange nicht.«
Nike streicht ihr über die Haare. »Es war doch überhaupt nicht gefährlich«, sagt sie.
»Was redest du da für ein Zeug? Es war lebensgefährlich.«
»War es nicht. Ich wusste, dass du mich halten würdest.«
Emma schüttelt den Kopf. Mit einer raschen Bewegung wischt sie die Tränen fort, die ihr in die Augen getreten sind. »Manchmal hasse ich dich«, sagt sie.
Nike nimmt ihr Gesicht zwischen die Hände und beugt sich zu ihr hin. »Tust du nicht«, sagt sie leise.
Im nächsten Augenblick springt sie auf, zerrt Emma ebenfalls nach oben und lehnt sich mit ihr, den Arm um ihre Schultern gelegt, über die Brüstung.
»Sieh sie dir an«, sagt sie und zeigt hinab. »Die kleinen Ameisen da unten in ihren stickigen Häusern und stinkenden Autos. Wie sie an ihrem armseligen Leben hängen! Von der Freiheit, die hier oben wartet, haben sie keine Ahnung.«
»Nein«, murmelt Emma. »Die kennen nur wir beide. Nur du und ich, Nike.«
Sie schaut hinunter, über die Leuchtröhre hinweg, die den oberen Abschluss der Brüstung bildet. Es ist jetzt tief in der Nacht, bestimmt schon nach zwölf, aber in dieser Stadt ist es niemals dunkel. Mehr als zweihundert Meter unter ihr, nur als winzige Punkte erkennbar, wie kleine Glühwürmchen, die durch Spalten und Gräben kriechen, schieben sich Autos durch die Straßen, beschleunigend und bremsend, haltend und wieder beschleunigend, in einem endlosen und von hier oben reichlich sinnlos wirkenden Strom. In manchen Hochhäusern brennt noch Licht, vor allem im Osten, in den Bankentürmen. Im Süden, jenseits der Schienen, hinter den Kuppeldächern des Hauptbahnhofs, kann Emma das dunkle Band des Flusses mehr erahnen als sehen. Es ist ein Anblick, der ihr den Atem raubt, und als sie in die Tiefe schaut und dabei den Wind spürt, der hier oben ungebremst und hemmungslos ist, muss sie daran denken, wie es ihr damals, als sie zum ersten Mal einen solchen Ausflug über den Dächern der Stadt gewagt hatte, noch das Herz zusammenschnürte, sich alles in ihr verkrampfte vor Angst. Inzwischen hat sie sich an die Höhe gewöhnt, sie ist ihr vertraut geworden.
Nike bohrt ihr den Ellbogen in die Seite. »Vervollständigen Sie den folgenden Satz«, sagt sie. »Die Nacht …«
Emma grinst. »… ist des Freien Freund«, sagt sie.
Nike stößt triumphierend ihre Faust in den Nachthimmel. »Sie haben die Höchstzahl von einhundert Punkten erreicht«, ruft sie. Dann bricht sie abrupt ab und dreht sich zu Emma hin. »Was verstehst du unter Freiheit?«, fragt sie. »Komm, sag es mir.«
»Unter Freiheit? Pah! Was du alles wissen willst.« Emma überlegt, aber auf Anhieb fällt ihr keine gute Antwort ein. »Ich weiß es nicht«, sagt sie. »Schätze, das habe ich noch nicht so richtig rausgefunden. Muss erst noch ein bisschen darüber nachdenken. Wenn es mir einfällt, verrate ich’s dir. Irgendwann.«
»Aber vergiss es nicht«, sagt Nike. »Du weißt ja: Die Zeit geht an uns vorbei. Sie wartet nicht auf uns.«
Emma nickt, dann sieht sie nach oben. Der Himmel ist dunkel, sternenlos, nur der Mond steht dort, blass und von Wolken umgeben, die langsam an ihm vorbeiziehen, ihn mal verhüllen und wenig später wieder freigeben, so als wollten sie ihn beschützen vor allzu neugierigen Blicken.
Sie denkt an den Weg, der sie hier heraufgeführt hat. Spät am Abend, kurz bevor die großen Eingangstüren des Messeturms geschlossen wurden, hat sie sich hineingeschlichen, in einem günstigen Moment, als das Sicherheitspersonal abgelenkt war. Sie ist zu einem der beiden Treppenhäuser gegangen, in denen man selten jemandem begegnet, weil alle anderen die Aufzüge benutzen, und nach oben gestiegen, Stufe um Stufe, an den vielen grauen Türen mit den schwarzen Zahlen vorbei, die die Etagen anzeigen. Erst durch die oberste der Türen, die mit der »61« darauf, hat sie das Treppenhaus verlassen und ist, an den Rohren der Kühltürme und der riesigen Fensterputzmaschine vorbei, in den Sockel der Pyramide gelangt, die den Messeturm nach oben abschließt. Dort hat sie gewartet, lange gewartet, dem Regen zugehört, der auf die Fassade tröpfelte, und mit sich gerungen, ob sie den Plan, den sie gefasst hat, diese verrückte, halsbrecherische Aktion, tatsächlich durchführen soll.
Als sie kurz davor stand, aufzugeben und wieder hinunterzusteigen, tauchte Nike auf. Die mutige, geheimnisvolle Nike, die in Wahrheit nur ein Traum war, die schönste Erfindung ihrer Fantasie, und ohne die sie diese gefährlichen Ausflüge niemals wagen würde. Sie hatte sie lange nicht mehr gesehen, über ein Jahr, und zweifelte schon daran, ob sie überhaupt noch kommen würde, aber plötzlich war sie da, aus dem Nichts, wie sie es immer tat, und machte sich mit ihr auf den Weg. Von da an war sie bei ihr, mal neben ihr, mal einige Stufen voraus. Meistens blieb sie unsichtbar, wie ein Luftzug, den man im Wind kaum spürt, aber überall dort, wo es gefährlich wurde, wo nur eine winzige Leiter weiter hinaufführte oder sich plötzlich, mit einer kalten Faust nach dem Herzen greifend, der Blick in den Abgrund öffnete, tauchte sie auf, nahm Emmas Hand und sprach ihr Mut zu. So kletterten sie im Inneren der Pyramide nach oben, Meter für Meter, den Höhenwind schon spürend, immer weiter hinauf, bis zu dem kleinen Absatz zwischen dem mittleren und dem oberen Teil der Pyramide, auf dem sie jetzt stehen.
Nike zeigt nach oben. »Siehst du den Mond?«, fragt sie. »Er ficht wieder mit den Wolken.«
»Ja«, sagt Emma, »ich hab’s schon von der Straße aus gesehen.« Ihr Blick wandert zur Spitze der Pyramide, die hoch über ihnen aufragt. Als sie die steile Glasfassade sieht, die hinaufführt, läuft ihr ein Schauer über den Rücken. Schnell wendet sie sich ab, umarmt Nike und legt den Kopf auf ihre Schulter.
»Lass uns lieber nicht da hochgehen«, flüstert sie. »Nicht heute, hörst du? Ich habe ein schlechtes Gefühl und außerdem – na ja, es hat geregnet, alles ist rutschig und …«
Nike wartet einen Moment. Als Emma nicht weiterspricht, löst sie ihre Hände, mit denen sie sie umklammert, und schiebt sie ein Stück von sich.
»Vertraust du mir?«, fragt sie.
»Ja. Das weißt du doch.«
»Dann lass uns weitergehen. Wir haben es uns vorgenommen. Jetzt tun wir’s auch.«
Emma seufzt. Widerstrebend bückt sie sich und zieht die Verkleidung, die sie vorbereitet hat, aus ihrem Rucksack: einen schwarzen Frack und eine Maske, die sie wie ein Pinguin aussehen lassen. Während sie beides überstreift, hört sie schon das leise Surren der Drohne, die die Aktion filmen soll. Gleich darauf sieht sie sie auch, wenige Meter entfernt schwebt sie in der Luft, von kleinen, wirbelnden Rotoren im Gleichgewicht gehalten, die Kamera unter ihrem Bauch und der Scheinwerfer auf ihrem Rücken sind auf Emma gerichtet.
Auch Nike hat sie bemerkt. »Wie heißt noch gleich der Typ, der sie steuert?«, fragt sie.
»Noah«, antwortet Emma.
»Und? Magst du ihn?«
»Ja, schon. Er ist ganz okay.«
Nike lacht heiser. »Ganz okay! Was heißt das schon?«
Sie steigt auf die Brüstung und beginnt zu klettern, zuerst die Querstreben hinauf, dann greift sie nach einem der Metallstäbe, die aus der Fassade ragen, und zieht sich weiter daran empor. Als sie einen sicheren Stand gefunden hat, dreht sie sich um.
»Du weißt ja«, sagt sie. »Man muss einen harten Geist haben.«
»Ja«, antwortet Emma. »Und ein weiches Herz.«
»Komm jetzt«, hört sie Nikes Stimme. »Es ist nicht schwer. Es geht ganz leicht.«
Emma quält sich ein Lächeln ab. »Für dich vielleicht«, sagt sie und versucht, ihre Stimme fröhlich klingen zu lassen, obwohl ihr Herz inzwischen bis zum Hals hinauf schlägt. »Wenn man schon wie ein Turnschuh heißt …«
»Ich bin nicht nach dem Turnschuh benannt, sondern nach der griechischen Siegesgöttin«, sagt Nike.
»Ach ja«, flüstert Emma, leise genug, dass es nicht zu hören ist. »Das hatte ich vergessen. Du willst ja immer gewinnen.«
Sie setzt ihren Fuß auf die Brüstung, schwingt sich hinauf und klettert dann Schritt für Schritt die Querstreben empor, bis sie die schräge, vom Regen noch feuchte Glasfassade des oberen Teils der Pyramide erreicht. Auch hier sind an allen vier Seitenkanten Leuchtröhren angebracht, die ihr Licht grell in den Nachthimmel senden und die einzige Möglichkeit bilden, zur Spitze vorzustoßen. Nike hat bereits eine von ihnen erreicht und hangelt sich daran nach oben, mit den geschmeidigen, katzenartigen Bewegungen, die so typisch für sie sind.
Emma folgt ihr. Erleichtert stellt sie fest, dass es nicht schwer ist, an der Röhre entlang nach oben zu klettern. In regelmäßigen Abständen ist sie mit metallenen Ringen an der Fassade befestigt, die sich gut greifen lassen und auch den Füßen Halt bieten. Ihre Verkleidung, der Frack und die Maske, stören sie nicht. Nur eines darf sie nicht tun. Sie darf nicht den Fehler machen, nach unten zu schauen und sich auszumalen, was geschehen würde, falls sie abrutschte oder einer der metallenen Ringe aus der Halterung spränge. Sie darf sich nicht vorstellen, wie es wäre, die gläserne Fassade nach unten zu rutschen, verzweifelt und vergeblich nach einem Halt zu suchen, eine halbe Ewigkeit im freien Fall durch die Nacht zu segeln und in einem Aufprall zu enden, der sie in ihre Bestandteile zerlegen würde.
Zum Glück ist Nike immer bei ihr, sie kann sich gut an ihr orientieren. Und dann sind sie oben, haben die höchste Spitze der Pyramide erreicht, wo die vier Leuchtröhren zusammentreffen und nur von einem Blitzableiter überragt werden, dessen oberes Ende fast im Himmel zu verschwinden scheint. Emma greift danach und richtet sich auf. Der Blick ist jetzt überwältigend, weit über das Lichtermeer der Stadt hinweg, grenzenlos und, wohin auch immer sie sich wendet, scheinbar ins Unendliche gerichtet. Nichts ist jetzt noch über ihr, nichts mehr neben ihr und für einen Moment hat sie das Gefühl, von all den Fesseln befreit zu sein, die sie an die winzige Welt dort unten binden.
Erst das Surren der Drohne holt sie wieder in die Wirklichkeit zurück. Sie muss ihren Aufstieg gefilmt haben, ohne dass sie es wahrgenommen hat, und schwebt jetzt vor ihr, wie um sie an ihren Auftrag zu erinnern. Emma öffnet den Frack und greift in die Innentasche. Dafür braucht sie beide Hände und im gleichen Augenblick trifft sie, direkt von vorn, ein heftiger Windstoß. Sie verliert die Balance und rudert mit den Händen in der Luft, um sie wiederzufinden. Nike greift nach ihr und zieht sie an sich, es gelingt Emma gerade noch, mit den Fingerspitzen den Blitzableiter zu fassen und sich daran festzuklammern. Im nächsten Moment spürt sie das Adrenalin, es trifft sie wie ein Keulenschlag.
Einige Minuten steht sie nur da, zitternd, und wartet darauf, wieder zu Atem zu kommen. Sie merkt, wie der Wind sich beruhigt, dann startet sie einen zweiten Versuch. Vorsichtig zieht sie das zusammengerollte Transparent hervor und knüpft es an der Stange des Blitzableiters fest, oben und unten. Gleich darauf löst sie die Schlaufen und sieht zu, wie das Banner sich entrollt und im Wind zu flattern beginnt. Die Drohne richtet ihren Scheinwerfer darauf und umkreist es. »NO ALTERNATIVE« steht dort, in einer kantigen schwarzen Schrift auf weißem Grund, mit einer in hellem Gelb erstrahlenden Sonne anstelle des »O«.
Nach einer letzten Umrundung steht die Drohne still. Emma wendet sich ihr zu, winkt in die Kamera und deutet zugleich auf das Transparent. Sie probiert noch einige Posen und Gesten aus, die ein gutes Bild ergeben könnten, so lange, bis ein kurzes Wackeln der Drohne ihr anzeigt, dass es genug ist. Nachdem sie die Knoten, mit denen das Transparent befestigt ist, noch einmal überprüft hat, blickt sie sich ein letztes Mal um. Sie ist wieder allein. Nike ist nicht mehr bei ihr, sie braucht sie nicht mehr, jetzt, nachdem sie ihr Vorhaben ausgeführt hat. Sie ist verschwunden, auf die gleiche Art, wie sie es immer tut, ohne es anzukündigen und ohne Spuren zu hinterlassen.
Emma seufzt und beginnt den Abstieg. Sie hat nicht viel Zeit, sie muss darauf achten, den Turm zu verlassen, bevor am Ende noch jemand das Transparent entdeckt und die Polizei alarmiert. Das ist zwar unwahrscheinlich, jetzt, mitten in der Nacht, aber man kann nie wissen. Und der Polizei, so viel steht fest, darf sie unter keinen Umständen in die Hände fallen. Sie wird gesucht. Und, was noch wichtiger ist: Sie wird nicht nur gesucht, sie wird auch gebraucht.
Denn diese Aktion, das hat sie sich geschworen, diese Aktion soll erst der Anfang sein.
Finn
Der Tag, an dem ich Emma Larsen wiedersah, war ein Schattentag. So nenne ich die Tage, an denen ich von morgens bis abends, als würde die Welt nur aus Schatten bestehen, in einer düsteren Stimmung bin, weil ich in der Nacht von meinem Bruder Arne geträumt habe. Er war mein Zwillingsbruder und er ist nicht mehr bei mir, schon seit Jahren nicht. Aber noch immer ist es, als würde ein Teil von mir fehlen und als müsste ich auf die Suche gehen nach diesem fehlenden Teil, auf eine eigentlich hoffnungslose Suche, die ich, obwohl ich weiß, dass sie hoffnungslos ist, nicht aufgeben kann.
Der Traum ist immer derselbe. Mitten in der Nacht schrecke ich hoch, weil ich glaube, etwas gehört zu haben, etwas wie ein Rascheln, durch das geöffnete Fenster. Ich stehe auf und schaue nach draußen und irgendwann, nach ein paar Minuten, fange ich an zu rufen. »Wo bist du, Arne?«, rufe ich in die Dunkelheit. Und frage ihn, warum er mich alleingelassen hat.
Plötzlich sehe ich ihn, in den Zweigen eines Baumes, nur wenige Meter entfernt. Unsere Wohnung liegt im fünften Stock, mein Zimmer geht zum Hinterhof, da steht ein alter Baum, seine Krone ist auf der Höhe meines Fensters. Und genau dort sitzt Arne, auf einem der obersten Äste. Er hat den Körper eines Vogels, mit Flügeln und Federn, aber den Kopf meines Bruders. Wenn er mein Rufen hört, sieht er mich an. Es ist ein langer und unendlich trauriger Blick, so als wollte er sagen: »Such nicht länger nach mir, Finn. Es ist sinnlos. Ich komme nicht zurück.« Dann lächelt er nur noch. Und fliegt davon.
Immer wenn ich diesen Traum habe, wache ich auf und schlafe für den Rest der Nacht nicht mehr ein, kann ihn auch am nächsten Tag nicht vergessen und bin in einer ziemlich deprimierten Stimmung. Und am Abend eines solchen Tages, in der Hoffnung, kommende Nacht nicht wieder das Gleiche zu träumen, sah ich im Fernsehen die Sendung mit Emma Larsen. Es war eine Talkshow. Sie war nicht der einzige Gast, vor ihr hatte der Moderator schon mit anderen geredet, aber die hatten mich nicht interessiert. Erst als er Emma ansprach, schaute ich wirklich zu.
»Es freut mich, dass du bei uns bist, Emma«, begrüßte er sie. »Wir alle wissen, wie viel auf dich eingestürmt ist in letzter Zeit. Eure Kampagne gegen PLS, der ganze Aufruhr in der Öffentlichkeit. Ein Freund von dir hat die Aktion sogar mit seinem Leben bezahlt. Wie geht es dir damit?«
Die Kamera zeigte sie in Großaufnahme. Verglichen mit dem Moderator wirkte sie blass, und zwar, wie ich später erfuhr, weil sie es wohl abgelehnt hatte, sich für den Auftritt schminken zu lassen. Sie zögerte, die Frage zu beantworten.
»Darüber will ich lieber nicht sprechen«, sagte sie schließlich. »Wir können über alles reden. Aber nicht darüber, bitte.«
»Gut, dann – lass uns doch über den Prozess sprechen, der in einigen Tagen beginnt«, schlug der Moderator vor. »Gegen dich und die anderen, die bei der Aktion dabei waren. Du hast dich ja schon ein paarmal geäußert in der letzten Zeit. Du hättest sagen können: Ich bereue es. Wir sind zu weit gegangen. Es war falsch. Warum hast du das nicht getan?«
»Na, weil es nichts zu bereuen gibt«, sagte Emma. »Was sollen wir denn bereuen? Es war nicht falsch.«
»Aber bei der Aktion wurden Menschen geschädigt, das kannst du nicht leugnen. Oder ist dir das egal?«
»Mir ist überhaupt nichts egal.« Ihre Augen verengten sich für einen Moment, so wie es früher schon immer gewesen war, wenn sie sich über etwas ärgerte. »Aber wieso erwarten eigentlich alle, dass ausgerechnet wir immer Rücksicht nehmen sollen? Auf Leute, die das selbst nicht tun? Die einen Krieg führen? Gegen die Natur – und damit letzten Endes gegen uns?«
»Das sind ganz schön harte Formulierungen, die du da wählst«, sagte der Moderator. »Überhaupt muss man feststellen, dass die Aktionen der Aktivisten zuletzt –«
»Aktivist*innen«, verbesserte sie ihn.
»Gut, also«, der Moderator lächelte nachsichtig, »dass die Aktionen der Aktivisten und Aktivistinnen zuletzt immer radikaler geworden sind. Viele machen sich Sorgen, die Dinge könnten eskalieren. Kannst du das verstehen?«
»Klar. Ich finde es gut, wenn die Leute sich Sorgen machen. Aber sie sollten Angst vor der Zerstörung unseres Planeten haben. Nicht vor denen, die versuchen, ihn zu schützen.«
»Okay, da hast du vielleicht einen Punkt. Nur: Einige von euch schließen Gewalt inzwischen als Mittel nicht mehr völlig aus. Ich denke, das kannst du nicht ernsthaft gutheißen.«
»Wieso denn nicht? Die Angriffe auf die Natur werden immer brutaler. Immer rücksichtsloser. Also wird auch die Verteidigung immer heftiger. Darüber darf sich doch keiner wundern.«
Der Moderator stockte. Es war nur kurz, aber ich hatte das Gefühl, in diesem Augenblick begann er zu ahnen, dass das Gespräch schwieriger werden würde, als er es vor der Sendung womöglich erwartet hatte.
»Vielleicht wird die Sache klarer, wenn wir ein Beispiel nehmen«, fuhr er fort. »In letzter Zeit haben Aktivisten – Entschuldigung: Aktivisten und Aktivistinnen – in einigen Städten Autos in Brand gesteckt. In zwei Fällen wurden Menschen verletzt, weil die Brände auf Häuser übergriffen. Was hältst du von solchen Aktionen?«
Emma, die auf ihrem breiten Sessel ganz schön schmal wirkte, richtete sich auf. »Wissen Sie, wie viele Tiere jeden Tag getötet werden?«, sagte sie. »Warum regen Sie sich darüber nicht auf? Ist es nicht schlimmer, ein Tier zu töten, als ein Auto abzufackeln? Denn das eine lebt doch und das andere ist tot.«
Bevor der Moderator reagieren konnte, schaltete sich einer der anderen Gäste ein. Ich weiß nicht mehr genau, wer er war, ich glaube, so eine Art Sachbuchautor, der über den Klimawandel geschrieben hatte. »Ich hoffe sehr, dass ich dich falsch verstehe, Emma«, sagte er. »Denn im Moment habe ich den Eindruck, dass du solche Zerstörungen verteidigst, und das wäre schlimm.«
Sie drehte sich zu ihm um. »Vielleicht wollen Sie mich ja auch falsch verstehen«, sagte sie. »Verteidigt habe ich nämlich bisher noch gar nichts. Ich habe nur gesagt, das eine ist schlimmer als das andere. Und wenn Sie es genau wissen wollen: Ich finde es auch schlimmer, ein Auto zu kaufen, als eines zu zerstören. Denn: Autos töten.«
Ich kannte Emma noch von früher. Das war auch der Grund, warum ich die Sendung eingeschaltet hatte. Wir waren mal eine Zeit lang auf dieselbe Schule gegangen, sie war in meiner Parallelklasse. Lange Zeit kannte ich sie nur vom Sehen, aber dann machten wir beide im Schultheater mit. Ich glaube, es war in der Achten oder so. In dem Stück ging es um die ganz großen, existenziellen Themen, es war furchtbar kritisch, ständig schwätzten wir altkluges Zeug daher. Jedenfalls, Emma und ich sollten zwei Geschwister spielen und unsere Dialoge selbst schreiben. Wir stritten ständig deswegen. Emma wollte auf der Bühne immer möglichst radikale Statements von sich geben und ich versuchte ihr klarzumachen, dass das zu unseren Rollen gar nicht passte. Ehrlich gesagt, waren wir manchmal kurz davor, aufeinander loszugehen, aber weil wir natürlich nicht gleich das ganze Stück gefährden wollten, mussten wir uns immer wieder halbwegs zusammenraufen. Das war alles in allem ziemlich heftig und so hatte ich sie ganz gut kennengelernt damals.
Ende des Jahres wechselte ich die Schule, weil meine Eltern in eine andere Gegend von Frankfurt zogen, und verlor Emma aus den Augen. Für ein paar Jahre hörte ich nichts von ihr, bis dann die Sache mit PLS aufkam, der Firma aus Sachsenhausen, deren Aktivitäten sie mit ein paar anderen zusammen aufdeckte. Sie und ihr Freund – sein Name war Patrick – hatten Praktikantenstellen bei PLS angenommen, aber in Wahrheit war es gar nicht das Praktikum, für das sie sich interessierten. Sie waren dort, um Beweise zu sammeln, Beweise für die üblen Methoden des Unternehmens, über die schon länger gemunkelt wurde. Und das taten sie anscheinend gründlich, denn im Netz tauchten Videos auf, die heimlich in den Laboren von PLS gedreht worden waren, mit Bildern von gequälten und geschundenen Tieren, die einigermaßen schockierend waren und natürlich sofort viral gingen.
Alle Medien berichteten, im Netz gab es einen Sturm der Entrüstung. Aber Emma und den anderen, die hinter der Kampagne standen, reichte das nicht. Sie machten gnadenlos weiter, veröffentlichten die Adressen führender Leute von PLS, die daraufhin vor ihren Häusern beschimpft und attackiert wurden. Fahrzeuge des Unternehmens standen eines schönen Morgens mit aufgeschlitzten Reifen da, Kunden wurden genötigt, ihre Geschäftsbeziehungen zu beenden. Wieder gab es einen Sturm der Entrüstung, jetzt aber nicht gegen PLS, sondern gegen die Kampagne selbst.
Emma und Patrick blieben lange anonym. Anscheinend waren sie clever genug, ihre Videos zu filmen, ohne sich dabei erwischen zu lassen. Dann aber wurden sie doch enttarnt, durch einen Zufall oder vielleicht auch, weil sie leichtsinnig wurden, keiner wusste es so genau. Patrick kam auf eine ziemlich üble Art auf dem Firmengelände ums Leben. Offiziell war von einem tragischen Unglück die Rede, aber das glaubte zumindest von den Leuten, die ich kannte, niemand. Alle waren überzeugt, man hätte ihn irgendwie in den Tod getrieben.
Emma wurde angeklagt, wegen Hausfriedensbruch und Verrat von Betriebsgeheimnissen und wie man solche Dinge eben nennt. Fotos von ihr wurden veröffentlicht und jetzt erkannte ich sie wieder und dachte: Hey, das darf ja wohl nicht wahr sein! Das ist doch meine alte Emma! Eine Riesendiskussion ging los, über die Grenzen von Widerstand und Zivilcourage und über den Umgang mit Leuten, die in der Sache zwar recht haben, aber die falschen Methoden anwenden, und Emma stand im Mittelpunkt von allem. Sie äußerte sich ab und zu in den Zeitungen und im Netz und dann kam, kurz vor Prozessbeginn, dieser Auftritt im Fernsehen.
»Emma, bei allem Verständnis, auch wegen der schwierigen Erlebnisse, die du hattest«, sagte der Moderator, nachdem so ziemlich alle anderen Gäste der Reihe nach über Emma hergefallen waren und sie für ihre Aussagen abgewatscht hatten. »Aber in letzter Zeit entsteht der Eindruck, dass der radikalere Teil der Umwelt- und Klimaschutzbewegung, zu dem du mit deiner Gruppe ja wohl zählst, inzwischen gegen so ziemlich alles protestiert, was in diesem Land über Jahrzehnte hinweg aufgebaut worden ist.«
»Ja, ich weiß, das wird von manchen Leuten behauptet. Aber es ist falsch. Wir sind nicht gegen alles.«
»Na, so ganz falsch ist es ja vielleicht nicht. Zumindest wendet ihr euch sehr deutlich gegen, sagen wir, unseren Wohlstand. Also gegen das, wofür Generationen gearbeitet haben und wovon ihr, wenn ich das hinzufügen darf, doch auch selbst profitiert.«
Emma winkte ab. »Hören Sie mir auf mit Ihrem Wohlstand«, sagte sie. »Ich kann das nicht mehr hören. Wohlstand macht fett und faul und zerstört die Umwelt. Was soll daran gut sein?«
»Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Du sagst damit doch im Grunde nichts anderes, als dass all die Menschen, von denen wir umgeben sind, die ganz normalen Bürger in unserem Land, die ihr Leben lang arbeiten, Kinder großziehen und Steuern zahlen, dass die alle plötzlich auf der falschen Seite stehen.«
»Nein«, sagte Emma. »Nicht plötzlich. Sie standen schon immer auf der falschen Seite.«
Es war erstaunlich zu sehen, wie sich das Verhalten des Moderators inzwischen verändert hatte. Normalerweise saß er immer betont entspannt da, mit übereinandergeschlagenen Beinen und kleinen Kärtchen in der Hand, auf denen er seine Stichpunkte notiert hatte. Jetzt wirkte er ein Stück weit unsicher. Einerseits schienen ihn manche von Emmas Sätzen so sehr zu nerven, dass er ihnen einfach widersprechen musste. Andererseits – das konnte ich ihm anmerken – mochte er Emma auf eine gewisse Weise und hätte gerne versucht, sie zu schützen. Aber anscheinend hatte er keinen Plan, wie er das anstellen sollte.
»Einige aus eurer Bewegung«, sagte er schließlich, »fordern bereits ein militantes Vorgehen, um unseren gesamten aus eurer Sicht zerstörerischen Lebensstil zu attackieren. Damit provoziert ihr heftige Reaktionen. Ich halte nichts von einer solchen Wortwahl, aber manche rücken euch schon in die Nähe von Terroristen.«
»Das ist plumpe rechte Propaganda«, sagte Emma. »Wir sind keine Terroristen. Genau betrachtet, sind wir nicht mal radikal.«
»Nicht radikal? Nimm es mir nicht übel, aber ich würde sagen, das ist eine ziemlich gewagte Behauptung. Was soll denn radikal sein, wenn nicht eure Forderungen?«
»Ich glaube, wir sollten eine Sache endlich akzeptieren«, sagte Emma. »Radikal sind nicht die, die die Umwelt schützen, sondern die, die sie zerstören. Sie sitzen in den Vorstandsetagen der Konzerne und an den Schaltstellen der Politik. Das sind die Radikalen. Deshalb noch mal: Wir sind keine Terroristen. Im Gegenteil. Wir bekämpfen Terroristen.«
Egal, womit Emma in der Sendung konfrontiert wurde, sie hatte auf alles eine Antwort. Und sie antwortete immer ganz ruhig, wurde nie laut oder hektisch, in ihrem Gesicht gab es kaum eine Bewegung. In manchen Kommentaren wurde ihr das als Arroganz ausgelegt, aber weil ich sie von früher kannte, wusste ich, dass das nicht stimmte. Sie hatte mich manchmal unglaublich genervt, aber arrogant war sie nie gewesen. Nein, da war etwas anderes. Da war eine Trauer, eine Bitterkeit, die sie früher nicht gehabt hatte. In der ganzen Sendung lächelte sie kein einziges Mal, nicht einmal, als der Moderator sie vorstellte. Und als sie seine Fragen beantwortete, tat sie es nicht, um ihre Überlegenheit zu demonstrieren oder ihn vorzuführen oder was immer die Leute ihr danach vorwarfen. Ich glaube, es war einfach ein Ausdruck ihrer Trauer. Ihre Worte waren vollkommen ehrlich. Und hatten eine solche Wucht, dass es niemanden gleichgültig ließ.
Am nächsten Tag war sie das Gesprächsthema Nummer eins. Überall wurde das, was sie gesagt hatte, diskutiert. Sachlich ging es dabei selten zu, was ein ganz guter Beweis dafür war, dass sie den Finger ziemlich genau in die Wunde gelegt hatte. Manche warfen ihr vor, sie würde zur Gewalt aufrufen, aber das hatte sie gar nicht getan, sie hatte sich nur nicht davon distanziert. Irgendein Krawallblatt nannte sie »die kleine Teufelin mit dem Engelsgesicht« und fragte, wer sie wohl zu ihren Äußerungen ansporne. Denn dass ihr das alles selbst einfiele, könne man angesichts ihres Alters ja wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen.
Andere zeigten ein gewisses Verständnis. Zwar seien ihre Positionen übertrieben, darin waren sich so gut wie alle einig, aber in der Sache hätten sie zumindest eine gewisse Berechtigung. Außerdem: Wenn »junge Leute« – wie es gönnerhaft hieß – versuchten, eine Gesellschaft voranzubringen, indem sie sie hinterfragten, solle man darüber froh sein, anstatt sie sofort zu verurteilen. Einige meinten, es sei besser, Emma in Ruhe zu lassen, sie hätte schließlich genug durchgemacht. Das waren die Kommentare, die mir persönlich am besten gefielen, aber groß beachtet wurden sie ehrlich gesagt nicht.
»Eine Sache ist mir nicht klar, Emma«, sagte der Moderator, nachdem es zwischen ihr und den anderen Gästen noch eine Weile hin und her gegangen war. »Wenn ihr – also, du und die anderen aus eurer Bewegung –, wenn ihr Gewalt nicht ausschließt, verhindert ihr von vornherein jede Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Gruppen. Also: Wie stellt ihr euch das vor? Wie soll etwas Positives daraus werden?«
Emma sah ihn eine Zeit lang nachdenklich an. »Wissen Sie, was Sophie Scholl gesagt hat?«, fragte sie ihn dann. »Sie hat gesagt: Ein jeder ist schuldig, und um selbst keine Schuld zu haben, muss man etwas machen. Oder so ähnlich. Ich will uns nicht mit ihr vergleichen, aber das ist einfach das, was wir tun. Wir können nicht darauf warten, wer sich uns anschließt, wir haben dafür keine Zeit mehr. Wir müssen die Dinge in die Hand nehmen, und zwar sofort und ohne Rücksicht auf uns selbst. Was daraus wird, werden wir sehen. Und übrigens, diese ganze Diskussion um Gewalt, die Sie ständig führen wollen, die ist doch scheinheilig. Erstens kämpfen wir bereits gegen Gewalttäter. Und zweitens schließen Sie Gewalt ja auch nicht aus.«
Der Moderator blickte erstaunt hoch, als sie das sagte. »Du meinst: ich persönlich?«
»Ja.«
»Darf ich fragen, mit welchem Recht du zu einer solchen Behauptung kommst?«
»Na, in einer Ihrer letzten Sendungen haben Sie doch über diesen Krieg gesprochen. Sie haben gesagt, die Menschen in einem Land, das überfallen wurde, hätten das Recht, sich zu verteidigen. Und zwar, sich mit Waffen zu verteidigen. Also doch wohl mit Gewalt, oder?«
Der Moderator schüttelte den Kopf. »Du kannst nicht ernsthaft vorschlagen, das miteinander zu vergleichen, Emma.«
»Wieso denn nicht?«
»Na, weil das nun wirklich etwas völlig anderes ist. Da geht es um das Recht auf Selbstverteidigung. Die Menschen verteidigen ihr Land, weil es ihre Heimat ist, weil sie darin aufgewachsen sind, weil es sie ernährt. Für ein solches Ziel eine Waffe in die Hand zu nehmen, ist legitim.«
»Sehen Sie, dann sind wir doch einer Meinung. Ich würde auch für meine Heimat eine Waffe in die Hand nehmen.«
»Du meinst, für Deutschland?«
»Nein, dafür bestimmt nicht. Deutschland ist nicht meine Heimat. Das ist einfach nur ein Land, nicht besser als irgendein anderes. Ökologisch gesehen, sogar eines der schlimmsten. Meine Heimat ist die Natur, weil es mich ohne sie nicht geben würde. In ihr bin ich aufgewachsen, sie ernährt mich. Wird sie angegriffen, verteidige ich sie. Und wird sie mit Gewalt angegriffen, verteidige ich sie mit Gewalt. Es interessiert mich nicht, was andere davon halten. Ich habe jedes Recht der Welt, meine Heimat zu verteidigen.«
Nach der Sendung explodierte das Netz geradezu. Emmas Bemerkung, sie sei jederzeit dazu bereit, für die Natur zu kämpfen, nicht aber für ihr Land, und überhaupt die Tatsache, dass sie es wagte, in ihrem Alter solche Dinge von sich zu geben, provozierte anscheinend viele bis aufs Blut. Aus jeder Ritze des Netzes quollen die Beleidigungen und Beschimpfungen hervor. Und dazu kamen wie immer alle möglichen üblen Spekulationen über ihr Privatleben und darüber, dass ihre Familiengeschichte, an die ich mich noch ein bisschen erinnern konnte, vor allem der Tod ihrer Eltern, irgendwelche psychischen Störungen bei ihr ausgelöst haben könnte. Alles in allem war es widerlich.
Auf der anderen Seite führten diese Anfeindungen nach allem, was ich mitbekam, dazu, sie in ihren eigenen Kreisen zu einer richtigen Heldin zu machen. Je übler die Beleidigungen wurden, umso mehr solidarisierten sich dort alle mit ihr und feierten sie als diejenige, die es gewagt hatte, die großen Tabus zu brechen und endlich das zu sagen, was längst hätte gesagt werden müssen. In den Tagen nach ihrem Auftritt kam es mir so vor, als würden plötzlich alle Diskussionen unserer Zeit auf ihrem Rücken ausgetragen.
Ich selbst wusste am Anfang nicht so recht, was ich von den ganzen Sachen, die sie in der Sendung gesagt hatte, halten sollte. Zuerst war mir vieles eine Spur zu heftig, so wie es auch damals gewesen war, als wir versucht hatten, unsere Dialoge für das Theaterstück zu schreiben. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass alles im Grunde doch eine erstaunliche Logik hatte. So radikal zumindest einige ihrer Sätze wirkten, ich konnte keine Widersprüche darin finden. Das machte mir ganz schön zu schaffen. Außerdem hatte Emma mich mit ihrem Auftreten wirklich beeindruckt. Ich meine, sie war gerade mal siebzehn, ein halbes Jahr jünger als ich, das wusste ich noch von damals, und hatte trotzdem schon eine Ausstrahlung, die faszinierend war.
Aber entscheidend war etwas anderes. Ich weiß nicht mehr, wann ich darauf kam, vielleicht eine Woche nach der Sendung, vielleicht auch zwei. Ich saß in der U-Bahn, es war an einer dieser Stellen, wo sie den Tunnel verlässt und oberirdisch weiterfährt. Und genau dort, während ich nach draußen sah, fiel es mir plötzlich ein. Ich hatte schon damals gespürt, dass Emma mich an jemanden erinnerte. Und jetzt wurde es mir klar. Ja! Sie erinnerte mich an Arne, an meinen Bruder. Ich wusste erst nicht, wieso. Und so ist es ja oft, wenn einen jemand an einen anderen erinnert: Man kennt den Grund nicht. Sind es die Augen? Ist es die Stimme? Eine bestimmte Bewegung? Oder eine Kombination aus vielen Dingen?
Heute verstehe ich es vielleicht ein bisschen besser, nach allem, was seitdem passiert ist. Ich glaube, es ist diese seltsame Mischung aus Traurigkeit und Entschlossenheit, die Emma in der Sendung ausstrahlte, mit jedem Blick und jeder Geste und jedem Wort. Und ihre Ungeduld, die aus der Ahnung resultierte, dass nicht viel Zeit bleibt.
Nicht viel Zeit, weil alles vergeht. In Emmas Fall die Natur, die sie so sehr liebt. Und in Arnes Fall – sein Leben, von dem er immer wusste, dass es nicht lange dauern würde.
Emma
Tief in der Nacht wacht Emma auf. Etwas hat sie geweckt, aber es war kein Geräusch, es war weder der klagende Schrei einer Möwe noch das Signalhorn eines Schiffes draußen auf dem Wasser, auch nicht ihr Großvater unten im Erdgeschoss des Turms. Sie schlägt die Augen auf und dann begreift sie: Es ist das Licht. Es leuchtet wieder.
Sie springt auf und läuft zum Fenster. Dort unten kann sie den Lichtstreifen sehen, der über die Insel zieht, kann beobachten, wie er die Bäume und die Sträucher, die Häuser des Dorfes und den Kirchturm, den Strand und die Wellen aus der Dunkelheit herausschält und wieder darin verschwinden lässt. Sie wundert sich, denn eigentlich ist der Leuchtturm schon seit Jahren außer Betrieb. Aber jetzt strahlt er wieder, und als sie näher hinsieht, fällt ihr auf, dass der Lichtstreifen nicht weiß ist, sondern gelb, gelb wie die Sonne.
Und noch etwas bemerkt sie: Die ganze Insel ist plötzlich voller Menschen. Sie stehen da, stehen in kleinen Gruppen zusammen, mitten in der Nacht, auf den Wegen und auf den Feldern, sprechen aufgeregt miteinander und blicken immer wieder zur Spitze des Leuchtturms empor. Manche zeigen auch darauf, wie auf ein Naturschauspiel, auf das sie lange verzichten mussten.
Emma schreckt auf, ein lautes Pochen ist zu hören. Es kommt von unten, von der Tür. Gleich darauf sieht sie auch den Streifenwagen, der den Hügel heraufgefahren ist und mit eingeschaltetem Blaulicht dasteht. Wieder das Pochen, der ganze Turm erzittert davon. Sie hört ihren Großvater, wie er grummelnd in seinen alten Pantoffeln zur Tür schlurft und sie öffnet.
»Nein, Emma ist nicht hier«, sagt er mit seiner tiefen Stimme. »Und, ja, natürlich war sie es, die den Leuchtturm wieder in Betrieb gesetzt hat. Wer sollte es denn sonst gewesen sein? Aber sie ist jetzt weit fort. Sie ist in der Stadt. Da gibt es keine Leuchttürme. Auf Wiedersehen.«
Im nächsten Moment ist sie wirklich wach. Sie hat die Stimme ihres Großvaters noch im Ohr, aber sie ist nicht mehr bei ihm und sie ist jetzt auch kein kleines Mädchen mehr. Als sie an ihn denkt, stößt sie einen tiefen Seufzer aus. Immer wenn sie das Gefühl hat, sich vergewissern zu müssen, ob das, was sie tut, richtig ist, kehrt sie zu ihm zurück, mal im Traum, manchmal auch nur in Gedanken. »Habe ich es gut gemacht?«, fragt sie ihn bei solchen Gelegenheiten. Und wenn sie sieht, wie er nickt, wenn sie seinen Blick sieht, diesen ganz besonderen Blick, den er nur für sie aufspart, dann weiß sie, dass alles in Ordnung ist.
Sie gähnt und räkelt sich unter der Decke. Es ist schon hell, sie muss ziemlich lange geschlafen haben. Als sie die Decke zurückschlägt und den Kopf hebt, sieht sie Valerie. Sie liegt in der anderen Ecke des Zimmers auf ihrer Matratze, auf dem Bauch, die nackten Füße in die Höhe gereckt, sodass ihre vom Schmutz der Wohnung verdreckten Fußsohlen zu sehen sind, und betrachtet etwas auf einem Laptop. Sie ist ganz darin vertieft, der Bildschirm wirft einen Schein auf ihr Gesicht, ihr etwas herbes, aber auch schönes Gesicht mit den entschlossenen Augen und dem spöttischen Ausdruck, der meistens in ihren Mundwinkeln liegt. Als Emma sie ansieht, fällt ihr auf, dass sie gar nicht weiß, wie alt Valerie ist, sie hat sie bisher noch nicht danach gefragt. Vielleicht fünf Jahre älter als sie selbst, schätzt sie, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Durch die Bewegung wird Valerie auf sie aufmerksam und dreht sich zu ihr um. »Endlich bist du wach«, sagt sie. »Wurde auch langsam Zeit.«
Sie steht auf, den Laptop in den Händen, und wirft mit einer raschen Kopfbewegung ihre Haare zurück. Dann kommt sie zu Emma und kriecht neben ihr unter die Decke.
»Hey!« Emma dreht sich von ihr weg. »Ich hab doch überhaupt nichts an.«
Valerie lacht. Als ob der Einwand sie erst recht ermutigt hätte, drückt sie sich an Emma und umarmt sie von hinten.
»Na und? Das stört mich nicht.«
»Ja, aber – mich vielleicht?«
Valerie greift nach ihrem Laptop, hebt ihn über sich und Emma hinweg und stellt ihn so auf die Decke, dass beide den Bildschirm sehen können. Dann drückt sie eine Taste.
»Das musst du dir ansehen.«
Ein Video startet, mit Musik, sie ist zuerst leise und getragen, gewinnt aber mit jedem Takt an Dramatik und wird lauter, was ziemlich bedrohlich klingt. Text erscheint, und zwar, wie Emma schnell merkt, Sätze aus dem Manifest von NO ALTERNATIVE. »All dies zu tun, sofort und radikal, ist unsere einzige Chance«, steht dort. »All dies zu tun, ist unsere letzte Chance.« Der Text wird ausgeblendet und plötzlich sieht sie sich selbst. In einer erstaunlichen Schärfe und Klarheit ist zu erkennen, wie sie, vom Licht des Scheinwerfers angestrahlt, in ihrem Pinguinkostüm die Pyramide des Messeturms hinaufklettert. Die Kamera folgt ihr, bis sie oben ist, und zeigt, wie sie das Transparent befestigt und entrollt. Dann steigt die Drohne noch etwas höher und umkreist die Szene, und diese Aufnahmen, schräg von oben gefilmt, die Lichter der Stadt im Hintergrund und Emma davor, wie sie mit der einen Hand den Blitzableiter umklammert und mit der anderen auf das Banner zeigt, sind von einer solchen Intensität, dass es einem alleine vom Zuschauen den Atem verschlägt.
Valerie beugt sich über sie. »Emma Larsen«, sagt sie, »ganz allein auf dem Dach der Welt.«
»Nein«, sagt Emma. Valeries Mund ist jetzt nah an ihrem Ohr, sie kann ihren Atem spüren und auch die Haare, die ihr auf die Schulter und den Hals fallen. »Da oben bin ich nicht Emma. Da oben bin ich Nike.«
»Na und?«, sagt Valerie. »Das ändert nichts. Du hast es getan, ganz allein.« Sie kommt noch ein Stück näher, sie flüstert jetzt. »Du warst mutiger als all diese Scheißtypen, die immer ihr Maul so weit aufreißen. Du weißt, von wem ich rede.«
Emma blickt sie an. »Ist das Video schon im Netz?«
»Während Mademoiselle Pinguin sich faul in ihrem Bett gewälzt hat«, sagt Valerie und lacht, »haben Noah und ich das Ding noch in der Nacht geschnitten. Noah ist heute früh los und hat es hochgeladen.«
»Wo hat er’s gemacht?«
»In der Unibib, glaube ich. So genau erzählt er das nie. Auf jeden Fall hat er es, wie ich ihn kenne, ordentlich gestreut. Wahrscheinlich gehen die Klicks allmählich durch die Decke.«
Emma langt zur Tastatur und lässt das Video ein zweites Mal laufen. »Geht er später noch mal los, um zu sehen, wie die Reaktionen sind?«
»Schätze, das mache ich selbst. Vielleicht auch Vincent. Mal sehen.« Valerie fährt ihr mit den Fingerspitzen über die Schulter. »Ich bin stolz auf dich, hörst du?«
Ihre Stimme klingt plötzlich verändert. Sonst ist sie oft schroff, hat manchmal einen bestimmenden, dann wieder einen spöttischen Ton. Jetzt wirkt sie sanft, ganz weich.
Emma dreht sich zu ihr um. Der Klang gefällt ihr, sie vergisst fast, dass sie nackt ist.
»Gehöre ich jetzt richtig dazu?«, fragt sie.
»Ja, das tust du. Und falls das jemand bezweifelt, kriegt er es mit mir zu tun. Da kannst du sicher sein.«
Valerie schlägt die Decke zurück und steht auf. »Komm jetzt«, sagt sie und ihre Stimme ist wieder die alte. »Die anderen warten schon.«
Sie geht zur Tür. Dort bleibt sie noch einmal stehen, dreht sich um, wartet, bis Emma ebenfalls aufgestanden ist, und betrachtet sie, von oben bis unten, beinahe unverschämt lange, jedes Detail sorgfältig studierend. Schließlich lächelt sie, wendet sich ab und verschwindet nach draußen.
Emma sieht ihr nach, ein wenig verwirrt, vielleicht sogar eingeschüchtert, auf jeden Fall aber neugierig. Sie kann sich nicht erinnern, jemals auf diese Art angeschaut worden zu sein, so direkt und herausfordernd und ohne jede Scham. Es ist neu für sie, in gewisser Weise schockierend, aber der Schock fühlt sich alles andere als unangenehm an. Jedenfalls hat sie kein Bedürfnis verspürt, sich vor Valeries Blicken zu verstecken.
Sie bückt sich nach ihren Sachen, die sie in der Nacht auf den Boden geworfen hat, und streift sie über. Es sind die gleichen, die sie gestern getragen hat und vorgestern und an den Tagen davor. Sie hat weder die Zeit noch den Wunsch gehabt, viel mitzunehmen aus ihrem alten Leben in dieses neue, das so plötzlich und unerwartet begonnen hat, mit einer solchen Heftigkeit, dass sie noch immer nicht ganz begreift, was eigentlich mit ihr geschieht.
Als sie angezogen ist, geht sie zum Fenster und blickt hinaus. Sie kann weit sehen, die Wohnung liegt im Dachgeschoss eines heruntergekommenen Altbaus, in einem Viertel der Stadt, das mit Sicherheit in keinem Reiseführer erwähnt wird. Valerie hat ihr erzählt, dass sie gerne solche Wohnungen aussuchen für die Zellen der Organisation, in Häusern, in denen die Leute keinen Kontakt zueinander haben und ihn auch gar nicht haben wollen, und innerhalb dieser Häuser wiederum so hoch wie möglich, damit es keine unliebsamen Beobachter gibt.
Emma wendet sich vom Fenster ab, verlässt das Zimmer und durchquert den kleinen, düsteren Flur der Wohnung. Die Tür zu dem Raum, in dem Noah und Vincent schlafen, steht offen. Wie üblich sieht es dort aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Als sie in die Küche kommt, warten die anderen wirklich schon auf sie. Und sie warten nicht nur, sie klatschen sogar. Emma hebt abwehrend die Hände, geht etwas verlegen zu dem groben Holztisch, an dem sie immer essen, und setzt sich schnell.
»Hier, iss das«, sagt Valerie, die mit untergeschlagenen Beinen auf dem Stuhl neben ihr hockt, und schiebt ihr eine Schale mit Müsli hin. »Habe ich extra für dich gemacht. Dreißig Prozent Eiweiß. Gibt ordentlich Kraft für den Kampf.«
»Seit wann machst du mir Frühstück?«
»Nur heute. Zur Belohnung.«
»Kann ich auch einen Kaffee haben?«
»Der läuft noch durch. Den kriegst du, sobald du aufgegessen hast. Los, mach jetzt!«
Emma weiß, dass Valeries Befehlston immer halb spaßig und halb ernst gemeint ist, so gut kennt sie sie inzwischen. Gehorsam taucht sie ihren Löffel in das Müsli und beginnt zu essen. Sie hat wirklich Hunger, das Klettern in der Nacht war anstrengend. Eine Zeit lang ist es still, die anderen sehen zu, wie sie ihr Frühstück in sich hineinschaufelt.
»Ein paarmal hatte ich echt Angst um dich bei der Aktion«, bricht Noah schließlich das Schweigen. Er sitzt auf der anderen Seite des Tisches, Emma gegenüber, und sieht müde aus, mit den verwuschelten Haaren über dem schmalen Gesicht und den tiefen Ringen um die Augen. »Ich hätte am liebsten abgebrochen, du weißt schon, erst der Regen und dann der Wind. Aber ich hatte ja keine Verbindung zu dir. Ich konnte nur zusehen und filmen.«
»Ha!« Valerie lacht kurz und triumphierend auf. »Emma hat eben mehr Mumm als irgend so ein hergelaufener Typ.«
»Ja, das hat sie«, sagt Noah. »Ich gebe es zu.«
»Es hat nichts …« Emma stockt und schluckt, um den Mund frei zu bekommen. »Es hat nichts mit Mumm zu tun. Ich weiß einfach, wie man so etwas macht. Es ist –«
»Halt die Klappe!«, fährt Valerie sie an. »Wenn ich eins nicht leiden kann, ist es diese verlogene, aufgesetzte Bescheidenheit. Du hast einfach einen Wahnsinnsmut gehabt, das ist alles.«
Emma sieht sie erstaunt an, dann lächelt sie und isst weiter. »Ja, Nike hat Mut gehabt«, sagt sie. »Nike hat viel Mut gehabt.«
Valerie grinst. »Wenn du auf die Spitze des Messeturms kletterst«, deklamiert sie mit erhobenem Löffel, »ist es eine strafbare Handlung. Wenn du auf die Spitze des Messeturms kletterst und ein Banner darauf anbringst, ist es eine politische Aktion.«
»Gut zitiert, Löwe«, sagt Noah. »Jedenfalls wird uns die Sache eine Menge Aufmerksamkeit bringen, so viel steht fest. Ich frage mich, ob wir ab jetzt noch vorsichtiger sein müssen.«
»Dann verrate uns mal in deiner tiefen Weisheit, wie du das machen willst«, sagt Valerie. »Wir tun doch schon alles, was geht. Verkriechen uns hier in diesem Dachbunker, mehr oder weniger in der Wildnis. Benutzen kein Handy, benutzen kein Netz. Gehen nie zweimal hintereinander in denselben Laden, gehen nie zweimal hintereinander den gleichen Weg. Sind fast nur nachts draußen, nehmen keine Öffentlichen, verstecken uns unter Kapuzen, umgehen alle Überwachungskameras und treffen keine Leute von früher mehr. Die einzige Möglichkeit, noch unauffälliger zu sein, wäre, uns umzubringen.«
»Außerdem: Aufmerksamkeit ist doch das, was wir wollen«, sagt Vincent. Er sitzt nicht mit am Tisch, sondern steht, die massigen Schultern hochgezogen, seine Hände in den Hosentaschen vergraben, gegen den Kühlschrank gelehnt da. Als er Emma ansieht, wendet sie sich ab. Sie mag seinen Blick nicht. Er ist nicht warm wie der von Noah, auch nicht spöttisch wie der von Valerie, sondern merkwürdig kalt und leer.
»Deine Aktion war stark«, sagt er, aber ohne Begeisterung. »Du hast meinen Respekt dafür. Allerdings war es eher eine symbolische Sache. Lasst uns lieber über echte Aktionen sprechen.«
Emma hört Valerie scharf einatmen. Dann sieht sie, wie sie die Stirn runzelt und Vincent düster anblickt. Sie kennt diesen Gesichtsausdruck von ihr, normalerweise folgt darauf ein Gewitter. Aber jetzt beherrscht sie sich. »Zum Beispiel?«, fragt sie kühl.
»Ich habe einen Bericht gelesen über diese Kreuzfahrtschiffe«, sagt Vincent. »Ein einziges von ihnen verbrennt jede Stunde fünf Tonnen hochgiftiges Schweröl. Und die Fahrten sind völlig sinnlos, nur für dekadente, verfettete, versoffene Touristen. Wie wäre es, wenn wir eins davon hochgehen lassen? Oben an der Küste. In Kiel. Oder in Bremerhaven.«
Valerie winkt ab. »Im Führungszirkel haben wir das schon mal diskutiert. Vor ein paar Monaten. Aber wir haben die Idee verworfen. Die Gefahr wäre zu groß, dass Leute dabei sterben.«
»Das weiß ich selbst. Wir machen es ja auch nicht, solange das Ding auf See und voll besetzt ist. Wir starten die Aktion, wenn es im Hafen liegt. Dann kommen wir auch viel besser ran.«
»Da sind aber auch Leute an Bord«, sagt Valerie. »Zumindest welche von der Besatzung. Und zwischen den Fahrten, wenn sie das Schiff fit machen, wird darauf gearbeitet, Tag und Nacht. Nein, wie auch immer wir es angehen würden: Es macht keinen Sinn.« Sie stößt Emma an. »Was sagst du dazu?«
Emma zuckt mit den Schultern. »Jedes von den Teilen, das wir auf den Grund des Ozeans schicken könnten, wäre ein Erfolg. Trotzdem: Ich will nicht, dass dabei jemand stirbt. Wir haben mit den Leuten, die auf solchen Schiffen mitfahren, zwar nichts zu tun. Aber es sind immer noch Menschen.«
»Das stimmt«, sagt Noah. »Die beiden haben recht, Vincent: Es kommt nicht infrage. Wir sind nicht die RAF.« Er sieht Valerie an. »Da kannst du noch so oft Ulrike Meinhof zitieren.«
»Ach, Blödsinn«, sagt Valerie. »Ich zitiere sie ja nicht, weil ich es gut finde, was sie getan hat, das weißt du genau. Aber natürlich gibt es Parallelen zwischen uns und den Leuten damals. Die haben eine Generation bekämpft, die für die Verbrechen der Nationalsozialisten verantwortlich war und sich geweigert hat, dafür einzustehen. Wir bekämpfen eine Generation, die für die Zerstörung des Planeten verantwortlich ist und sich genauso weigert, dafür einzustehen.«
»Kann ja sein«, sagt Noah. »Aber es bleibt dabei: Von der RAF trennen uns Welten. Die haben behauptet, hier in Deutschland gäbe es irgendwelche geknechteten Arbeitermassen, die mit Gewalt befreit werden müssten. Das war totaler Unsinn, eigentlich haben sie ein Phantom bekämpft. Wir kämpfen gegen eine echte Bedrohung, und wir tun es, wenn man bedenkt, wie tödlich die ist, immer noch mit ziemlich sanften Mitteln.«
»Ja«, sagt Valerie. »Fragt sich nur, wie lange noch.«
Emma blickt sie von der Seite an. Sie wartet, ob sie noch etwas hinzufügt, aber es kommt nichts mehr. »Was meinst du damit?«, fragt sie schließlich.
»Ich meine: Ja, es stimmt, wir sind nicht die RAF. Wir haben ein Gewissen. Wir haben Skrupel. Wenn bei einer Aktion Leute getötet werden könnten oder schlimm verletzt, ist es für uns ein Grund, das nicht zu machen.«
»Ja. Das ist doch auch richtig so.«



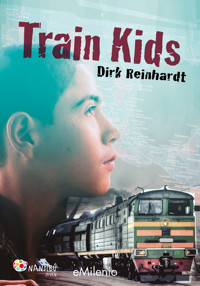

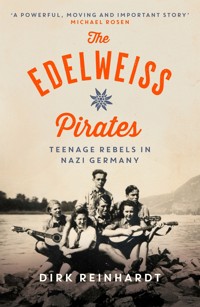













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









