
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerstenberg Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Jedes Jahr im Frühling kommen die Nomaden auf dem Weg zu ihrem Sommerlager in den afghanischen Bergen in Sorayas Dorf vorbei. Mit ihnen kommt Tarek, der so wunderbare Geschichten zu erzählen weiß. Doch dieses Jahr wartet Soraya vergeblich auf ihn. Als siebte Tochter ist sie einem alten Brauch zufolge als Junge aufgewachsen, konnte sich frei bewegen und zur Schule gehen. Mit vierzehn Jahren hat sie jedoch das Alter erreicht, wo sie schon längst wieder als Mädchen leben sollte, in der Stille des Hauses. Die Taliban drängen unmissverständlich darauf. Auch Tarek haben sie bedroht. Sie erwarten, dass der erfahrene Spurenleser für sie arbeitet. Tarek und Soraya sehen keinen anderen Ausweg: Unabhängig voneinander machen sie sich auf in die Fremde. In den Bergen treffen sie unverhofft aufeinander. Ein atmosphärischer Roman von Abschied und Aufbruch, poetisch und packend zugleich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dirk Reinhardt
ÜberdieBerge
und
über
das Meer
Roman
Inhalt
Über die Berge und das Meer
Nachwort
Glossar
Über den Autor
Wenn sie dem Glück einen Namen geben dürfte, würde sie es den Frühling nennen. Denn jetzt, im Frühling, ist sie vorbei, die Kälte des Winters, die das kleine Dorf in den Bergen so erbarmungslos gefangen hielt. Sie müssen nicht mehr jede Nacht um einen heißen Stein in der stickigen Wohnstube ihres Hauses sitzen, sondern können wieder auf dem Dach unter den Sternen schlafen. Die Schneeschmelze lässt den Bach anschwellen, die Sträucher an seinen Ufern werden grün und die Obstbäume auf den Feldern ihres Vaters tragen die ersten Knospen. Vor allem aber ist der Frühling die Zeit, in der die Kuchi hier vorbeiziehen, die Nomaden auf ihrem Weg vom Winterquartier in der Ebene zum Sommerlager in den Bergen. Und mit ihnen kommt Tarek, der sich so gut auskennt mit den Tieren und den Gräsern und den Winden und ihr jedes Mal, wenn sie ihn sieht, eine neue, noch spannendere Geschichte zu erzählen weiß.
Soraya seufzt, als sie an Tarek denkt. Schon im letzten Jahr hat sie ungeduldig auf ihn gewartet, jetzt ist ihre Sehnsucht noch größer. Eigentlich ist sie auf dem Weg zum Brunnen, um Wasser zu holen, aber sie ist fest entschlossen, die Gelegenheit zu nutzen, zu jener Stelle über dem Dorf hinaufzusteigen, von der sie bis in die Ebene sehen und die Staubwolken, die die Herden der Kuchi aufwirbeln, schon von Weitem erkennen kann.
Der Weg vom Haus ihres Vaters zum Brunnen führt sie mitten durch das Dorf, ein kleines paschtunisches Dorf in einem abgelegenen Tal, wie es sie zu Hunderten in den Bergen gibt. Ganz in der Nähe liegt die Grenze zu Pakistan, man kann sie schon fast sehen. Die Häuser des Dorfes lehnen sich an den Berghang, der ihnen Schutz vor Sonne und Stürmen bietet. Die meisten sind aus Lehm, manche auch aus Stein, da wohnen die Familien, denen die Getreidefelder gehören. Sorayas Familie besitzt nur einige Felder mit Obstbäumen und dazu noch ein paar Ziegen und Hühner, deshalb ist ihr Haus aus Lehm. Aber das ist nicht schlimm, sie mag den Lehm lieber als den Stein, seine rötlich braune Farbe und die Wärme, die er ausstrahlt, und seinen Duft, vor allem am Morgen, wenn ihre Mutter den Boden mit Wasser befeuchtet, dann riecht der Lehm ganz süß und frisch.
Während sie, einen Eimer in jeder Hand, durch das Dorf geht, lässt sie ihren Blick über die Häuser wandern. Sie kennt alle, die dort leben, jeden Einzelnen. In dem Haus, an dem sie gerade vorbeigeht, wohnt Roxana mit ihrer Mutter und ihren Großeltern und Geschwistern. Sie ist einige Jahre jünger als Soraya, aber man sieht sie fast nie, nur ab und zu als Schatten in der Tür, der verschwindet, sobald jemand die Straße entlangkommt. Als sie klein war, hat sie mitansehen müssen, wie ihr Vater erschossen wurde, genau hier, am hellen Tag, von einem Mann aus einem anderen Dorf, der sich von ihm beleidigt fühlte. Seitdem hat sie kein einziges Wort mehr gesprochen, mit niemandem, und die Straße hat sie auch nicht mehr betreten.
In dem Haus daneben lebt eine Familie, deren ältester Sohn im letzten Sommer das Dorf verlassen hat. Er heißt Rohani. Soraya kann sich gut an ihn erinnern, sie hat ihn nicht besonders gemocht, denn immer wenn er sie sah, lag dieser spöttische, herablassende Ausdruck in seinen Augen. Er arbeitet jetzt für die Amerikaner als Fahrer. Man sagt, so würde er drei- oder viermal so viel verdienen, wie er es hier im Dorf könnte. Viele sprechen seinen Namen mit Verachtung aus und sagen, er sei ein Verräter. Aber vielleicht, denkt Soraya, sind sie auch nur neidisch auf ihn, denn das Haus seiner Familie ist prächtig ausgestattet, prächtiger als die meisten hier. Nur in der Nacht, wenn keine amerikanischen Patrouillen mehr in der Nähe sind, kommen die Taliban aus ihren Verstecken in den Bergen herab und statten dem Haus manchmal einen Besuch ab. Es sind keine freundlichen Besuche und Sorayas Vater sagt, wenn Rohani den Taliban in die Hände falle, sei sein Leben nichts mehr wert, dann müsse er sterben und auch seine Familie werde dann keine Freude mehr an ihrem prächtigen Haus haben.
Soraya schwenkt ihre Eimer in der Luft, während sie weitergeht. Zu jedem Haus würde ihr eine solche Geschichte einfallen – auch wenn sie sie niemals so gut erzählen könnte wie Tarek. Sie zögert kurz, ihr Blick wandert sorgenvoll zu den Bergen. Im letzten Frühjahr waren er und seine Familie um diese Zeit schon da, im Jahr davor auch. Irgendetwas muss sie aufgehalten haben. Vielleicht ist es nur das Wetter oder sie haben einen weiteren Weg als zuletzt oder das Scheren der Schafe hat länger gedauert. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes, geht es ihr durch den Kopf. Aber sie schiebt den Gedanken beiseite, als sie vor sich den Brunnen auftauchen sieht.
Dort ist wie üblich viel los, es ist der wichtigste Treffpunkt des Dorfes, zumindest für die Frauen und die Kinder. Sie sind nicht nur hier, um Wasser zu holen, sondern auch, um zu hören, was es Neues gibt. Vor allem die Frauen zögern das Auffüllen ihrer Eimer immer so lange wie möglich hinaus, weil sie froh sind, wenigstens einmal am Tag das Haus zu verlassen und draußen zu sein. Natürlich sind sie nie allein, das dürfen sie ja nicht. Die Älteren haben einen ihrer Söhne dabei, die Jüngeren einen ihrer Brüder. Die Jüngeren sind immer verschleiert, die Älteren nicht, die tragen meistens nur ein Kopftuch, da kommt es nicht mehr so darauf an.
»Hey, Samir!«
Soraya dreht sich um. Nuri steht vor ihr, ein Junge, den sie aus der Schule kennt, sie ist ein paar Jahre älter als er. Er hilft seiner Mutter, die ihr jüngstes Kind in einer Wiege auf dem Kopf trägt, beim Schleppen des Wassers. Mit einer verschwörerischen Geste deutet er auf ein Haus, das in der Nähe des Brunnens steht.
»Gleich, in einer Stunde?«, flüstert er.
Soraya weiß, was er meint. In dem Haus lebt eine der vornehmeren Familien des Dorfes, sie besitzen einen kleinen Vogel, der in einem Käfig lebt und eine wunderschöne Stimme hat. Sie und Nuri und einige andere sind früher manchmal zu dem Haus geschlichen, um dem Vogel zuzuhören, man kann ihm etwas vorpfeifen, dann ahmt er es nach. Anscheinend will Nuri auch heute wieder dorthin, aber als Soraya darüber nachdenkt, hat sie das Gefühl, dass sie aus dem Alter, in dem man Vögel belauscht, inzwischen heraus ist. Das ist eher eine Beschäftigung für die kleineren Jungen.
»Nein, Nuri«, flüstert sie zurück. »Es geht nicht. Ich muss etwas erledigen.«
Sie wendet sich von ihm ab. Für einen Moment sind die Gespräche verstummt, als sie am Brunnen erschienen ist, jetzt setzen sie wieder ein. Die Frauen nicken ihr zu. Sie lassen sie nie spüren, dass sie anders ist, das tun nur die Männer. Vielleicht weil die Frauen sich vorstellen können, wie es in ihr aussieht, die Männer interessieren sich nicht dafür.
»Samir!«
Rubina taucht vor ihr auf, in Begleitung ihres jüngsten Bruders, der gerade einmal drei oder vier ist. Sie trägt den Tschador, der ihr Gesicht teilweise bedeckt, aber Soraya erkennt sie sofort, sie wohnt nur drei Häuser von ihnen entfernt.
»Gut, dass ich dich treffe«, sagt Rubina. »Wie geht es Djamila?«
Djamila ist Sorayas ältere Schwester. Sie und Rubina sind befreundet, doch jetzt, wo sie versprochen sind und noch in diesem Jahr heiraten werden, dürfen sie kaum noch das Haus verlassen und sich auch nicht mehr gegenseitig besuchen.
»Sie ist allmählich ziemlich aufgeregt«, sagt Soraya. »Wegen der Hochzeit.«
»Ja, ich weiß«, antwortet Rubina. »Richte ihr meine Grüße aus. Und«, für einen Augenblick tritt sie ganz nah an Soraya heran, »gib ihr einen Kuss von mir. Hörst du, Samir? Den letzten.«
Ihre Stimme klingt traurig, als sie das sagt, und gleich darauf ist sie verschwunden. Soraya blickt ihr nach, wie sie die Straße entlanggeht, ihren kleinen Bewacher an der Hand, der kaum gehen kann, ohne zu stolpern. Sie seufzt und wird selbst traurig, als sie an Djamila denkt. Dann dreht sie sich um und stellt ihre beiden Eimer in einer schattigen Ecke neben dem Brunnen ab. Sie wird später zurückkehren und sie füllen, es hat keine Eile, so dringend erwartet ihre Mutter sie nicht zurück. Sie hat genug Zeit, in den Hügeln oberhalb des Dorfes Ausschau nach Tarek zu halten, und genau das wird sie jetzt tun.
Als sie den Brunnen wieder verlässt, schaut sie prüfend zum Himmel. Es ist ein klarer Frühlingstag, nur über den Bergen im Südosten, in Richtung der Grenze, stehen einige Wolken. Rings um das Dorf arbeiten die Männer auf den Feldern und in den Gärten, später, am Nachmittag, wird sie auch eine Weile dort sein, um ihrem Vater und ihrem Großvater bei der Arbeit zu helfen, aber das hat noch Zeit.
Sie biegt um eine Ecke und dann sieht sie die Jungen. Es sind etwa ein Dutzend, genau die, mit denen sie meistens zusammen ist, in der Schule und auch hier draußen. Eigentlich hat sie gehofft, ihnen heute nicht zu begegnen, ihr kleiner Ausflug in die Berge soll geheim bleiben. Kurz überlegt sie, ob sie sich noch zurückziehen kann, aber da haben die Jungen sie schon entdeckt.
»Hey, Samir!«, ruft einer. »Wohin willst du?«
Soraya bleibt stehen und wartet, bis sie herangekommen sind. »Wasser holen«, sagt sie.
»Das muss aber seltsames Wasser sein«, sagt ein anderer und tritt nach vorn. Soraya verzieht das Gesicht, als sie ihn sieht. Es ist Dawuhd. Natürlich! Wer sonst? Er sucht ständig Streit mit ihr, eigentlich immer, wenn sie sich sehen. »Du hast nämlich gar keinen Eimer dabei«, fährt er fort. »Und der Brunnen ist da drüben.«
Das ist der Grund, warum sie den anderen nicht begegnen wollte. Sie hat gewusst, dass Dawuhd dumme Fragen stellen würde, genau die Fragen, die sie nicht hören will.
»Ich hole das Wasser aus den Bergen«, sagt sie. »Da ist es frischer. Und ich hole es in meinem Mund. In den passen nämlich mehr als zehn Eimer rein, wenn ich ihn richtig aufreiße.«
Die anderen Jungen lachen, anscheinend sind sie der Meinung, dass sie das kurze Wortgefecht gewonnen hat. Nur Dawuhd lacht nicht. Er starrt sie an, seine Augen sind plötzlich ganz schmal.
»Ich habe dich beobachtet, Samir«, sagt er. »Du gehst oft in die Berge in letzter Zeit. Und ich glaube, ich weiß auch, warum.« Er tritt auf sie zu und bleibt direkt vor ihr stehen. »Du spionierst für die Amerikaner.«
Soraya hält den Atem an. Das ist so ziemlich der schlimmste Vorwurf, den man hier jemandem machen kann, und besonders schlimm ist er, wenn er von einem wie Dawuhd kommt. Sein älterer Bruder ist seit dem letzten Jahr verschwunden. Die Leute erzählen, er hätte sich den Taliban angeschlossen, die in den Bergen und hinter der Grenze lauern. Vor einigen Monaten ist eine Patrouille der Amerikaner ins Dorf gekommen und hat Dawuhds Vater mitgenommen, um ihn zu verhören. Eine Woche später brachten sie ihn zurück, Soraya weiß es noch gut, sie war da und hat es beobachtet. Er ging gebückt und humpelte und konnte niemandem mehr in die Augen blicken. Er verschwand im Haus, seitdem hat ihn keiner mehr gesehen.
Viele der Jungen bewundern die Taliban, weil sie stark und mutig sind und sogar die Amerikaner mit ihren gepanzerten Wagen und Hubschraubern und Raketen Angst vor ihnen haben. Dawuhd bewundert sie ganz besonders, vor allem seit das mit seinem Vater passiert ist. Er erzählt gern aufschneiderische Geschichten über das Leben in den Ausbildungscamps in Pakistan und träumt davon, später selbst dorthin zu gehen und gegen die Amerikaner zu kämpfen, wie sein Bruder. Manche im Dorf flüstern, er spioniere schon jetzt für die Taliban. Aber man kann es nicht wissen. Es ist nur ein Gerücht.
Eigentlich ist es wie ein Kampf zwischen Tag und Nacht, denkt Soraya. Am Tag kommen die Amerikaner, dringen in die Häuser ein, durchsuchen und verwüsten alles, lassen ihren Dolmetscher unangenehme Fragen stellen und verschleppen jeden, von dem sie glauben, er könnte Kontakt zu den Taliban haben. Und in der Nacht, im Schutz der Dunkelheit, steigen die Taliban aus den Bergen herab, pochen gegen die Türen jener, die sie im Verdacht haben, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten, lassen sich von ihnen bewirten, bedrohen sie, manchmal verprügeln sie sie auch. Die meisten hier wollen weder mit den einen noch mit den anderen etwas zu tun haben und wünschen sich einfach, in Ruhe gelassen zu werden. Aber das ist schwer. Wie soll man in Ruhe leben, wenn man sein Lager zwischen zwei hungrigen Wolfsrudeln aufgeschlagen hat?
Während Soraya all das durch den Kopf geht, steht Dawuhd noch immer vor ihr und blickt sie herausfordernd an. Die anderen Jungen haben einen Kreis um sie gebildet und warten, was passieren wird. Soraya senkt den Kopf und blickt zur Seite, um Dawuhd in Sicherheit zu wiegen, dann stößt sie mit aller Kraft zu, mit einer so heftigen Bewegung, dass er nach hinten taumelt und zu Boden fällt. Sie tut es, wie sie es bei den Jungen gelernt hat, schnell und hart, damit keine Zweifel aufkommen, dass sie Samir ist und nicht Soraya. Vor einigen Jahren hat Dawuhd es einmal gewagt, sie auf der Straße mit Soraya anzureden. Damals wusste sie, dies ist der Moment, in dem sich alles entscheidet. Sie hat sich mit ihm geprügelt, und obwohl er kräftiger ist als sie, hat sie sich so heftig gegen ihn gewehrt, dass er schließlich aufgeben musste. Seitdem hat keiner der Jungen mehr versucht, ihre Existenz als Samir in Frage zu stellen.
Dawuhd springt auf. Sein Gesicht ist rot angelaufen und vor Wut verzerrt, er sieht aus, als wollte er sich im nächsten Moment auf Soraya stürzen, um ihr den Stoß heimzuzahlen. Doch bevor er dazu kommt, tritt ein anderer Junge zwischen sie. Er ist hager und groß, einen halben Kopf größer als die anderen.
»Nicht hier«, sagt er und legt Dawuhd die Hand auf die Schulter. »Lass uns die Sache mit den Drachen regeln. Ich fordere dich heraus. Im Namen von Samir.«
Soraya atmet auf. Das ist Hafiz, der Sohn des Malik, des Dorfvorstehers. Sein Vater ist dafür zuständig, Streit zwischen den Bewohnern zu schlichten, und er ist sehr geschickt darin. Wahrscheinlich wird Hafiz später selbst mal Dorfvorsteher, der Titel vererbt sich meistens und geeignet ist er auf jeden Fall. So wie sein Vater den Streit zwischen den Männern schlichtet, vermittelt Hafiz unter den Jungen. Soraya verdankt ihm viel, das weiß sie gut. Er hat sich oft vor sie gestellt, und zwar immer so, dass sie dabei nicht schwach wirkte. Ohne ihn wäre ihr Leben unter den Jungen um einiges härter, so viel steht fest.
Dawuhd schluckt seinen Ärger mühsam hinunter. Er funkelt Soraya noch einmal an, aber eine Herausforderung zum Drachenkampf darf er nicht ablehnen, er würde sein Gesicht verlieren.
»Wir treffen uns am Bach«, sagt er zu Hafiz, ohne Soraya aus den Augen zu lassen. »Hol deinen Drachen.«
Hafiz nickt, dann dreht er sich zu Soraya um. »Kommst du mit, Samir?«, fragt er.
»Ja«, antwortet Soraya. »Später. Ich komme nach.« Sie blickt Dawuhd an. »Wenn ich mit dem Spionieren fertig bin.«
Dawuhd schiebt Hafiz zur Seite und tritt zu ihr. »Glaub nicht, dass die Sache mit dem Drachenkampf erledigt ist«, sagt er. »Das machen wir noch unter uns aus. Nur wir beide.«
Er geht an ihr vorbei, wobei er sie mit der Schulter anrempelt. Hafiz sieht ihm nach. »Du wirst noch viel Freude mit ihm haben«, sagt er zu Soraya. »Aber die Freude wird wehtun.«
Er verschwindet ebenfalls, um sich auf den Drachenkampf vorzubereiten. Die anderen Jungen schließen sich den beiden an, die eine Hälfte Hafiz, die andere Hälfte Dawuhd.
Soraya blickt ihnen nach. Sie reibt sich über die Haare, dann atmet sie erleichtert durch. Die Sache ist noch mal glimpflich abgelaufen, vor allem dank Hafiz. Es ist ein Segen, dass er sich eingemischt hat, sonst könnte sie den Weg in die Berge jetzt vergessen. Trotzdem, irgendwann wird sie es mit Dawuhd ausmachen müssen, es lässt sich nicht vermeiden. Wahrscheinlich wird er sie übel zurichten, aber sie nimmt sich vor, ihre Haut so teuer wie möglich zu verkaufen.
Die Jungen sind inzwischen verschwunden. Soraya dreht sich um und setzt ihren Weg fort. Aus manchen Häusern dringt schon der Duft des frischen Fladenbrotes und der würzige Geruch gebratenen Fleisches, das die Frauen für das Mittagessen zubereiten. Als Soraya an die saftigen Hammelfleischbrocken denkt, die knusprigen Hähnchenflügel und die scharfen Lammfleischspieße mit Zwiebeln und Paprika, läuft ihr das Wasser im Mund zusammen. Aber sie darf jetzt nicht vom Essen träumen, nach der Begegnung mit den Jungen ist sie spät dran. Wenn ihr Vater und ihr Großvater zur Mittagspause vom Feld kommen, muss sie zu Hause sein, und der Weg in die Berge ist steil.
Sie kommt an der Moschee vorbei. Im Schatten der Platanen, die vor dem Eingang stehen, unter ihren weit ausladenden Ästen, sitzen der Mullah und die alten Männer des Dorfes und trinken Tee. Der Mullah ist für jeden hier ein wichtiger Mann, aber für Soraya war er vom ersten Tag ihres Lebens an besonders wichtig. Ihre Mutter hatte vor ihr bereits sechs Töchter bekommen und war das Gespött des Dorfes, weil sie es nicht schaffte, einen Sohn zur Welt zu bringen. Ihr Vater wurde bemitleidet wegen der Unfähigkeit seiner Frau. Soraya hat immer versucht, sich vorzustellen, wie groß die Hoffnung ihrer Eltern damals gewesen sein muss und wie tief die Enttäuschung, als wieder nur ein Mädchen zum Vorschein kam – nämlich sie. Sie war die siebte Tochter und der Mullah tat, worum ihre Eltern ihn baten: Er griff auf einen alten Brauch im paschtunischen Stammesrecht zurück und erklärte Soraya kurzerhand zum Jungen. Drei Tage nach der Geburt erhielt sie den Namen Samir und wurde feierlich durchs Dorf getragen. Alle wussten, dass sie in Wahrheit ein Mädchen ist, aber um die Schande der Familie zu beenden, spielten alle das Spiel mit und gratulierten zur Geburt des Sohnes.
Soraya bleibt kurz stehen, wendet sich der Moschee und dem Mullah zu und verneigt sich. Der Mullah hebt würdevoll die Hand und nickt. Die Männer, die neben ihm sitzen und ihren Tee trinken, mit ihren weißen Vollbärten, die wie Kränze um ihre Gesichter stehen, winken ebenfalls, grinsen unter ihren langen Hakennasen, rufen ihr etwas zu, das sie nicht versteht, und als sie weitergeht, lachen sie aus ihren Mündern mit den wenigen Zähnen, die ihnen noch geblieben sind, hinter ihr her. Sie beschleunigt ihre Schritte, die alten Männer sind ihr unheimlich. Sie weiß nie, was sie von ihnen halten soll. Freuen sie sich wirklich, sie zu sehen, oder machen sie sich nur über sie lustig?
Die staubige Dorfstraße beginnt jetzt anzusteigen. Soraya ist froh darüber, denn nun kann ihr kaum noch jemand begegnen, um sie aufzuhalten. Ein paar Häuser lässt sie noch hinter sich, dann hat sie den Rand des Dorfes erreicht. Das letzte Gebäude, an dem sie vorbeikommt, bevor die Straße endgültig zu dem Pfad wird, der sich in die Berge schlängelt, ist die Schule. Sie kann sich dunkel daran erinnern, wie sie gebaut wurde, es war vor einigen Jahren. Alle Männer des Dorfes haben geholfen, auch ihr Vater und ihr Großvater, sie schlugen Steine in den Bergen und schleppten sie heran, fuhren mit ihren Eselskarren zur nächsten Hauptstraße, um Ziegel und Holz und Zement zu holen und die anderen Dinge, die von den Lastwagen gebracht wurden, hoben eine tiefe Grube aus, gossen das Fundament und errichteten die Mauern, bis die Schule mit einem großen Fest eingeweiht wurde.
Bis dahin hatte nur der Mullah Unterricht in der Moschee gegeben, aber seitdem haben sie einen richtigen Lehrer, der jeden Tag aus der Stadt ins Dorf kommt, außer im Winter, da ist es zu kalt und die Schule hat keine Heizung. Doch jetzt, wo der Winter vorüber ist, wird sie in einigen Tagen wieder beginnen. Soraya freut sich darauf, sie geht gerne zur Schule, es ist wie der Eintritt in die geheimnisvolle Welt außerhalb des Dorfes, von der sie nie etwas gesehen hat. Ihre Neugierde ist groß, manchmal kann nicht einmal der Lehrer all ihre Fragen beantworten. Am liebsten mag sie das Rechnen. Da hat alles seinen festen Platz, alles ist sicher und verändert sich nicht und das hat etwas Beruhigendes. Sie liebt die Welt der Zahlen.
Sie darf vormittags zur Schule gehen, wenn die Jungen Unterricht haben. Der Unterricht für die Mädchen am Nachmittag fällt oft aus, viele Mädchen gehen nicht hin, weil ihre Eltern es für überflüssig halten oder die Rache der Taliban fürchten. Die Taliban haben verboten, dass Mädchen zur Schule gehen, und wenn sie es trotzdem tun, werden sie von ihnen zur Strafe verprügelt. Angeblich haben sie in einem Dorf in der Nähe einem Mädchen, das sich allen Verboten widersetzt hat, Säure ins Gesicht geschüttet und sie für ihr ganzes Leben verunstaltet, sodass sie nie einen Mann finden wird.
Soraya schüttelt sich, als sie daran denkt. Sie hat die Schule hinter sich gelassen und steigt nun den Pfad in die Berge hinauf. Solche Gedanken machen ihr Angst. Ihre Zeit als Junge geht in diesem Jahr endgültig zu Ende, das hat ihr Vater entschieden. Sie können nicht länger damit warten, hat er gesagt, eigentlich hätte sie das Alter der Rückverwandlung längst überschritten. Was soll dann werden? Keine Schule mehr, keine Spiele mit den Jungen! Wenn sie daran denkt, wird sie oft so entsetzlich traurig. Nicht einmal der Frühling kann ihre Trauer besänftigen und das will etwas heißen. Sie liebt es so sehr, nach draußen zu gehen und unter freiem Himmel zu sein, wann immer es ihr gefällt. Jetzt ist diese Zeit bald vorbei und sie wird auch nie wiederkommen. Nie mehr wird sie im Bach nach Münzen tauchen oder mit den Schafsknochen spielen, nie wieder einen Drachen in der Luft tanzen sehen. Sie wird nur noch in der Stille des Hauses sein, so wie ihre Schwestern, und irgendwann … Sie stöhnt. Immer wenn sie sich das vorstellt, ist ihr Herz danach so schwer wie ein Stein am Grund des Flusses.
Sie beginnt zu rennen, den Pfad hinauf, als könnte sie auf diese Weise den düsteren Gedanken entkommen. Sie rennt immer weiter, bis sie irgendwann erschöpft stehen bleibt und, die Hände auf die Knie gestützt, nach Luft ringt. Nach einer Weile richtet sie sich auf, dreht sich um und blickt ins Dorf hinunter. Da sind die Häuser, drüben der Bach, daneben eine Wiese und auf der Wiese kann sie die Jungen sehen. Sie wirken klein von hier oben, wie Insekten, aber sie kann sie trotzdem voneinander unterscheiden, an ihrem Gang und ihren Bewegungen. Auf der einen Seite ist Dawuhd, bullig wie ein Käfer, immer ein wenig angespannt und verkrampft, auf der anderen Seite Hafiz, schlank wie ein Grashüpfer, locker und leichtfüßig, dazwischen die anderen.
Dawuhd und Hafiz haben ihre Drachen geholt, sie haben die besten Drachen aller Jungen im Dorf, leicht und trotzdem stabil, sodass sie die unglaublichsten Flugmanöver ausführen können. Hafiz hat seinen Drachen aus bunten Papierfetzen zusammengenäht, sodass er leuchtet wie ein Regenbogen, und er sieht jeden Tag anders aus, je nachdem, wie die Sonne auf ihn trifft. Dawuhds Drachen dagegen ist schwarz, sowohl das Papier als auch der Rahmen, sogar die Schnur, mit der er ihn lenkt, ist schwarz, wie die Turbane der Taliban. Beide laufen jetzt los, um ihre Drachen in die Luft zu bringen, Hafiz mit weiten Sprüngen, Dawuhd mit schnellen Schritten wie ein Maschinengewehr.
Soraya springt nach vorn an den Rand des Abhangs, von wo sie den Kampf am besten beobachten kann, und legt ihre Hände wie einen Trichter an den Mund. »Los, Hafiz!«, brüllt sie ins Tal hinunter. »Zeig es ihm!«
Natürlich hört sie niemand. Die Anfeuerungsrufe der anderen Jungen dringen schwach zu ihr herauf, aber umgekehrt funktioniert es nicht. Sie lässt die Hände sinken und beobachtet schweigend den langsamen Aufstieg der beiden Drachen. Anfangs halten Hafiz und Dawuhd noch Abstand voneinander, aber kaum haben sie den Himmel erobert, bewegen sie sich langsam aufeinander zu. Zur Vorbereitung des Kampfes haben sie die Schnüre ihrer Drachen in Klebstoff getaucht und dann durch kleine Glassplitter gezogen, sodass sie jetzt mit scharfen Scherben bestückt sind. Jeder von ihnen versucht nun, die Schnur des anderen mit seiner eigenen zu durchschneiden.
Sie liefern sich ein zähes Ringen. Ihre Drachen sind etwa auf gleicher Höhe mit Soraya, sie kann den Kampf gut beobachten, besser als die Jungen unten am Bach. Der Wind zeigt sich gnädig, er ist weder zu stark noch zu schwach und bläst gleichmäßig, sodass er nicht durch eine plötzliche Laune die Entscheidung bringen kann. Zunächst umtanzen die beiden Drachen sich noch, vollführen Drohgebärden, weichen heuchlerisch voreinander zurück, um gleich darauf wieder zum Angriff überzugehen, dann verkeilen sie sich ineinander, umwickeln sich, scheinen sich verschlingen zu wollen und plötzlich – ein lauter Knall. Eine der Schnüre zerreißt. Soraya hält den Atem an. Es ist der bunte Drachen, der ins Trudeln gerät und zu Boden stürzt. Nur der schwarze steht noch am Himmel und flattert im Wind, als würde er lachen. Dawuhd hat den Kampf gewonnen.
Während seine Anhänger am Ufer des Baches einen Freudentanz aufführen, wendet Soraya sich seufzend ab. Der Ausgang des Kampfes wird es ihr nicht gerade leichter machen, so viel ist klar. Jetzt wird Dawuhd noch selbstherrlicher und überheblicher auftreten, als er es sowieso schon tut, und sie wird darunter zu leiden haben. Sie steigt den Pfad weiter hinauf und versucht den Gedanken zu vergessen. Die Stelle, von der aus sie in die Ebene blicken kann, ist jetzt nicht mehr weit, sie kann sie schon sehen. Mit jedem Schritt, den sie darauf zugeht, wird ihre Anspannung größer. Und die Vorfreude. Heute muss sie da sein, die Staubwolke, die das Kommen der Kuchi ankündigt.
Sie denkt an die letzten Jahre zurück. Immer wenn Tareks Familie mit ihrer Herde auf dem Weg ins Sommerlager hier vorbeikommt, rasten sie einige Tage, um ihre Schafe zu weiden und mit den Dorfbewohnern Handel zu treiben. Sie brauchen Getreide und Obst und Gemüse und im Gegenzug kaufen die Leute aus dem Dorf bei ihnen Fleisch und Käse und Joghurt und Felle. Sie und Tarek haben dann immer Zeit, zusammen durch die Gegend zu streifen. Er weiß viel über die Tiere und die Natur und das Wetter und diese Dinge und sie muss ihm immer erzählen, wie es ist, in einem Dorf zu wohnen, sein ganzes Leben am selben Ort zu verbringen, das kann er sich gar nicht vorstellen.
Zugegeben, Tarek ist in manchen Dingen seltsam, aber wahrscheinlich mag sie ihn gerade deswegen so. Er redet nicht viel, manchmal kriegt er seine Zähne überhaupt nicht auseinander, aber das ändert sich, wenn er eine seiner Geschichten erzählt. Darin ist er großartig, sie liebt es, ihm zuzuhören. Im letzten Jahr war sie zum ersten Mal bei seiner Familie in ihrem Lager eingeladen und am Tag danach ist Tarek zu ihnen gekommen. Beides war ziemlich anstrengend. Obwohl die Kuchi und die Leute aus den Dörfern ihre Waren tauschen, mögen sie sich nicht besonders. Sorayas Vater sagt, viele Kuchi wären Diebe. Sie würden ihre Tiere das Wasser trinken und das Gras fressen lassen, ohne zu bezahlen, und manchmal würden sie das Getreide von den Feldern stehlen. Tarek hat erzählt, dass sein Vater genauso auf die Bauern schimpft. Sie wären hochnäsig und würden sich für etwas Besseres halten, weil sie Häuser haben, und manchmal würden sie des Nachts kommen und die Schafe rauben. Soraya zuckt mit den Achseln. Sie hat keine Ahnung, ob etwas davon stimmt.
Endlich erreicht sie die Kuppe, von der sie in die Ebene schauen kann. Die letzten Schritte läuft sie, und als sie oben ist, wippt sie nervös von einem Fuß auf den anderen, schirmt ihre Augen gegen die Sonne ab und späht hinunter. Dann lässt sie die Schultern sinken. Nichts! Nichts ist zu sehen von den Herden und den Nomaden. Und das, obwohl sie längst hier sein müssten, in den letzten Jahren waren sie immer schon da, wenn die Obstbäume ihre ersten Knospen bekamen.
Enttäuscht lässt sie sich auf einen Stein sinken. Was ist nur los? Sie hat Tarek nie erzählt, dass sie in Wahrheit Soraya ist, er kennt sie nur als Samir. Ob er es gemerkt oder gespürt hat? Im letzten Jahr vielleicht. In diesem Frühling wollte sie es ihm erzählen, sie wollte ihm alles erzählen, das hat sie sich fest vorgenommen, deshalb erwartet sie ihn auch aufgeregter und sehnsüchtiger als je zuvor.
Denn eines steht fest: So sehr sie ihr Dasein als Samir liebt, mit all der Freiheit und den Vorteilen, die es mit sich bringt, so sehr sie den Moment fürchtet, in dem dieses Leben zu Ende sein wird – immer wenn der Frühling kommt und sie auf Tarek wartet, will sie kein Junge mehr sein.
Er kennt die Spuren der Schafe genau, es ist nichts Geheimnisvolles an ihnen. Von klein auf hat er gelernt, sie zu lesen. Sie sind wie eine Schrift für ihn, wie Buchstaben, die sich zu Wörtern und Sätzen und schließlich zu einer Erzählung zusammenfügen. Die Zeichen in den Büchern sind ihm fremd, die versteht er nicht, aber die Zeichen der Schafe kannte er schon als kleiner Junge. Nichts von dem, was sie hinterlassen, entgeht ihm, nicht der winzigste Teil ihrer Ausscheidungen, nicht der kleinste Kratzer auf einem Stein, den sie betreten haben, nicht die dünnste Wollfaser, die sich in einem dornigen Gestrüpp verfangen hat. Das sind die Buchstaben seiner Welt. Er setzt sie zu Bildern zusammen, die Bilder beginnen sich zu bewegen und dann steht ihm klar vor Augen, wie die Schafe hier entlanggezogen sind, in ihrem schwerfälligen Trott, die zwei, die er sucht, das Muttertier und sein Junges.
Tarek bleibt stehen und sieht sich um. Die Spuren der beiden sind vielleicht zwei Stunden alt. Er ist ihnen näher gekommen, doch wenn er Pech hat, muss er noch lange nach ihnen suchen. Wie dumm sie sind!, denkt er. Sich von der Herde zu entfernen und hinauf in die Hügel zu steigen, wo die Wölfe auf sie warten, um ihnen an die Kehle zu springen, oder die Adler, um mit ihren scharfen Krallen das Jungtier zu reißen. Die Ziegen nicht! Die Ziegen sind klug. Aber die Schafe sind so dumm, dass man es oft gar nicht begreifen kann.
»Kannst du mir sagen, wohin sie wollen, Dschamal?«, fragt er und blickt den Hund an, der sich vor Stunden mit ihm auf den Weg gemacht hat und jetzt wartend neben ihm steht.
»Und weißt du, was ich mich vor allem frage? Warum müssen sie immer weiterlaufen, selbst wenn sie sich längst verirrt haben? Warum können sie nicht einfach stehen bleiben und darauf warten, dass wir sie finden? Warum müssen sie uns das Leben so schwer machen?«
Dschamal hebt kurz den Kopf, dann läuft er weiter. Er ist ein typischer Hirtenhund aus den Bergen, schon von Weitem zu erkennen mit seinem weißen Fell, schlank und zäh und mit einem so lauten und rauen Bellen, dass jedes Schaf ihn über Kilometer zu hören vermag.
Tarek seufzt. »Ja, du hast recht«, sagt er. »Sie sind, wie sie sind, daran können wir nichts ändern. Wir müssen sie finden. Und zwar, bevor es dunkel wird.«
Er prüft kurz den Himmel, dann zieht er die Schlaufe des Gewehres, das er über der Schulter trägt, fester an und folgt dem Hund. Dschamal ist schlau. Auch er sieht die Spuren der Schafe und mit seiner empfindlichen Nase erschnüffelt er Dinge, die sogar Tarek verborgen bleiben. Sie sind fast wie Brüder, jeder von ihnen weiß, was der andere denkt und fühlt, immer und überall. Schon seit vielen Jahren sind sie unzertrennlich. Von klein auf war Tarek dafür verantwortlich, die verirrten Schafe zur Herde zurückzubringen. Als er damit begonnen hat, hat sein Vater ihm Dschamal geschenkt, denn das Suchen der Schafe ist ein einsames und gefährliches Geschäft. Von Anfang an hat sein Vater darauf bestanden, dass er nie ohne Dschamal loszieht. Hätte er es dennoch getan, wäre seine Bestrafung schmerzhaft gewesen, egal ob er mit den Schafen zurückgekehrt wäre oder nicht. Aber das war nie notwendig. Er ist kein einziges Mal auf den Gedanken gekommen, Dschamal im Lager zurückzulassen.
Tarek atmet tief die kühle, frische Luft ein, die von den Bergen herabweht. Zum Glück ist der Winter vorbei. Er war kalt in diesem Jahr, so kalt, dass die Wölfe nicht genug zu fressen fanden und sich hinunter in die Ebene wagten. Jede Nacht mussten Tarek und sein Vater und sein Bruder und die Hirten die Herde mit ihren Gewehren bewachen. Doch jetzt, mit Beginn des Frühlings, ziehen sich die Wölfe mit jedem Tag weiter in die Berge zurück. Jetzt beginnt die schönste Zeit des Jahres, die Zeit der Lämmer und der Frühjahrsschur und der Wanderung in die Sommerquartiere. Dann treiben sie Handel mit den Bauern in den Dörfern. Dann trifft er Samir.
Tarek wird auf Dschamal aufmerksam. Der Hund ist unruhig. Aber es geht nicht um Wölfe, dann würde er ihn anders warnen. Er hat die Schafe gewittert.
»Bleib hier, Dschamal«, sagt Tarek mit einem warnenden Ton in der Stimme. »Schön hierbleiben.«
Vorsichtig geht er weiter. Sie folgen einem schmalen Pfad, auf beiden Seiten liegen Felsbrocken, es sieht aus, als hätten Riesen eine Handvoll gewaltiger Saatkörner verstreut. Plötzlich tauchen vor ihnen zwei helle Flecken auf. Da sind sie! Dschamal will loslaufen, um die Ausreißer mit wütendem Gebell für den Ärger, den sie ihnen bereitet haben, zu bestrafen. Aber Tarek hält ihn zurück. Er stößt einen lauten Pfiff aus, woraufhin der Hund erstarrt und sich nicht mehr von der Stelle rührt.
»Nicht so schnell, mein Junge. Nicht so schnell. Hier stimmt etwas nicht.«
Er hebt das Fernglas, das er um den Hals trägt, an die Augen und stellt es scharf. Da ist das Jungtier. Es scheint unverletzt zu sein, aber es geht ihm nicht gut, das sieht er sofort. Direkt daneben ist die Mutter. Tarek lässt das Fernglas sinken und stößt einen Fluch aus: Das Tier ist tot. Doch es waren keine Wölfe, es war etwas Schlimmeres. Jetzt erinnert er sich daran, dass er weiter unten, vor einiger Zeit, einen dumpfen Knall gehört hat. Ein ferner Donnerschlag, hat er da noch gedacht.
Er stößt einen weiteren Pfiff aus, nicht so schrill wie der erste, sondern tiefer. Gleich darauf ist Dschamal bei ihm und drängt sich an ihn.
»Bleib eng bei mir«, sagt Tarek. »Ganz eng, wenn dir dein Leben lieb ist.«
Ohne sich zu rühren, sucht er den Boden ab. Er spürt, wie ihm kalter Schweiß auf die Stirn tritt. Wo eine Mine ist, sind meistens noch mehrere. Und immer sind sie mit der größten Heimtücke vergraben, dort wo man sie nicht erwartet.
»Wir müssen von dem Pfad runter«, sagt er zu Dschamal. »Aber vorsichtig!«
Er heftet den Blick auf den Boden. Sein Vater hat ihm erklärt, woran man die Stellen erkennt, an denen Minen vergraben sind, die verräterischen Spuren, die kleinen Hinweise, die man nicht übersehen darf. Aber manche von ihnen sind vor so langer Zeit gelegt worden, dass die Spuren verschwunden sind, und dennoch sind sie noch scharf und können bei der geringsten Berührung hochgehen. Dem Hirten einer anderen Familie, die sie gut kennen, ist das im letzten Jahr passiert. Er wurde schwer verletzt, hat ein Bein verloren und hatte Glück, dass er gefunden wurde, bevor er verblutete.
Tarek nimmt sein Gewehr von der Schulter. Er braucht es, um die Stellen, an die er seinen Fuß setzen will, vorher mit der Spitze des Laufes zu untersuchen. Dann geht er weiter. Dschamal weicht ihm nicht von der Seite. Der Hund zittert, er weiß genau, worum es geht. Doch bei den Minen kann er nicht helfen, er wittert sie nicht. Bei den Minen ist Tarek auf sich gestellt.
In einem großen Bogen nähert er sich den Schafen. Der Weg ist nicht weit, aber er braucht bestimmt eine halbe Stunde dafür. Als er sie erreicht, ist er von oben bis unten nass geschwitzt. Das Muttertier bietet einen elenden Anblick. Immerhin hat es nicht leiden müssen, die Mine ist direkt unter ihm explodiert. Seine Gedärme quellen heraus, die Fliegen haben sich schon darauf niedergelassen. In gewisser Weise ist Tarek erleichtert, dass das Tier tot ist. So muss er es nicht selbst töten, das hasst er. Obwohl er einige Male beim Schlachten geholfen hat, geht es ihm nicht so leicht von der Hand wie den Älteren.
Das Lamm ist verängstigt, es hockt neben seiner Mutter und blökt jämmerlich. Es hat einige Blutspritzer abbekommen, aber verletzt ist es nicht.
Tarek schultert sein Gewehr, dann beugt er sich zu dem Lamm hinunter und hebt es vorsichtig hoch. »Na komm«, sagt er. »Wir bringen dich zur Herde. Da suchen wir eine neue Mutter für dich.«
Als er das Tier in seinen Nacken legt, sodass er es vorne an den Läufen festhalten kann, blökt es so laut, dass es ihm in den Ohren schmerzt. Anscheinend will es nicht von seiner Mutter getrennt werden.
»Warum wart ihr auch so dumm?«, sagt Tarek und wendet sich von dem blutigen Kadaver ab. »Warum musstet ihr weglaufen? Ihr seid selbst schuld. Du hast kein Recht, dich zu beklagen. Hoffentlich war es dir eine Lehre.«
Das Lamm hört auf zu blöken, dafür zittert es jetzt am ganzen Körper. Tarek hält es fest, dann wandert er mit den Augen den Weg entlang, den sie gekommen sind.
»Los, Dschamal«, sagt er. »Wir gehen in unseren eigenen Spuren zurück. Und du bleibst immer bei mir. Keine Angst, der Simurgh wird uns helfen.«
Dschamal schmiegt sich wieder an ihn, sie machen sich auf den Rückweg. Tarek entspannt sich langsam. Die Stellen, die er mit dem Lauf seines Gewehres auf Minen untersucht hat, sind noch gut zu erkennen und er hat einen sicheren Tritt. Wenn sie keinen Fehler machen, kann ihnen nicht viel passieren. Außerdem wird er immer ruhig, wenn er an den Simurgh denkt. Die wandernden Geschichtenerzähler, die die Kuchi in ihren Lagern besuchen und abends am Feuer die Lieder der Berge singen, haben ihn mit der Legende vertraut gemacht. Einer von ihnen, ein alter Mann, der inzwischen gestorben ist, hat ihm die Geschichte, als er klein war, zum ersten Mal erzählt. Er hat sie nie vergessen.
Der Simurgh ist ein Zaubervogel. Sein Nest liegt auf dem Berg Kaf, der so weit entfernt und so schwer zu erreichen ist, dass kein Mensch ihn jemals gesehen hat. Doch wenn jemand in Not ist, hat der Alte erzählt, und der Hilfe des Simurgh würdig, dann stößt er von dort herab. Er ist wie ein großer Adler, aber er trägt Pfauenfedern am Schwanz, die aussehen wie ein Regenbogen. Seine Flügel sind so weit gespannt wie die Wolken, er hat mächtige Krallen und unter allen Tieren die schärfsten Augen. Mit ihnen kann er von seinem Nest auf dem Berggipfel die ganze Welt sehen. Seine Federn haben Zauberkräfte und können die schlimmsten Wunden heilen.
Während er an die Geschichte des Alten zurückdenkt, hat Tarek mit Dschamal und dem Lamm wieder den Pfad erreicht. Jetzt müssen sie nur noch ins Lager zurück. Das wird einige Zeit dauern, aber der Weg ist nicht länger gefährlich. Tarek lässt Dschamal laufen und steigt, das Lamm noch immer im Nacken tragend, hinter ihm den Hügel hinunter.
Die Geschichte vom Simurgh hat ihn nicht nur fasziniert, er glaubt auch daran. Als er noch jünger war und erst seit kurzer Zeit die verirrten Schafe suchte, hatte er sich einmal mit Dschamal im Gebirge verirrt. Er fand nicht mehr zurück und auch Dschamal hatte die Orientierung verloren. Sie verbrachten eine Nacht in der Kälte, eng aneinandergedrückt in einer Höhle. Am nächsten Tag waren sie hungrig und entkräftet und fast erfroren, auch ihr Wasser war aufgebraucht. In seiner Verzweiflung erinnerte Tarek sich an die Geschichte des Alten und rief den Simurgh um Hilfe an. Einige Stunden später sah er einen Adler am Himmel. Er folgte ihm, durch ein Tal, über einen Höhenzug, durch ein weiteres Tal, und irgendwie fanden Dschamal und er zu der Herde und zum Lager zurück.
Seit diesem Tag ist er überzeugt davon, dass es den Zaubervogel wirklich gibt. Und er hat keinen Zweifel daran, dass er sein Schutzengel ist und ihm beisteht, wenn er in Gefahr gerät. Manche machen sich lustig darüber, sein älterer Bruder Ashkan zum Beispiel ärgert ihn gerne damit. Wenn ein Sturm aufzieht oder im Winter das ferne Heulen der Wölfe zu hören ist, richtet Ashkan die Hände zum Himmel und ruft mit klagender Stimme nach dem Simurgh. Alle lachen und eigentlich lachen sie damit über ihn, Tarek. Aber das stört ihn nicht weiter, er wendet sich dann ab und schüttelt nur mitleidig den Kopf.
Dschamal und er haben inzwischen das Tal erreicht, das sie zum Lager zurückführt, jetzt ist es nicht mehr weit. Tarek blinzelt zum Himmel. Irgendwo da oben, über den Wolken, fliegt der Simurgh jetzt und beobachtet ihn und Dschamal. Mit seinen scharfen Augen erspäht er jedes verirrte Schaf und führt sie dorthin, er sieht auch jeden Wolf und jede Mine und bewahrt sie davor, von ihnen getötet zu werden. Es spielt keine Rolle, was andere davon halten, denkt Tarek. Wichtig ist nur, dass Dschamal und ich es wissen.
Er geht am Ufer des Flusses entlang, der das Tal geschaffen hat. Jetzt, in der Zeit der Schneeschmelze und des Regens, fließt er breit und kraftvoll dahin und führt all das Wasser mit sich, das die Wiesen ergrünen lässt und den Schafen Nahrung gibt. Nach einiger Zeit wird das Tal flacher und vereinigt sich mit einem weiteren. Nun sind es gleich zwei Flüsse, die, wenige Hundert Meter voneinander entfernt, hinaus in die Ebene fließen und genau zwischen ihnen, auf einer kleinen Anhöhe, taucht jetzt das Lager auf.
Tarek bleibt kurz stehen. Er liebt diesen Ort, den sie immer im Frühling, zwischen dem Verlassen des Winterquartiers und dem Aufbruch in die Berge, für einige Wochen beziehen. Es gibt genug Wasser hier, auf beiden Seiten des Lagers strömt es vorbei, und saftiges Gras für die Tiere. Es ist weder so kalt wie im Winter noch so heiß wie im Sommer und es ist schön, sich um die Lämmer zu kümmern. Sie sind noch so klein, dass man ihnen helfen muss, unter dem Winterfell der Muttertiere die Milch zu finden. Nie wieder werden sie etwas so Unschuldiges an sich haben wie jetzt. Das sorgt für eine eigenartige Stimmung im Lager, sie unterscheidet sich von jeder anderen Zeit des Jahres.
Tarek ruft Dschamal zu sich. »Ja, wir sind zurück«, sagt er, beugt sich zu ihm hinunter und klopft ihm mit zwei kräftigen Schlägen aufs Fell. »Ich danke dir, mein Junge.«
Das hat er sich angewöhnt. Er dankt Dschamal immer, wenn sie von einem ihrer Streifzüge zurückkehren und ihnen trotz aller Gefahren, die dort draußen lauern, nichts geschehen ist. Er findet, er ist es ihm schuldig, denn der Hund vertraut ihm jeden Tag aufs Neue sein Leben an, und das ist nichts, was man einfach so hinnehmen darf.
Als er weitergeht, kann er das Lager mit jedem Schritt deutlicher erkennen. Da ist das große, dunkelbraune Zelt, in dem sie leben, straff gespannt an vielen Pflöcken, die tief in den Boden ragen. Es sieht aus, als wäre es vom Himmel gefallen und zufällig gerade hier zwischen den Flüssen gelandet. Die Eingangsplane ist zurückgeschlagen, unter dem Blechgeschirr, das vom First baumelt, sieht er seine Mutter und seine ältere Schwester Setareh das Brot backen. Seine beiden jüngeren Schwestern, Sharifa und Nesrin, sitzen weiter hinten. Er kann sie kaum erkennen, aber er weiß, dass sie, wie immer um diese Zeit, die Decken und Kleider ausbessern, die im Winter gelitten haben.
Neben dem Zelt sind die Kamele angebunden. Tarek mag sie nicht besonders, sie sind störrisch und hochmütig und beißen mit ihren hervorstehenden gelben Zähnen nach allem, was sich bewegt. Dschamal mag sie noch weniger. Er hat einmal einen Fußtritt von einem Kamel abbekommen, nach dem er zwei Tage lang nicht mehr laufen konnte, seitdem hält er sich von ihnen fern. Aber sie brauchen die Tiere, auf ihren Wanderungen müssen die Kamele alles schleppen, was sie besitzen. Dann sind sie so schwer beladen, dass man sie unter all den Sachen kaum noch erkennen kann. Es sind acht, für jeden aus der Familie eines.
Tarek dreht den Kopf. Ein Stück vom Zelt entfernt grast die Herde, dorthin muss er mit dem Lamm, das er geholt hat. Noch sind die Lämmer mit den Müttern zusammen. Erst im Sommer werden sie getrennt, damit sie aufhören, Milch zu trinken, und lernen, Gras zu fressen. Einige dunklere Punkte heben sich von den Schafen ab, das sind die Ziegen. Sie bringen zwar nicht viel ein, denn sie haben keine schöne Wolle und ihre Milch schmeckt auch nicht jedem. Aber sie brauchen sie als Leittiere, vor allem auf den Wanderungen. Tarek muss dann nur seinen Stock vorauswerfen. Die Ziegen sehen es und laufen los und die dummen, blökenden Schafe trotten hinterher.
Am Flussufer sind die Männer damit beschäftigt, die Schafe zu scheren. Tarek erkennt seinen Vater und seinen Bruder Ashkan. Auch der Tschopan ist da, ihr Leithirte, und aus den benachbarten Tälern sind einige Männer gekommen, um bei der Arbeit zu helfen. Sein kleiner Bruder Mirza steht ebenfalls da. Er ist noch zu jung, um beim Scheren zu helfen. Aber er soll zusehen, damit er es lernt.
»Hey, Dschamal«, ruft Tarek. »Ab zur Herde mit dir. Mach dich nützlich.«
Dschamal stößt ein heiseres Bellen aus, dann läuft er los. Erdklumpen und Grasfetzen spritzen hinter ihm auf, als er auf die Herde zujagt. Schon auf dem Weg dorthin nimmt er sich eine Gruppe von Schafen vor, die sich ein Stück von den anderen entfernt haben. Sie zu erschrecken und zusammenzutreiben ist seine Lieblingsbeschäftigung. Manchmal, wenn sie ihm nicht sofort gehorchen, beißt er einem der Tiere spielerisch ins Bein. Aber er verletzt sie nicht. Er weiß genau, wie weit er gehen darf.
Tarek folgt ihm langsam. Die Sonne steht inzwischen tief, der Horizont auf der anderen Seite des Lagers färbt sich rot. Solange er zurückdenken kann, ist dieses Zelt, sind diese Tiere, ist dieser Himmel seine Heimat. Er ist daran gewöhnt. Er kennt nichts anderes als das Umherwandern von Ort zu Ort, das Leben im Rhythmus der Jahreszeiten, das Einschlafen unter dem weiten Himmel. Wenn sie an einem Dorf vorbeikommen, bedauert er die Menschen, die dort wohnen. Er kann sich nicht vorstellen, sein ganzes Leben lang am gleichen Ort zu sein, gefesselt an ein Dorf, eingesperrt zwischen den Steinen eines Hauses. Es würde ihn krank machen, davon ist er überzeugt.
Inzwischen sind die Männer am Flussufer auf Dschamal aufmerksam geworden. Tarek beobachtet, wie sein Vater den Kopf hebt. Als er ihn sieht, wie er mit dem Lamm auf den Schultern auf die Herde zugeht, steht er auf und streicht sich die Wolle von der ledernen Hose, die er trägt. Dann sagt er etwas zu den anderen und kommt ihm entgegen.
Als sie sich treffen, muss Tarek nicht erzählen, was geschehen ist. Sein Vater blickt ihm in die Augen und betrachtet das Lamm, dann schüttelt er den Kopf.
»Das dritte Tier innerhalb von zehn Tagen«, murmelt er.
»Ja, ich weiß«, antwortet Tarek. »Ich konnte es nicht mehr retten. Wir waren zu spät.«
Er und Dschamal haben viele Schafe zurückgebracht in letzter Zeit, aber bei den dreien, von denen sein Vater spricht, ist es ihnen nicht gelungen. Eines der beiden anderen ist ebenfalls einer Mine zum Opfer gefallen, das dritte einem offenbar einzelgängerischen Wolf, einem störrischen Nachzügler, der die Ebene noch nicht räumen wollte.
Jedes tote Schaf ist ein schwerer Verlust für sie. Tarek sieht seinen Vater nachdenklich an. Vor allem für ihn, denn er ist für die Tiere und die Familie verantwortlich. Sein Gesicht ist zerfurcht und von der Sonne verbrannt. Normalerweise zeigt es kaum eine Regung, aber jetzt sind der Schmerz und die Sorge darin deutlich zu erkennen.
»Gib es mir«, sagt er und deutet auf das Lamm.
Tarek hebt das Tier von der Schulter. In der ganzen Zeit, die er es trägt, hat es sich nicht ein einziges Mal bewegt und auch kein Geräusch gemacht. Es zittert nur ohne Unterbrechung. Sein Körper bebt fast.
»Es hat einen Schock«, sagt er, während er seinem Vater das Lamm reicht.
»Das geht vorbei. Es wird sich beruhigen, sobald ich ihm ein neues Muttertier ausgesucht habe.«
»Weißt du schon, welches?«
»Sicher.« Sein Vater betrachtet das Tier prüfend und legt es sich über den Arm. »Dieses Lamm ist nicht das Problem, Tarek. Das weißt du doch.«
Tarek nickt. Natürlich weiß er das. Die Minen sind das Problem. Und das Ausbleiben des Regens. Und die Dorfbewohner. Und der Krieg. Und all die anderen Dinge, die so schwer zu durchschauen sind und von denen niemand mehr weiß, wann und warum sie begonnen haben.
»Geh zu Ashkan«, sagt sein Vater. »Er braucht deine Hilfe. Und – Tarek …«
»Ja, Vater?«
»Es ist gut, dass du wieder da bist.«
Ohne ein weiteres Wort abzuwarten, dreht sein Vater sich um und trägt das Lamm zur Herde. Tarek blickt ihm einen Moment nach, dann wendet er sich ab und geht zum Flussufer hinunter.
Der Tschopan und die Männer aus den benachbarten Tälern sehen von ihrer Arbeit auf und nicken ihm zu, als er an ihnen vorüberkommt. Durch sein Geschick beim Aufspüren verirrter Tiere hat er sich ihre Achtung erworben. Es hat sich herumgesprochen, dass er ein besonderes Talent dafür besitzt.
»Ah, endlich lässt du dich blicken«, sagt Ashkan, als Tarek zu ihm tritt. »Ich brauche dich.«
Er kniet abseits von den anderen Männern in einem Meer aus Wolle, vor sich ein Schaf, das er bereits zur Hälfte geschoren hat. Tarek grinst, als er es sieht, es wirkt wie halb nackt und halb angezogen. Anscheinend hat es keine Lust, den Rest seiner Wolle auch noch zu verlieren, denn es wehrt sich heftig. Mirza hat sich auf das Tier gekniet und versucht es festzuhalten, aber obwohl es nicht besonders groß ist, schafft er es kaum, es zu bändigen.
»Einer der Männer musste vor einer Stunde los, jetzt bin ich allein«, sagt Ashkan. »Komm, pack an, ich will weitermachen.«
»Aber das kann ich auch, Ashkan«, sagt Mirza. Er greift das Schaf fester, wobei er es halb erwürgt, sodass es heftig mit den Läufen zu strampeln beginnt. »Siehst du, ich habe es. Wir brauchen Tarek gar nicht.«
»Wenn ich sage, dass ich ihn brauche, dann ist das auch so, verstanden? Los, ab ins Zelt mit dir. Mutter sagt, du kannst beim Säubern der Wolle helfen.«
»Ich will aber nicht ins Zelt«, sagt Mirza. »Ich will Schafe scheren.«
Ashkan flucht und schiebt Mirza zur Seite. »Keine Widerrede, Kleiner. Du hast mir geholfen, aber jetzt verschwinde! Das ist noch keine Arbeit für dich.«
Mirza verzieht enttäuscht das Gesicht, es bleibt ihm nichts anderes übrig, als Ashkan zu gehorchen. Mit schleppenden Schritten, einen Stein vor sich herschießend, geht er zum Zelt.
»Sieh dir den Kleinen an«, sagt Ashkan. »Kann kaum richtig laufen und denkt, er könnte schon Männerarbeit tun.«
Tarek kniet sich hin und packt das Schaf mit einem geübten Griff im Nacken. Sofort ist es still und rührt sich nicht mehr.
»Als wenn du in seinem Alter anders gewesen wärst«, sagt er.
Ashkan grinst und fährt mit seiner Arbeit fort. Während er das Schaf an den Stellen schert, die er bisher nicht erreichen konnte, presst er mehrfach die Zähne aufeinander, seine Wangenknochen treten hervor. Schließlich hält er inne und sieht Tarek an.
»Wieder eins?«, fragt er.
Tarek nickt.
»Ein Wolf?«
»Mine«, sagt Tarek.
Ashkan presst einen Fluch zwischen den Zähnen hervor und wirft das Schermesser zur Seite. Dann schüttelt er den Kopf und blickt zu den Bergen hinüber.
»Wie viele dieser Minen gibt es noch?«, fragt Tarek. »Irgendwann müssen doch mal alle hochgegangen sein.«
Ashkan schnauft. »Vergiss es, Bruder! In diesem Land gibt es mehr Minen als Menschen. Und wir Kuchi haben stärker darunter zu leiden als alle anderen.« Er nimmt das Schermesser wieder zur Hand und sucht das Schaf nach Stellen ab, die er übersehen hat. »Kein Kuchi hat jemals so ein Ding vergraben. Das sind immer die Kriege der anderen. Los, bring das Tier zurück! Und hol mir ein neues.«
Tarek steht auf und lässt das Schaf frei. Es trabt von selbst zur Herde, mit einem eigenartig unsicheren Gang, als müsse es sich an sein vermindertes Gewicht erst gewöhnen. Tarek folgt ihm. Während er auf die Herde zugeht, schnuppert er in der Luft. Mit jedem Tag wird es jetzt wärmer, das ist deutlich zu spüren. Auch die Flüsse sind nicht mehr so eisig, der Anteil des Schneewassers nimmt ab, die letzten Spuren des Winters verschwinden.
Als er die Herde erreicht, schiebt er eine Ziege zur Seite, die sich ihm in den Weg stellt, und packt ein Schaf mit einem besonders dichten und verzottelten Fell. Bald wird das Rauschen der Flüsse nachlassen, denkt er, während er mit dem Tier zu Ashkan zurückgeht. Die Sonne wird stärker werden und das Gras verdorren lassen. Er blickt zu den Bergen, nicht zu denen in ihrer Nähe, in die die Schafe sich verirren, sondern zu den hohen im Südosten, an der Grenze zu Pakistan. Vielleicht sind die Pässe dort jetzt schon frei vom Schnee.
»Was denkst du, wann wir aufbrechen?«, fragt er Ashkan, als er das Schaf vor ihm zu Boden zwingt und sich danebenhockt.
Ashkan nimmt das Schermesser und wirft es hoch in die Luft. Es wirbelt ein paarmal um sich selbst und landet mit einem klatschenden Geräusch wieder in seiner Hand.
»Es dauert nicht mehr lange«, sagt er und prüft mit gespreizten Fingern das Fell des Schafes. »Wenn die Lämmer alt genug sind, um die Wanderung durchzustehen. Außerdem müssen wir die Wolle noch reinigen und auf dem Markt verkaufen. Ich schätze, in fünf oder sechs Tagen sind wir so weit.«
Er beugt sich vor und beginnt mit der Schur. Tarek beobachtet, wie er einen Schnitt nach dem anderen setzt. Er ist sehr geschickt darin, das Fell bis auf die Haut zu entfernen, ohne das Schaf zu verletzen. Bald wird Tarek diese Arbeit von ihm übernehmen. Denn an dem Tag, an dem sie in die Berge aufbrechen, das Zelt abbauen, die Kamele beladen und die Karawane sich in Bewegung setzt, wird Ashkan sie verlassen. Er ist jetzt alt genug, um sich als Tschopan bei einer anderen Familie zu verdingen. Für die nächsten Jahre wird er mit ihr unterwegs sein, und wenn er gut und hart arbeitet, kann er danach vielleicht seine eigene Herde aufbauen und seine eigene Familie gründen. Das ist zumindest sein Ziel, wie bei jedem Kuchi-Jungen.
»Es ist schade, dass du bald gehst«, sagt Tarek. Er wird Ashkan vermissen. Das meiste, was er kann, hat er von ihm gelernt, mehr noch als von seinem Vater. Die Lektionen waren manchmal hart, aber sie waren immer gut.
Ashkan hält kurz inne und sieht ihn an. »Brich nicht gleich in Tränen aus«, sagt er. »So laufen die Dinge nun mal. Und außerdem bist du bald selbst an der Reihe.«



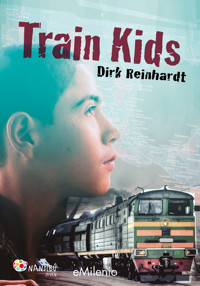

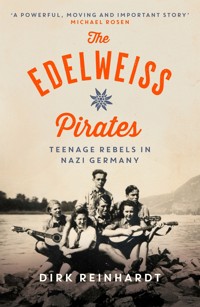













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









