
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerstenberg Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Fernando hatte sie gewarnt: "Von hundert Leuten, die über den Fluss gehen, packen es gerade mal drei bis zur Grenze im Norden und einer schafft's rüber." Zu fünft brechen sie auf: Miguel, Fernando, Emilio, Jaz und Ángel. Die Jugendlichen haben sich erst vor Kurzem kennengelernt, aber sie haben ein gemeinsames Ziel - es über die Grenze in die USA zu schaffen. Wenn sie zusammenhalten, haben sie vielleicht eine Chance. Vor ihnen liegen mehr als zweieinhalbtausend Kilometer durch ganz Mexiko, die sie als blinde Passagiere auf Güterzügen zurücklegen. Doch nicht nur Hunger und Durst, Hitze und Kälte sind ihre Gegner. Auf den Zügen herrschen eigene Gesetze und unterwegs lauern zahlreiche Gefahren: Unfälle, Banditen, korrupte Polizisten, Drogenhändler und Menschenschmuggler. Werden sie ihr Ziel im Norden erreichen? - Nachwort mit Hintergrundinformationen und Fotos des Autors - Begleitmaterial zum Buch im Bereich "KiGa & Schule" auf www.gerstenberg-verlag.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dirk Reinhardt
Inhalt
Trainkids
Nachwort
Aussprache der spanischen Wörter
Wenn wir über den Fluss setzen«, sagt Fernando, »dann sind wir im Krieg. Vergesst das nicht!«
Er zeigt hinüber. Ich versuche, etwas zu erkennen am anderen Ufer, aber es gibt nichts zu sehen. Schon gar nichts Bedrohliches oder Gefährliches. Auch der Fluss selbst sieht ganz harmlos aus, wie er so träge vor sich hin fließt, im frühen Morgenlicht, mit den vielen schwer bepackten Flößen auf dem Wasser.
Krieg – das klingt nach Toten und Verwundeten, Bomben und Gewehren. Hat Fernando einen Witz gemacht? Er dreht sich um und sieht mir in die Augen. Nein, kein Witz. Dafür ist er zu ernst.
»Tu’s nur, wenn du sicher bist, dass du es willst«, sagt er. »Wenn nicht, hau besser wieder ab. Es la última oportunidad, hombre. Ist die letzte Gelegenheit.«
Für einen Moment bin ich unsicher. Bisher war alles so weit weg: die Grenze und das Land dahinter und der lange Weg hindurch. Jetzt liegt es vor mir. Was mich wohl auf der anderen Seite der Grenze erwartet? Im Grunde habe ich nicht die geringste Ahnung, aber als ich aufgebrochen bin, habe ich mir geschworen, dass es kein Zurück geben darf. Nie wieder.
»Ich kann nicht anders«, höre ich mich sagen. »Ich muss es tun. Ich hab’s viel zu lange vor mir hergeschoben.«
Fernando dreht sich von mir weg und sieht die anderen an. Sie sagen nichts. Sie nicken nur stumm.
Es ist erst wenige Stunden her, dass ich sie getroffen habe. Und nicht viel länger, seit ich von zu Hause aufgebrochen bin. Trotzdem kommt es mir vor wie eine halbe Ewigkeit. So weit entfernt ist es inzwischen: unser kleines Haus in Tajumulco, in den Bergen von Guatemala. Mein Zuhause. Vielleicht sehe ich es nie wieder.
Ich weiß nicht, wie oft ich es mir vorgenommen habe: abzuhauen und meine Mutter zu suchen. Unendlich oft. Vor sechs Jahren hat sie uns verlassen, meine Schwester Juana und mich, und ist nie zurückgekehrt. Ich war acht damals, Juana vier. Erst war ich zu jung, um zu gehen. Später hatte ich nicht den Mut. Bis zur vorletzten Nacht. Da ging es nicht mehr anders, nach all den Dingen, die passiert waren: Ich musste los.
Während wir daliegen und den Fluss beobachten, sind die Bilder aus jener Nacht wieder da. Ich sehe es vor mir: wie ich aufstehe, Juana wecke und ihr erzähle, was ich vorhabe. Sie will mich zurückhalten. Als sie merkt, dass es zwecklos ist, holt sie ihre Ersparnisse unter der Matratze hervor und hält sie mir hin. Erst will ich das Geld nicht haben, doch sie droht, unseren Onkel und die Tante aufzuwecken. Also nehme ich es. Aber ich schwöre mir, es zurückzugeben – irgendwann, wenn wir uns wiedersehen. Dann umarme ich sie und schleiche nach draußen.
Es ist kalt und sternenklar. Über der Stadt ist der weiße Kegel des Vulkans zu sehen. Ich laufe, um warm zu werden. Später, als es schon hell ist, nimmt mich ein Lastwagenfahrer mit. Wir fahren aus den Bergen hinab in die Ebene und am Mittag bin ich weiter von zu Hause entfernt als je zuvor. Am Nachmittag setzt der Fahrer mich ab. Ich laufe zu Fuß weiter, nach Tecún Umán. Davon haben sie mir in Tajumulco erzählt: von der Stadt am Fluss, in der sich alle treffen, die über die Grenze nach Mexiko wollen.
Auf der Straße frage ich einen Jungen nach dem Weg. Er sagt, ich soll zur Migrantenherberge gehen, das sei der einzig sichere Ort in der Stadt. Da könnte ich zum letzten Mal in einem Bett schlafen und ein Frühstück kriegen, bevor es hinübergeht. »A la bestia«, sagt er. Zu der Bestie.
In der Herberge übernachte ich in einem Schlafsaal. Alles ist so fremd, dass ich kaum ein Auge zutun kann. Zum Frühstück setze ich mich an einen leeren Tisch und da stoßen nach und nach die anderen dazu. Ich habe sie vorher nie gesehen, keinen von ihnen.
Wir finden heraus, dass wir alle das gleiche Ziel haben: durch Mexiko nach Norden bis in die USA. Als wir mit dem Frühstück fertig sind und jeder für sich losziehen will, schlägt Fernando vor, wir könnten die Sache ebenso gut zusammen angehen. Dann wären unsere Chancen besser, als wenn es jeder alleine versucht. Ich überlege kurz, dann bin ich einverstanden, die anderen auch. Und so hocken wir jetzt alle zusammen hier – am Río Suchiate, dem Grenzfluss, versteckt hinter einem Gebüsch, und überlegen, wie wir am besten hinüberkommen.
Ich weiß nicht viel über die anderen. Nur das Wenige, das sie beim Frühstück erzählt haben. Fernando ist der Älteste von uns, 16 oder so. Er stammt aus El Salvador und will zu seinem Vater nach Texas. Er ist der Einzige, der Mexiko kennt, weil er die Reise schon ein paarmal versucht hat. Was dabei schiefgelaufen ist und warum er es nie geschafft hat, habe ich mich nicht getraut zu fragen. Aber er weiß eine Menge über das Land. Jedenfalls mehr als ich und die anderen. Wir wissen so gut wie gar nichts.
Die anderen, das sind Emilio, Ángel und Jaz. Emilio ist aus Honduras, mehr hat er nicht von sich erzählt. Dass er Indio ist, sieht man ihm auch so an. Ángel stammt aus Guatemala, genau wie ich. Aber nicht aus den Bergen, sondern aus der Hauptstadt. Er ist erst 11 oder 12 und will sich zu seinem Bruder nach Los Angeles durchschlagen. Und Jaz, die heißt eigentlich Jazmina. Sie ist aus El Salvador, hat sich die Haare abgeschnitten und als Junge verkleidet. Damit sie auf der Fahrt nicht dumm angemacht wird, sagt sie.
Wir hocken nebeneinander und sehen durch das Gebüsch hinunter zum Fluss. Er ist ganz schön breit und hat eine ziemliche Strömung. Das Ufer auf unserer Seite ist schlammig, es stinkt bis zu uns herauf. Wahrscheinlich von den Abwässern, die eingeleitet werden. Auf der anderen Seite steigt Nebel hoch, er liegt wie ein Schleier über den Bäumen. Irgendwie sieht es geheimnisvoll aus. Als ich es betrachte, fällt mir der Junge wieder ein, dem ich in Tecún Umán begegnet bin.
»Hey, Fernando.« Ich stoße ihn mit dem Ellbogen an. »Was ist eigentlich mit der ›Bestie‹ gemeint?«
Fernando zögert. »Wieso fragst du?«
»Na, ich hab drüben in Tecún Umán einen Jungen getroffen, der mir von der Herberge erzählt hat. Er meinte, ich könnte mich da ein letztes Mal ausruhen, bevor es rübergeht. A la bestia, hat er gesagt. Was heißt das?«
Fernando starrt auf die andere Seite, dann spuckt er aus. »Chiapas. Das heißt es. Die Gegend im Süden von Mexiko, durch die wir zuerst müssen. Die Leute nennen es die Bestie und sie haben verdammt recht damit. Es ist die Hölle. Jedenfalls für Typen wie uns.«
Er blickt finster vor sich hin. Eine Zeit lang ist es still, nur die Geräusche vom Fluss sind zu hören. Jaz hebt den Kopf und sieht mich an, dann zieht sie die Kappe, die sie trägt, noch ein Stück tiefer ins Gesicht. Ich habe das Gefühl, sie weiß auch nicht so recht, was sie von Fernando und seiner Art halten soll.
»Jeder, der nach Norden will, muss durch Chiapas«, sagt Fernando. »Und die einzige Möglichkeit dazu sind die Güterzüge. Also sammelt sich entlang der Bahnlinie das übelste Pack, das ihr euch vorstellen könnt. Sie haben es auf eure Kröten abgesehen – oder auf euch selbst. Außerdem sind die Gleise total hinüber. Ständig gibt’s Unfälle, Leute kommen unter die Räder. Deshalb heißt der Zug auch el tren de la muerte, Todeszug.«
Er setzt sich auf, mit dem Rücken zum Gebüsch, und fährt sich durch die Haare. »Beim letzten Mal hab ich einen kennengelernt, der hat mir erzählt, von hundert Leuten, die den Fluss überqueren, packen es gerade mal zehn durch Chiapas, drei bis zur Grenze im Norden und einer schafft’s rüber.« Er schüttelt den Kopf. »Eigentlich wollte ich das gar nicht erzählen, aber so ist es nun mal.«
Er wendet sich ab, irgendetwas Seltsames ist in seinen Augen. Ich weiß nicht, warum, aber ich werde einfach nicht schlau aus ihm. Will er uns nur auf die Probe stellen? Erzählt er gerne Horrorgeschichten? Oder ist es wirklich so, wie er sagt?
»Ich dachte, wir hätten bessere Chancen«, murmelt Jaz von der anderen Seite. »Weil wir zu fünft sind und nicht allein.«
»Ach, mach dir nichts vor«, sagt Fernando. »Allein oder nicht, am Ende ist doch jeder auf sich gestellt. Dann musst du deinen Arsch zusammenkneifen und sehen, wo du bleibst. Alles andere ist Träumerei.«
Er deutet auf den Fluss. »Jedenfalls müssen wir jetzt rüber, sonst ist der Zug weg. Also: Wer noch abhauen will, soll abhauen. Wer mit will, soll mitkommen. Erzählt nur später nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.«
Er kriecht durch das Gebüsch und lässt uns zurück. Keiner sagt etwas. Dann macht sich auch Emilio auf den Weg. Der scheint sich für Fernandos Geschichten nicht besonders zu interessieren. Er sieht aus, als würde ihn alles nichts angehen – oder als würde er sowieso immer mit dem Schlimmsten rechnen.
Jaz und Ángel rühren sich nicht. Ich habe das Gefühl, sie warten darauf, was ich tue. Also nehme ich meinen Mut zusammen und krieche ebenfalls los.
Auf der anderen Seite des Gebüschs wartet Fernando auf uns. Als er sieht, dass ihm alle folgen, nickt er kurz, dann zeigt er auf den Fluss. Die Flöße auf dem Wasser sind jetzt besser zu erkennen. Es gibt Dutzende davon. Die meisten bestehen nur aus ein paar Brettern, die auf Lkw-Reifen genagelt sind. Sie sind voll mit Leuten und Sachen, die sie von einem Ufer zum anderen schmuggeln. Manche sind so schwer beladen mit Kisten und Säcken, dass sie fast auseinanderbrechen.
»Wir nehmen den Dicken da«, sagt Fernando, nachdem er eine Weile mit schmalen Augen auf den Fluss gestarrt hat.
Er zeigt auf einen Flößer, der gerade vom anderen Ufer zurückkehrt und sein Floß mit einer langen Stange über das Wasser steuert. Es sieht komisch aus, wie er gegen die Strömung kämpft. Ich muss grinsen, als ich ihn sehe. Unter seinem T-Shirt quillt sein Bauch hervor, er erinnert mich an eine Qualle.
»Warum gerade den?«, fragt Ángel.
»Weiß nicht«, sagt Fernando. »Irgendwie gefällt mir der Kerl. Schätze, wir können ihn auf hundert Pesos pro Nase runterhandeln. Gebt mir das Zeug schon mal. Muss ja nicht die ganze Welt sehen, wo ihr’s habt.«
Mein Geld steckt im Schuh, zwischen der Sohle und der Einlage. Es ist alles, was ich besitze, dazu kommen noch – ganz vorn, wo es bestimmt keiner findet – die Ersparnisse von Juana. Ich nehme hundert Pesos heraus, lasse den Rest drin und ziehe den Schuh wieder an. Auch die anderen geben Fernando das Geld. Er nickt uns zu, dann rennen wir los.
Als wir den Fluss erreichen, macht der Mann gerade sein Floß am Ufer fest. Fernando geht zu ihm und fragt, ob er uns auf die andere Seite bringen kann. Der Mann arbeitet einfach weiter, er sieht uns nicht mal richtig an.
»Fünf sind einer zu viel«, knurrt er nur.
Fernando schüttelt den Kopf. »Alle oder keinen«, sagt er und zeigt auf Jaz und Ángel. »Und die Kleinen da zählen nur halb.«
Jaz verzieht beleidigt das Gesicht. Sie ist so alt wie Emilio und ich, nur ein bisschen kleiner. Aber mit Ángel will sie deswegen offenbar noch lange nicht verglichen werden.
»Außerdem haben wir kein Gepäck«, fügt Fernando hinzu.
Das stimmt: Wir haben kaum etwas dabei. Ich besitze nur einen kleinen Rucksack mit meiner Wasserflasche, meinem Handtuch, einem zweiten T-Shirt und ein bisschen Unterwäsche. Dann sind da noch die Briefe von meiner Mutter, ihre Adresse habe ich mir am Tag vor meinem Aufbruch unter die Fußsohlen tätowieren lassen. Auch die anderen haben nicht mehr bei sich.
Der Flößer richtet sich auf und sieht Fernando an. »¡Madre de Dios!«, seufzt er und verdreht die Augen. »Heilige Mutter Gottes! Na gut, von mir aus. Aber ich sag dir eins, Junge: Jeder zahlt den vollen Preis. Zweihundert Pesos, ob mit oder ohne Gepäck. Das ist mein letztes Wort.«
Fernando nickt – und bietet zwanzig. Ich traue meinen Ohren nicht. Zwanzig Pesos? Das kann doch nicht sein Ernst sein! Der Flößer sieht ihn an, als würde er ihn am liebsten im Fluss ersäufen, und presst einen Fluch zwischen den Lippen hindurch. Fernando tut, als hätte er nichts gehört. Er sieht den Mann nur aus großen, unschuldigen Augen an.
Für einen Moment ist es still. Dann folgt ein zweiter Fluch und gleich darauf fängt der Flößer an, mit Fernando zu handeln. Ich beobachte die beiden. Wie cool Fernando ist! Egal was der Flößer ihm an den Kopf wirft, es scheint ihn gar nicht zu interessieren. Es geht hin und her zwischen den beiden und am Ende einigen sie sich auf genau die hundert Pesos, die Fernando wollte. Er zieht das Geld hervor und drückt es dem Mann in die Hand.
Der Flößer faltet die Scheine zusammen und steckt sie in die Hosentasche. Dann bindet er sein Gefährt wieder los und winkt uns, wir sollen hinaufklettern. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Wir steigen auf die Bretter, hocken uns hin und sehen zu, wie er die Stange in den Grund rammt und sich dagegenstemmt. Das Floß löst sich vom Ufer und treibt auf den Fluss. Fernando schiebt es an, bis das Wasser ihm an die Hüften reicht, dann schwingt er sich ebenfalls hoch und setzt sich zu uns.
»Alles klar so weit«, flüstert er so leise, dass der Flößer es nicht hören kann. »Hoffentlich gibt’s keine böse Überraschung mehr!«
Die Strömung erfasst uns, das Floß fängt an, auf den Wellen zu schwanken. Ich sehe nach unten ins Wasser, die trübe braune Brühe macht mir Angst. Wie tief der Fluss wohl ist? Ich kann nicht schwimmen, vorsichtshalber kralle ich mich an einem der Bretter fest. Fernando, der neben mir sitzt, hat anscheinend keine Sorgen wegen des Floßes. Er mustert nur misstrauisch das andere Ufer, so als ob er der Ruhe dort nicht traut.
Es gibt ein paar Strudel im Wasser, aber der Flößer scheint sie zu kennen und umfährt sie. Nur einmal wird es ungemütlich, als seine Stange im Grund stecken bleibt. Er schwankt und verliert das Gleichgewicht, sofort fängt das Floß an, sich zu drehen. Bevor ich kapiere, was los ist, springt Fernando auf und hilft ihm. Irgendwie kriegen sie die Stange frei und das Floß wieder auf Kurs. Als Fernando zu uns zurückkehrt, habe ich den Eindruck, als läge ein schwaches Grinsen auf seinem Gesicht.
Nach ein paar Minuten haben wir die Mitte des Flusses hinter uns und treiben aufs mexikanische Ufer zu. Plötzlich taucht dort, wie aus dem Boden gewachsen, eine Grenzpatrouille auf. Rings um uns wird es unruhig. Mehrere Flöße stoppen, alles starrt auf die Polizisten, die sich am Ufer aufbauen. Für einen Moment ist es fast, als würde die Welt den Atem anhalten.
»Scheiße, ich hab’s geahnt!«, ruft Fernando und springt auf. »Was jetzt?«
Der Flößer überlegt kurz, er wirkt erstaunlich gelassen. »Wenn wir anlegen, verhaften sie euch«, sagt er. »Am besten drehen wir um und fahren zurück. Euer Geld kann ich euch aber nicht wiedergeben. Wir sind schon über der Mitte.«
»¿Estás loco?«, fährt Fernando ihn an. »Spinnst du? Sehen wir aus, als hätten wir was zu verschenken?«
Der Mann hebt die Schultern. »So sind nun mal die Regeln«, sagt er. »Ich habe sie mir nicht ausgedacht.«
Fernando tritt auf ihn zu. »Deine Scheißregeln sind mir egal. Wir setzen über, kapiert? Lass dir gefälligst was einfallen!«
»Na ja«, der Flößer grinst, »jetzt, wo du es sagst: Es gibt vielleicht eine Möglichkeit. Zufällig kenne ich diese Polizisten.«
»Was soll das heißen, du kennst sie?«
»Das heißt, dass ich sie eben kenne. Ich bin jeden Tag hier. Da trifft man schon mal den einen oder anderen.«
»Na und? Was haben wir davon?«
»Kommt ganz auf euch an. Wenn wir ihnen zum Beispiel eine kleine Aufmerksamkeit zustecken, sind sie darüber möglicherweise so erfreut, dass sie euch – sagen wir – gar nicht bemerken.«
»Du meinst, wir sollen sie schmieren?«
Der Flößer antwortet nicht. Er dreht sich zur Seite und spuckt ins Wasser.
»Also schön«, sagt Fernando. »Angenommen, wir machen’s so: Wie viel brauchst du?«
»Oh, nicht viel. Sagen wir – noch mal hundert Pesos für jeden.«
Fernando sieht ihm kalt ins Gesicht. »Jetzt wird mir die Sache klar. Du hast gewusst, dass die Typen auftauchen. Wahrscheinlich steckst du sogar mit ihnen unter einer Decke.«
Der Flößer verzieht beleidigt das Gesicht. »Ich stecke mit gar keinem unter einer Decke. Ich will nur leben. Und meine Frau und meine Kinder wollen auch leben. Wenn du das nicht kapierst, kann ich dir nicht helfen.«
Für einen Augenblick habe ich das Gefühl, Fernando würde sich am liebsten auf ihn stürzen. Aber dann beherrscht er sich, wendet sich von ihm ab und kommt zu uns.
»So ein Scheißkerl!«, zischt Jaz. »Ich könnte ihn umbringen.«
»Ja, aber nicht gerade jetzt«, sagt Fernando. »Passt auf: Wenn wir am Ufer sind, zählt jede Sekunde. Wir müssen sofort abhauen – bevor sie merken, was los ist.«
Mir ist völlig schleierhaft, wovon er redet. »Was hast du vor? Du willst ihm das Geld doch nicht etwa geben? Dann sind wir bald pleite!«
Fernando legt mir die Hand auf die Schulter. »Tut einfach, was ich sage«, flüstert er. Dann geht er zu dem Flößer und knallt ihm ein paar Scheine in die Hand.
»Oh! Danke, mein Freund«, sagt der Mann und grinst. »Meine Kinder werden für dich beten.«
»Lass deine Kinder aus dem Spiel«, sagt Fernando. »Und jetzt hör auf zu labern und bring uns ans Ufer.«
Der Flößer tut, was er sagt. Als wir uns dem Ufer nähern, winkt er den Polizisten zu. Sie nicken gnädig. Die meisten anderen Flöße sind schon auf dem Rückweg. Ein paar treiben noch in der Mitte des Flusses, nur unseres und zwei andere setzen ihren Weg fort.
Mir schlägt das Herz bis zum Hals. Der Flößer hält direkt auf die Polizisten zu. Ich versuche, sie nicht anzusehen. Jetzt sind wir da. Wir warten gar nicht erst ab, bis der Mann das Floß festmacht, sondern springen sofort in das flache, schlammige Wasser und rennen los. Ohne dass uns jemand aufhält, erreichen wir die Büsche oberhalb des Ufers.
Dort bleibe ich einen Moment stehen und drehe mich um. Unten am Wasser kann ich den Flößer erkennen, er steht bei den Polizisten und bietet ihnen eine Zigarette an. Sie unterhalten sich lachend und zeigen in unsere Richtung.
»Los, weiter!«, zischt Fernando. Wir laufen durch die Büsche und weg vom Fluss, so schnell wir können. Irgendwann tauchen Häuser auf. Das muss Ciudad Hidalgo sein, die mexikanische Grenzstadt, die Tecún Umán gegenüberliegt. Erst jetzt wird Fernando langsamer. Er wirft noch einen Blick über die Schulter, dann fängt er mit einem Mal an zu lachen.
»Was hast du?«, sage ich zu ihm, noch ganz außer Atem. »Was ist so komisch?«
Fernando zieht ein Bündel Geldscheine aus der Tasche und zeigt es herum. »Inzwischen hat er bestimmt gemerkt, dass es weg ist. Aber jetzt kriegt er uns nicht mehr.«
»Du meinst – der Kerl auf dem Floß? Hast du ihn etwa …«
Fernando antwortet nicht.
»Ich hab’s gesehen«, ruft Ángel von hinten mit seiner hellen Stimme. »Du hast ihm in die Hosentasche gepackt. Als du ihm geholfen hast, das Floß wieder auf Kurs zu bringen. Es ging sooo schnell!« Er macht eine blitzartige Handbewegung.
Fernando grinst. »Hab von Anfang an gewusst, dass du ein kluges Bürschchen bist.«
Jaz bleibt stehen. »He, Moment«, sagt sie. »Heißt das, du hast den Typen von dem Geld bezahlt, das du ihm vorher geklaut hast?«
»Na logisch«, erwidert Fernando. »Glaubst du, ich geb ihm mein eigenes?«
Jaz schüttelt entgeistert den Kopf. Anscheinend ist sie genauso verblüfft wie ich.
»Wie viel ist es denn?«, fragt sie.
»Hab auf die Schnelle nicht alles erwischt«, sagt Fernando. »Vielleicht tausend, vielleicht mehr. Jedenfalls können wir die Kohle verdammt gut brauchen.«
Er will weitergehen, aber wir anderen zögern. Da dreht er sich um und mustert uns spöttisch. »Ihr habt doch nicht etwa ein schlechtes Gewissen wegen der Sache?«
Als keiner antwortet, geht er zu Jaz und hält ihr das Geld hin. »Hier, nimm’s. Bring’s ihm zurück, wenn du willst.«
Jaz reagiert nicht. Fernando wendet sich zu mir und versucht das Gleiche. Ich weiche einen Schritt zurück, irgendwie bin ich total verwirrt. Ist das, was er gemacht hat, wirklich richtig? Ich weiß es nicht. Nur eins steht fest: Ich bin heilfroh, dass Fernando bei uns ist. Und was er gesagt hat, stimmt: Wir werden das Geld noch bitter nötig haben. Also schüttele ich nur den Kopf.
Fernando nickt. »Was hab ich euch vorhin gesagt? Über Chiapas und so?«
»Na, dass es die Hölle ist.«
»Genau.«
»Dass von hundert Leuten nur zehn durchkommen.«
»So ist es.«
»Dass einem kein Mensch hilft.«
»Verdammt richtig. Hier wollen euch alle nur ans Leder. Und glaubt bloß nicht, dagegen könnt ihr was tun, indem ihr lieb und nett seid. Wenn euch einer übers Ohr hauen will, ist es das Beste, ihr zahlt’s mit gleicher Münze heim.«
Er lässt die Scheine durch die Finger gleiten. »Alles von armen Schweinen ergaunert, und zwar immer mit der gleichen Masche. Wenn der Typ mit seinem Floß fast auf der mexikanischen Seite ist, tauchen die Grenzer auf. Er macht den Leuten Angst und presst ihnen noch mehr Kohle ab. Wahrscheinlich kriegen die Grenzer die eine Hälfte und er die andere. Also: Wenn man’s genau nimmt, hat er das Zeug geklaut. Und deswegen können wir’s ihm auch wieder wegnehmen, ohne dass wir uns deswegen vor lauter schlechtem Gewissen gleich in die Hose machen müssen.
Er sieht uns an, dann schüttelt er den Kopf und seufzt. »Ihr habt echt noch ganz schön was zu lernen. Aber los jetzt, wir sind in Mexiko. Der Zug wartet nicht auf uns!«
Seit über einer Stunde liegen wir am Güterbahnhof von Ciudad Hidalgo, versteckt hinter ein paar verrosteten Waggons auf einem Abstellgleis, und beobachten, was auf den Schienen los ist. Kurz nachdem wir eingetroffen sind, ist auch der Flößer mit den Polizisten aufgetaucht, um den Bahnhof nach uns abzusuchen. Wir sind unter einen der Waggons gekrochen, tief zwischen die Räder. Zum Glück haben sie uns nicht entdeckt und sind nach einer Weile wieder abgezogen. Aber dafür sind jetzt Wachposten aufmarschiert, überall entlang der Gleise.
»Empfangskommando angetreten«, sagt Fernando und zeigt auf sie.
Von da, wo ich liege, kann ich die Gleise zwischen den Rädern des alten Waggons hindurch gut erkennen. Bahnarbeiter stellen einen Güterzug zusammen, ein Wagen nach dem anderen wird angekoppelt. Auf beiden Seiten stehen jetzt die Wachposten, in langen Reihen von der Spitze des Zugs bis zum Ende. Als ich sie sehe mit ihren Schlagstöcken, habe ich plötzlich ein mulmiges Gefühl.
»Worauf warten die?«, frage ich Fernando.
»Na, auf uns«, sagt er.
Alle sehen ihn an, er lacht. »Natürlich nicht nur auf uns. Auch auf die anderen. Ihr könnt sie nicht sehen, aber ich wette, dass jetzt rund um den Bahnhof ein paar Hundert Leute auf der Lauer liegen. Von hier geht nämlich nur ein einziger Zug am Tag. Wer den verpasst, sitzt in dem Drecksloch fest.«
Ich drehe mich um und suche den Rand des Bahnhofs ab. Zuerst kann ich nichts erkennen, doch dann fällt mir zwischen dem Gerümpel, das dort liegt, eine schnelle, heimliche Bewegung auf. Ich sehe genauer hin. Ein paar Männer hocken da und starren auf die Gleise. Plötzlich verlassen sie ihr Versteck und schleichen auf den Zug zu. Aber schon haben die Wachposten sie entdeckt, einer brüllt, sie sollen stehen bleiben. Die Männer rennen in alle Richtungen davon, einige der Wächter folgen ihnen. Was weiter passiert, kann ich nicht mehr sehen.
Fernando schüttelt den Kopf. »Idiotas«, murmelt er. »Viel zu früh, um auf den Zug zu steigen.«
»Wann ist denn die richtige Zeit?«, fragt Ángel.
Fernando deutet die Schienen entlang. »Auf der Strecke nach Tapachula gibt’s nur ein einziges Gleis. Sie müssen auf den Gegenzug warten, vorher können sie nicht los. Der Moment, wenn der eintrifft, ist richtig. Dann herrscht nämlich Chaos.«
»Und weißt du, wann das ist?«
»Nein. Macht aber nichts, du kannst es an den Wachposten sehen. Kurz bevor er da ist, werden sie nervös. Scheint also noch zu dauern.«
Einige Zeit später ist das Zusammenkoppeln der Wagen beendet, der Zug steht abfahrbereit da. Er ist viele Hundert Meter lang, mit Dutzenden von Waggons. Manche sind Tankwagen mit Benzin oder Gas, andere Container, bei denen man nicht weiß, was sie geladen haben, wieder andere sind offen, mit Sand, Zement oder Steinen darauf.
Fernando zeigt auf einen der offenen Wagen. »Der da«, sagt er. »Der ist wie für uns gemacht. Zu dem müssen wir.«
Mir ist nicht ganz klar, wie er darauf kommt. Für mich sieht der Wagen aus wie alle anderen. Er hat Holz geladen, Stapel von Brettern, Latten und Balken, und befindet sich ziemlich genau in der Mitte des Zuges – ausgerechnet da, wo besonders viele Wachposten sind.
»Gegen die Typen haben wir keine Chance«, sagt Jaz. »Den Wagen kannst du dir abschminken.«
»Ich schmink mir gar nichts ab«, sagt Fernando. »Bin schließlich keine verdammte Schwuchtel. Los, kommt!«
Er steht auf und schleicht geduckt zur Seite davon. Wir anderen folgen ihm, obwohl wir keine Ahnung haben, was er vorhat. Immer in Deckung hinter den alten Waggons, geht es die Gleise entlang. Erst als wir ungefähr dort sind, wo der Zug aufhört und auch die Reihe der Wachposten zu Ende ist, bleibt Fernando hinter einem Zementhaufen stehen.
»Passt auf«, sagt er. »Wir warten, bis die Typen durch irgendwas weiter vorne abgelenkt sind. Dann mogeln wir uns an ihnen vorbei. Wir klettern aber nicht auf den Zug, da würden sie uns entdecken, wenn sie sich wieder umdrehen. Nein, wir kriechen drunter und dann geht’s unter den Wagen nach vorn. Alles klar?«
»Aber wenn der Zug losfährt und wir sind noch drunter«, sagt Ángel und ich kann die Angst in seiner Stimme hören. »Dann werden wir zerquetscht!«
Fernando beugt sich zu ihm. »Vertraust du mir?«
Ángel zögert. »Ja, schon.«
»Na also. Ich sag dir, keiner wird zerquetscht. Ich geh als Erster und du bleibst direkt hinter mir. Ich pass auf dich auf, okay?«
Ángel nickt. Fernando dreht sich zu uns anderen um.
»Wir kriechen bis zu dem Wagen, den ich euch gezeigt hab«, sagt er. »Da warten wir, bis der Gegenzug kommt, dann ist hier der Teufel los. Wenn alle Wachposten beschäftigt sind, klettern wir rauf und verstecken uns zwischen dem Holz. Das ist alles.«
Er sagt es, als wäre es die einfachste Sache der Welt. Aber das ist es nicht, es ist verdammt gefährlich. Mir graust bei dem Gedanken, mitten zwischen den Wachposten unter dem Zug entlangzukriechen. Jaz und Emilio sehen auch nicht gerade glücklich aus. Doch dann muss ich daran denken, dass Fernando schon am Fluss gewusst hat, was das Richtige für uns ist. Außerdem bleibt uns gar nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Wir müssen auf diesen Zug – wir müssen! Nur er kann uns nach Norden bringen.
Wir hocken uns hin und warten. Immer öfter versuchen Leute, an den Zug heranzukommen, aber jedes Mal fangen die Wachposten sie ab und treiben sie zurück. Einige haben jetzt ihre Schlagstöcke in den Händen.
Dann schaffen es ein paar Männer, durchzubrechen und einen der Wagen zu entern. Sofort steigen die Wachposten ihnen nach, packen sie und zerren sie zurück auf die Schienen. Die Männer brüllen, es gibt ein wüstes Getümmel. Auch die Wächter bei uns am Ende des Zuges wenden sich nach vorn.
»Jetzt!«, zischt Fernando und rennt los.
Wir laufen, so schnell wir können, im Rücken der Wachposten über die Gleise. Zum Glück schluckt der Tumult weiter vorn jedes Geräusch, das wir machen. Völlig außer Atem erreichen wir den letzten Wagen und verschwinden darunter. Geschafft! Keiner hat uns bemerkt! Auf Ellbogen und Knien schlängeln wir uns nach vorn. Fernando übernimmt die Führung, dahinter folgen Ángel und Jaz, dann ich, am Schluss Emilio.
Es ist heiß unter dem Zug, ich kriege kaum Luft. Überall liegen Steine zwischen den Schienen, die sich tief in die Haut bohren. Manchmal tut es so weh, dass ich aufpassen muss, nicht laut aufzustöhnen. Außerdem ist es so eng, dass wir kaum vorwärtskommen. Und auf beiden Seiten stehen die Wachposten, ich kann fast ihre Stiefel berühren, wenn ich den Arm ausstrecke.
Irgendwann stoppt Fernando. Anscheinend haben wir den Wagen mit den Holzstapeln erreicht. Ich weiß nicht, wie er ihn erkannt hat, für mich sieht von unten alles gleich aus. Ich bin so kaputt, als wäre ich stundenlang gerannt, lege nur den Kopf auf den Boden und schließe die Augen. Es stinkt nach Benzin und verbranntem Gummi. Ich bin von oben bis unten mit Öl und Ruß beschmiert, meine Knie und Ellbogen bluten.
Nachdem ich ein paar Minuten so gelegen habe, beginnen die Schienen plötzlich zu vibrieren. Ich schrecke hoch, weil ich fürchte, der Zug könnte losfahren. Aber dann ertönt ein lautes Pfeifen: Der Gegenzug läuft in den Bahnhof ein. Er bremst mit schrillem Kreischen und gleich darauf bricht auf allen Seiten ein ohrenbetäubender Lärm los. Erst kapiere ich nicht, was los ist, dann wird es mir klar: Die Schlacht zwischen den Wachposten und den blinden Passagieren hat angefangen.
Fernando brüllt irgendwas. Das ist unser Startsignal, wir kriechen ins Freie. Ich versuche, nicht darauf zu achten, was rings um uns geschieht, sondern drehe mich sofort um und klettere an dem Wagen hoch. Oben angekommen, verschwinde ich in der erstbesten Lücke zwischen den Holzstapeln, die ich finden kann.
Es ist nicht mehr als ein kleiner Spalt zwischen den Brettern und der Außenwand des Wagens. Zum Glück bin ich dünn genug, um durchzupassen. Unten ducke ich mich auf den Boden. An einer Stelle hat der Rost ein Loch in die Wand gefressen, ungefähr da, wo ich sitze. Ich beuge mich vor: Aus allen Richtungen rennen Leute über die Gleise. Viele sind erwachsene Männer, viele auch erst so alt wie ich. Die Wachposten können sie nicht mehr aufhalten. Erst drängen sie noch einige von ihnen zurück, dann werden sie regelrecht überrannt.
Plötzlich gibt es einen Ruck, der Zug fährt an. Die Holzstapel schwanken und knirschen und drücken mich in meiner Ecke zusammen. Ich schreie auf, weil ich Angst habe, sie könnten über mir einstürzen, aber zum Glück lässt der Druck wieder nach. Der Zug nimmt Fahrt auf, als wolle er dem Tumult entfliehen.
Ich sehe erneut nach draußen, kann gar nicht fassen, was da passiert. Überall die verzerrten Gesichter der Leute, die hinter dem Zug herlaufen. Ich höre die dumpfen Geräusche, wenn sie gegen die Waggons springen, sich festkrallen und nach einem Halt suchen. Und ich höre die verzweifelten Schreie, wenn sie abrutschen und fallen – so gefährlich nah an den stampfenden Rädern, die alles zermalmen, was daruntergerät.
Der Zug wird nochmals schneller, dann liegt der Bahnhof hinter uns, Häuser und Straßen ziehen draußen vorbei. Mit einem Mal ist es fast still. Aber die Schreie vom Bahnhof gellen mir noch in den Ohren.
Ich lasse mich zurücksinken und lege die Arme um die Knie. Worauf habe ich mich nur eingelassen? Erst seit ein paar Stunden bin ich jetzt in Mexiko und fühle mich doch schon ganz elend und habe Sachen gesehen, die einen richtig fertigmachen können. Aber eigentlich habe ich keinen Grund, mich zu beklagen. Ich habe es selbst so gewollt, keiner hat mich gezwungen hierherzukommen. Ich bin freiwillig hier, auf dem Zug, der nach Norden geht.
Ich lehne den Kopf gegen die Holzstapel und schließe die Augen. Es gibt kein Zurück mehr: Die Fahrt hat begonnen.
Eine ganze Zeit lang bleibe ich in meinem Versteck, ohne mich zu rühren, immer in Angst, es könnte mich noch jemand entdecken. Dann muss ich an die anderen denken. Ob es alle geschafft haben? Nach einer Weile halte ich es nicht mehr aus und steige nach oben.
Als ich den Kopf ins Freie strecke, sehe ich Fernando: Er sitzt seelenruhig auf den Brettern und schnippt einen Holzspan von seinem Hemd. Ein paar Meter weiter taucht gerade Emilio auf und es dauert nicht lange, da erscheinen auch Jaz und Ángel aus irgendwelchen Ecken und klettern nach oben.
»¿Todo bien?«, fragt Fernando, als er uns sieht. »Alles klar?«
»Nein«, sagt Ángel und fährt sich mit der Hand durch die Haare. »Da unten sind jede Menge Spinnen. Ich wollte sie verjagen, aber sie haben sich überhaupt nicht stören lassen.«
Fernando lacht. »Wenn du keine anderen Sorgen hast, kann’s dir ja so schlecht nicht gehen«, sagt er. »Immerhin bist du nicht zerquetscht worden, oder? Also hat der Plan funktioniert!«
Ich stehe auf und suche vorsichtig einen festen Halt auf den Brettern. Der Fluss, der Bahnhof und die Stadt sind in der Ferne verschwunden. Von allen Seiten wuchert ein grünes Pflanzenmeer an die Gleise heran, die Schienen ziehen sich hindurch wie ein Pfad, über den der Zug nun schnauft und stampft. Und alle Wagen, so weit ich sie überblicken kann, sind voll mit Leuten. Sie hängen an den Leitern und Trittbrettern und hocken auf den Dächern. Es sind Dutzende, vielleicht sogar hundert oder noch mehr, die es geschafft haben.
Der Zug fährt in eine Kurve. Es kracht und scheppert, die Räder quietschen. Unser Wagen schlingert so stark, dass ich das Gleichgewicht verliere. Schnell setze ich mich wieder.
»Das ist ja der reinste Wahnsinn! Wie viele sind denn hier auf den Zügen unterwegs?«
»Ach, Tausende«, sagt Fernando. »Hat nie einer gezählt. Kann auch keiner zählen.«
»Und die wollen alle nach Norden – so wie wir? In die USA?«
»Klar, wohin sonst?« Fernando lehnt sich auf die Ellbogen zurück. »Auf Urlaubsreise sind sie bestimmt nicht. Suchen alle ihr großes Glück da oben.«
»Ich hätte nicht gedacht, dass so viele in unserem Alter dabei sind«, sagt Jaz leise. Sie wirkt niedergeschlagen, anscheinend haben die Szenen am Bahnhof sie ganz schön mitgenommen.
»Ach, das werden immer mehr«, erwidert Fernando. »Erst ziehen die Alten los, weil sie von dem Elend die Schnauze voll haben und da oben in einem Jahr so viel verdienen können wie hier unten im ganzen Leben. Aber dann geht’s doch nicht so glatt, wie sie denken. Die meisten werden übers Ohr gehauen. Aus dem einen Jahr werden zwei, dann drei und dann kommen sie gar nicht mehr zurück. Also machen sich die niños perdidos auf den Weg, man nennt sie nicht umsonst verlorene Kinder. Und schon rollt die nächste Welle an.«
Als ich ihn so reden höre, muss ich an meine Mutter denken. Bei ihr war es genauso. Ein Jahr nur, Miguel, hat sie gesagt. Nur ein Jahr, Juana. Dann bin ich wieder bei euch – vielleicht schon früher, wenn alles gut geht. Aber das war eine gottverdammte Lüge. Sie ist nie zurückgekehrt, nicht nach einem Jahr, nicht nach zweien und nicht nach dreien. In jedem Brief hat sie es versprochen und nie hat sie es gehalten – was am Ende schlimmer war, als wenn wir nie wieder was von ihr gehört hätten.
Ich blicke den Bäumen nach, die hinter dem Zug zurückbleiben. Erst jetzt fällt mir auf, dass unter den Leuten, die ich am Bahnhof und auf den Wagen gesehen habe, kaum Frauen oder Mädchen sind. Wie meine Mutter wohl durch Mexiko gekommen ist? Sie hat nie ein Wort darüber verloren.
»Was ist mit den Frauen?«, frage ich Fernando. »Welchen Weg nehmen die?«
»Ach, auf den Zügen sind selten welche. Zu gefährlich. Hab gehört, die meisten lassen sich von Schleppern durch Mexiko lotsen, im Lastwagen oder so, zwischen der Ladung versteckt – falls sie das nötige Kleingeld haben oder sonstwie bezahlen können.«
»Wieso lassen sie uns denn nicht einfach gehen, wohin wir wollen?«, unterbricht Ángel ihn mit seiner hellen Stimme. »Wir tun doch keinem was.«
Fernando lacht verächtlich. »Glaubst du, danach fragt hier einer? Sie wollen uns eben nicht! Denken, wir nehmen ihre Jobs weg oder brechen in ihre Häuser ein oder stecken sie mit irgendwelchen Krankheiten an.« Er macht eine wegwerfende Handbewegung. »Ist doch egal, wir werden’s nicht ändern.«
Jaz seufzt. »Das heißt: Wir werden überall gejagt, ganz gleich wohin wir gehen? Wir sind nirgendwo sicher?«
»Sicher!«, wiederholt Fernando und schnaubt. »Das Wort kannst du aus deinem Gedächtnis streichen. Hier gibt’s keine Sicherheit. Nicht mal, wenn du zum Kacken in einem Busch hockst. Oder wenn du …«, er starrt plötzlich nach vorn, »nur in Ruhe Zug fahren willst. Passt auf die verdammten Äste auf!«
Wir schrecken hoch. Direkt vor uns streckt ein Baum seine Äste so tief über den Zug, dass sie fast über die Dächer schleifen. Fernando wirft sich der Länge nach hin und schützt sein Gesicht mit den Händen, wir anderen machen es ihm nach. Es ist höchste Zeit: Schon spüre ich den Luftzug, einer der Äste streift meinen Kopf, Blätter schlagen mir gegen die Hände. Alles geht blitzschnell. Dann ist der Spuk vorbei, genauso rasch, wie er gekommen ist.
»Scheißbäume«, flucht Fernando, als wir uns wieder aufgerappelt haben. »Hab mal gesehen, wie ein Ast gleich zwei Leute auf einmal erwischt hat. Der hat sie richtig vom Zug gefegt – direkt vor mir. War kein schöner Anblick, könnt ihr mir glauben.«
Jaz fährt sich mit der Hand übers Gesicht. Sie hat einen blutenden Striemen auf der Wange, anscheinend hat es sie heftiger erwischt als mich. »Gibt es eigentlich irgendwas, das uns hier nicht passieren kann?«, fragt sie wütend.
»Wenn mir was einfällt, erzähl ich’s dir«, sagt Fernando. »Aber das mit den Ästen geht schon, wir müssen nur die Augen aufhalten. Schlimmer sind die cuicos. Die Bullen. Die haben inzwischen bestimmt gehört, was am Bahnhof los war und dass der Zug voll mit Leuten ist. Also werden sie irgendwo zwischen hier und Tapachula auf der Lauer liegen und uns stoppen.«
»Was, auf offener Strecke?«, fragt Emilio ungläubig.
»Natürlich auf offener Strecke«, fährt Fernando ihn an. »Was denkst du? Dass sie uns in ein feines Hotel umleiten?«
Emilio zieht den Kopf ein. Für einen Moment bin ich genauso erschrocken wie er. Dass Fernando schnell aus der Haut fährt, habe ich schon gemerkt, aber Emilio hat er gerade richtig angeschrien. Ich muss an das Frühstück in der Herberge denken. Als Emilio sich zu uns gesetzt hat, lag plötzlich ein seltsamer Ausdruck auf Fernandos Gesicht. Etwas Düsteres. Damals habe ich nicht weiter darüber nachgedacht, jetzt fällt es mir wieder ein.
»Das kann er doch nicht wissen, Fernando«, sagt Jaz beschwichtigend. »Für uns ist alles neu.«
»Ja, was passiert eigentlich, wenn die Polizisten uns erwischen?«, fragt Ángel. »Werfen sie uns dann ins Gefängnis?«
Fernando wendet sich von Emilio ab, sein Blick wird wieder freundlicher. »Kann man bei Typen wie denen nie sagen. Vielleicht bringen sie uns nur zurück zur Grenze, vielleicht haben sie auch Übleres im Sinn. Jedenfalls sollten wir höllisch aufpassen, dass wir ihnen nicht in die Hände fallen.«
»Und wie kriegen wir das hin?«, frage ich ihn. »Weißt du, an welcher Stelle sie warten?«
»Na ja, in der Zeitung werden sie’s nicht gerade ankündigen«, sagt Fernando. »Wir müssen abwarten. Und wenn es so weit ist, gibt’s zwei Möglichkeiten: Entweder wir sind verdammt schnell – oder wir haben ein gutes Versteck.« Er schlägt mit der flachen Hand auf die Bretter. »Deshalb hab ich den Wagen hier ausgesucht. Holz ist einfach das Beste. Die cuicos sind zu fein, um sich die Hände schmutzig zu machen und da unten nach uns zu suchen. Wir dürfen uns nur nicht verraten.«
Der Zug fährt so langsam, dass ich mit äußerster Anstrengung gerade ein kleines Stück nebenherlaufen könnte. Mehr halten die alten Gleise und die verfaulten Schwellen anscheinend nicht aus. Unser Wagen rumpelt und schlägt von einer Seite zur anderen, als wollte er am liebsten aus den Schienen springen und sich in die Büsche schlagen.
Wir sitzen schweigend nebeneinander, beobachten die Gegend und versuchen, etwas zu erkennen in dem Blättermeer, durch das wir fahren. Aber viel zu entdecken gibt es nicht. Ab und zu huscht ein Dorf vorbei, ein paar halb verfallene Hütten zwischen schief stehenden Strommasten. Manchmal überqueren wir einen Fluss, der sich breit und schlammig zur Küste wälzt. Dahinter schließen sich dann die grünen Wände wieder und alles, was wir noch sehen können, sind die Wagen direkt vor uns und die Leute, die darauf hocken.
Es ist heiß und schwül geworden, meine Sachen kleben mir auf der Haut. Ich kann den Fahrtwind spüren, es tut gut, sich ihn ins Gesicht wehen zu lassen. Nicht nur, weil es dadurch ein wenig kühler wird. Auch weil er so etwas wie der lebendige Beweis dafür ist, dass es vorwärtsgeht. Dass ich meinem Ziel näher komme. Dass die Zeit des Wartens und Zweifelns endlich vorbei ist.
Aber vor mir liegt nicht nur die Hoffnung. Da ist auch die Angst. Seit ich aufgebrochen bin, ist mir klar geworden, dass das zwei Dinge sind, die zusammengehören. Die Hoffnung aufs Ankommen, aufs Wiedersehen, auf ein besseres Leben, irgendwo da oben im Norden – und die Angst davor, was bis dahin passieren kann. So sind auch die Blicke der Leute auf dem Zug: In dem einen Auge ist Hoffnung, in dem anderen Angst.
Ein Ruck lässt mich hochschrecken. Der Zug bremst. Vor uns stehen die Bäume nicht mehr ganz so nah an den Schienen, die Strecke wird freier. Viel erkennen kann ich trotzdem nicht, die Lokomotive verschwindet gerade in einer Biegung. Ich sehe nur, dass die Leute auf den Wagen weiter vorne auf einmal aufspringen und durcheinanderrennen.
Fernando schlägt wütend mit der Hand auf die Bretter. »¡Puta madre!«, flucht er. »Verdammte Scheiße! Sie warten extra in der Kurve, die Schweine. Los, runter! Und keinen Mucks!«
Im nächsten Augenblick verschwindet er in seinem Versteck. Ich springe ebenfalls auf und klettere in den Spalt, den ich schon am Bahnhof entdeckt habe. Unten angekommen, mache ich mich so klein wie möglich. Zuerst hoffe ich noch, Fernando könnte sich irren und wir werden doch nicht angehalten. Aber dann wird mir klar, dass es nur ein frommer Wunsch ist. Der Zug bremst erneut, ein lautes Zischen ertönt, dann steht er still.
Mit einem Auge blinzele ich durch das Loch in der Wand nach draußen. Der Zug hält mitten in der Kurve, ich kann ein ziemlich langes Stück überblicken. Entlang der Gleise warten die Polizisten, während weiter hinten, auf der Straße, ihre Streifenwagen parken. Sie tragen schwarze Uniformen, stehen dick und breitbeinig da, die klobigen Waffen an ihren Gürteln wirken wie stumme Drohungen.
Ein paar Männer von den vorderen Wagen laufen über den Zug, ich kann sie hören und ihre Schatten auf dem Boden sehen. Sie springen von einem Wagen zum nächsten, anscheinend in der Hoffnung, sie könnten irgendwo entkommen. Die Polizisten bewerfen sie mit Steinen. Einer verliert das Gleichgewicht, schreit auf und stürzt in den Schotter neben den Gleisen.
Andere springen von alleine ab und versuchen zu fliehen. Die Polizisten schreien, sie sollen stehen bleiben, aber sie hören nicht darauf und rennen weiter. Einer wird abgefangen, ganz in meiner Nähe, und zum Zug zurückgeschleppt. Er wehrt sich, will sich losreißen und tritt um sich. Da ziehen die Polizisten ihre Stöcke und prügeln auf ihn ein.
Es passiert direkt vor meinem Versteck. Ich kann die Schläge hören, das dumpfe Knallen, es ist ein furchtbares Geräusch. Fast als würde ich selbst getroffen, es geht mir durch Mark und Bein. Am liebsten würde ich die Augen schließen und wegsehen, aber ich kann den Blick nicht abwenden. Das Opfer ist ein Junge, vielleicht so alt wie Fernando. Er bricht zusammen und rührt sich nicht mehr. Die Polizisten reißen ihn hoch und tragen ihn davon.
Plötzlich fallen Schüsse. Eine Gruppe von Männern rennt über ein Feld. Mehr kann ich nicht erkennen, auch nicht, wer die Schüsse abgegeben hat, ob es nur Warnschüsse waren oder ob jemand getroffen wurde, denn im nächsten Moment läuft einer der Polizisten direkt auf unseren Wagen zu. Ich schaffe es gerade noch, den Kopf einzuziehen und mich zur Seite zu ducken. Dann höre ich, wie er nach oben klettert und auf den Brettern herumpoltert.
Vorsichtig krieche ich tiefer in mein Versteck, in den hintersten Winkel, den ich finden kann, und krümme mich dort zusammen. Eine ganze Weile höre ich die Schritte von oben, es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, bis es endlich wieder ruhiger wird. Trotzdem bleibe ich, wo ich bin, und wage mich nicht zu rühren – auch wenn mir inzwischen alles wehtut. Einige Zeit später ertönt von draußen ein lautes Pfeifen. Der Zug ruckt an, die Fahrt geht weiter.
Ich hole tief Luft, richte mich auf und lehne den Kopf gegen die Wand des Wagens. Mir ist übel, das Geräusch der Schläge und Schüsse dröhnt mir in den Ohren. Klar, schon in Tajumulco habe ich Geschichten gehört über das, was manchen Leuten in Mexiko zugestoßen sein soll, aber irgendwie habe ich sie nie geglaubt. Auch Fernandos Gerede habe ich für übertrieben gehalten. Jetzt weiß ich, dass alles stimmt. Jede einzelne verdammte Kleinigkeit ist wahr.
Wieso lassen sie uns nicht einfach gehen, wohin wir wollen?, höre ich Ángels Stimme in meinem Kopf. Ja: Wieso eigentlich? Warum jagen sie uns, als wären wir Schwerverbrecher? Wir wollen doch nichts von ihnen, wir wollen nur ihr Land durchqueren auf dem Weg zu unseren Eltern. Ich schließe die Augen und versuche, an gar nichts mehr zu denken.
Diesmal dauert es noch länger, bis ich mich endlich wieder nach oben traue. Fernando ist schon da, nach und nach tauchen auch die anderen auf. Ich weiß nicht, wie viel sie mitgekriegt haben von dem, was passiert ist, aber sie sehen alle ziemlich blass aus, die Stimmung ist gedrückt. Auf den anderen Wagen sitzen jetzt kaum noch welche. Ein paar, die sich versteckt hatten, so wie wir, und ein paar vielleicht, die abhauen konnten und dann wieder aufgesprungen sind: Das ist alles.
Fernando flucht und schleudert ein Holzstück in die Büsche, an denen wir vorbeifahren. »Scheiße, Mann, sie haben echt viele erwischt«, sagt er. »Nur gut, dass der Typ auf unserem Wagen so blind war, sonst wär unsere Reise jetzt vorbei.«
Eine Zeit lang ist es still. Dann sagt Jaz: »Habt ihr die Schüsse gehört?«
Keiner antwortet. Natürlich haben alle die Schüsse gehört. Wahrscheinlich ist es der Moment gewesen, in dem jeder von uns endgültig kapiert hat, dass wir in Mexiko alles verlieren können – sogar unser Leben. Die Frage ist nicht, wo wir in ein paar Wochen sein werden, ob wir dann unser Ziel erreicht haben oder nicht. Die Frage ist, ob wir überhaupt noch da sein werden.
»Dürfen die auf uns schießen?«, fragt Ángel.
»Natürlich nicht«, sagt Fernando düster. »Die dürfen nur schießen, wenn sie bedroht werden. Aber es geht nicht darum, was sie dürfen, sondern was sie tun. Und was soll ihnen schon passieren, wenn sie einen von uns umlegen? Wir sind indocumentados, Leute ohne Papiere. Eigentlich gibt’s uns gar nicht.« Er lacht heiser. »Hier kräht kein Hahn danach, wenn einer von uns abkratzt. Pech gehabt! Und dann geht’s weiter, als wär nichts passiert.«
Wir sitzen da und vermeiden es, uns anzusehen. Ich muss daran denken, wie wir mit Fernando am Fluss gehockt haben. Er hat uns gewarnt. Er hat uns alle gewarnt, auf die andere Seite zu gehen. Aber wir wollten ja nicht hören, wir haben es besser gewusst. Jetzt müssen wir verdammt noch mal sehen, wie wir damit fertig werden.
»Gibt es viele Kontrollen wie die?«, fragt Jaz.
»In Chiapas schon«, sagt Fernando. »Weiter im Norden wird’s weniger. Aber wenn wir Glück haben, war’s die einzige vor Tapachula und da springen wir sowieso erst mal ab.«
»Wieso denn das?« Ich verstehe nicht, was er damit sagen will. »Ich dachte, der Wagen hier ist genau der richtige für uns. Hast du selbst gesagt.«
»Ja, stimmt schon.« Er zögert kurz, dann senkt er die Stimme. »Ich hab euch noch nichts davon erzählt, aber – wir haben in Chiapas so was wie einen Schutzengel. Und in Tapachula treffen wir ihn.« Er sieht mir in die Augen. »Es ist ein Mara.«
Ich zucke zusammen. Ein Mara? Da, wo ich her bin, erschreckt man mit diesem Wort die kleinen Kinder – und nicht nur die. Die Maras sind Verbrecher, junge Typen, die sich in Banden zusammenschließen und alles tun, was verboten ist und schnelles Geld bringt. Jeder hat Angst vor ihnen. Wer einem Mara auf der Straße begegnet, wechselt schleunigst die Seite. Alle können üble Geschichten über sie erzählen. Wie zum Teufel kommt Fernando auf die Idee, wir sollten uns ausgerechnet mit einem von denen zusammentun?
»Ich weiß, was du denkst«, sagt er. »Aber auf den Zügen herrschen eigene Gesetze. Wer hier überleben will, darf nicht wählerisch sein. Und ich sag euch, der Typ ist der Beste, den wir kriegen können. Wenn uns einer heil durch Chiapas bringt, dann er.«
Die anderen scheinen auch nicht zu wissen, was sie von der Sache halten sollen. Ángel wirkt eingeschüchtert. Emilio starrt vor sich hin, bei ihm weiß man eigentlich nie, was er denkt. Jaz wirft mir einen kurzen Blick zu, dann nickt sie langsam.
»Woher kennst du den Typen?«, frage ich Fernando.
»Ach, ein paar von meinen Freunden sind Maras geworden. Mara Salvatrucha, ihr wisst schon, die Gangs aus El Salvador. Hab überlegt, ob ich mitmachen soll. Ich hatte genug davon, immer nur in die Fresse zu kriegen, wollte auch mal austeilen. Aber dann hab ich’s doch gelassen. Egal, jedenfalls hab ich bei meiner letzten Fahrt einen von den Typen wiedergetroffen. In Tapachula, das ist ihr Hauptquartier in Chiapas. Er heißt jetzt El Negro, der Schwarze – ist sozusagen sein Mara-Name –, und kümmert sich ums Zuggeschäft.«
»Du meinst: Es ist sein Job, Leute durch Chiapas zu bringen?«
»Ja, ist seine Aufgabe bei den Maras. Er kassiert Schutzgeld und bringt die Leute bis Tonalá. Bei meiner letzten Fahrt hat’s mich böse erwischt, weil ich so dämlich war und alles alleine schaffen wollte. Deshalb hab ich mich diesmal an ihn erinnert. Hab schon von Guatemala aus mit ihm gesprochen. Wenn wir wollen, nimmt er uns mit.«
»Und das Schutzgeld? Wie hoch ist es?«
»Normalerweise fünfhundert pro Nase. Aber er macht’s billiger, weil er mich kennt. Vielleicht reicht die Kohle von dem Dicken am Fluss schon aus, vielleicht müssen wir auch noch was drauflegen. Aber nicht viel, schätze ich.«
Er sagt es ganz beiläufig, als wenn er seiner Sache sicher ist. Aber irgendwie kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, wie uns ausgerechnet einer von den Maras helfen soll, wenn die Polizei den Zug kontrolliert. Macht es nicht alles nur schlimmer, wenn so einer bei uns ist?
»Ihr glaubt vielleicht, das, was wir gerade erlebt haben, war schlimm«, sagt Fernando, als er unsere zweifelnden Gesichter sieht. »Aber verglichen mit dem, was auf uns wartet, war’s nicht mehr als ein Kindergeburtstag. Mit ein bisschen Versteckspielen unter Holzstapeln kommen wir nicht durch. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede: Wir brauchen einen wie ihn. Alleine schaffen wir’s nicht.«
Als wir in Tapachula eintreffen, ist es schon spät, die Sonne ist hinter dem Horizont verschwunden. Kurz bevor wir in den Bahnhof rollen, klettern wir vom Zug und springen ab, damit wir keiner Kontrolle in die Arme laufen. Fernando führt uns durch ein paar verlassene Straßen, bis wir einen alten Friedhof erreichen.
»Da ist es«, sagt er und zeigt auf die Gräber. »Da treffen wir El Negro.«
Jaz stöhnt. »Konntest du keinen anderen Platz finden? Ich mag keine Friedhöfe.«
»Bald wirst du sie mögen«, sagt Fernando gelassen. »In der Nacht gibt’s keinen besseren Platz. Schließlich geht da im Dunkeln keiner freiwillig hin – außer Leuten wie uns.« Er lacht und nickt uns zu. »Na los! Tote beißen nicht.«
Inzwischen ist es vollständig dunkel. Als wir durch das Friedhofstor gehen, sehen wir, dass auf einigen Grabsteinen kleine Lampen brennen, die etwas Licht geben. Zwischen den Gräbern kann ich schattenhafte Gestalten erkennen, die in der Dunkelheit flüstern. Es ist ein unheimliches Geräusch. Auch Jaz ist die Sache anscheinend nicht geheuer, sie drängt sich von der Seite her näher an mich.
Fernando dagegen marschiert an den Gräbern vorbei, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Ich habe das Gefühl, dass er etwas sucht, etwas ganz Bestimmtes. Nach einiger Zeit bleibt er stehen und winkt uns zu sich.
»Hier ist es«, sagt er und zeigt auf einen Baum.
Zuerst kann ich nichts erkennen, nur dass etwas in die Rinde geschnitzt ist, also gehe ich hin. »MS« steht da in großen Buchstaben, daneben ein Totenkopf. Das Erkennungszeichen der Mara Salvatrucha, ich habe schon in Tajumulco davon gehört. Es ist tief in den Baum geschnitten und niemand hat gewagt, etwas danebenzusetzen.
Während ich die Zeichen noch betrachte, taucht plötzlich ein Schatten aus der Dunkelheit auf. Wie aus dem Boden gewachsen steht eine Gestalt vor mir, erschrocken weiche ich zurück. Dann wird es mir klar: Das muss der Mara sein, von dem Fernando gesprochen hat. Er sieht ziemlich finster aus, hat den Kopf kahl geschoren und ist an den Armen, am Hals und im Gesicht tätowiert. Erst als ich genauer hinsehe, fällt mir auf, dass er fast noch ein Junge ist – nur wenig älter als wir selbst.
Er geht zu Fernando und begrüßt ihn. Dann mustert er uns. Bei mir ist sein Blick spöttisch, bei Emilio verächtlich, bei Jaz und Ángel wird er ablehnend.
»Was soll das werden?«, knurrt er Fernando an und zeigt auf die beiden. »Ein Kindergarten?«
Fernando zuckt mit den Schultern. »Ist doch egal, Mann. Wir gehören zusammen. Und wir bleiben zusammen.«
Der Mara sieht ihn düster an. »Hör zu, wir kennen uns von früher«, sagt er. »Aber das heißt nicht, dass du Bedingungen stellst. Hier sagt nur einer, was gemacht wird.«
Fernando hebt die Hände, als wollte er sich entschuldigen. »War nicht so gemeint«, murmelt er. Seine Stimme klingt ganz anders, als wenn er mit uns spricht. Nicht mehr so locker und überlegen. Sie ist rauer geworden – und vorsichtiger.
Er geht einen Schritt auf den Mara zu. »Sie sind okay, ich kenne sie«, sagt er leise. »Nimm sie mit. Sie machen keine Schwierigkeiten, das versprech ich dir.«
Der Mara dreht den Kopf zur Seite und spuckt aus.
»Sie wissen, dass du der Einzige bist, der uns durchbringen kann«, fügt Fernando hinzu. »Sie tun alles, was du sagst.«
Einen Moment zögert der Mara noch, dann hält er Fernando mit einer schnellen Bewegung die Hand hin. »Zweitausend«, sagt er. »Die eine Hälfte hier, die andere in Tonalá. Wer Scheiße baut, fliegt vom Zug.«
Fernando überlegt kurz. Doch diesmal versucht er nicht zu handeln, wie er es am Fluss getan hat, sondern schlägt nur wortlos ein, zieht das Geld aus der Tasche und übergibt es.
Der Mara zeigt zur Seite, auf ein kleines steinernes Haus, das zwischen den Gräbern steht. »Auf der Hütte da könnt ihr pennen. Keiner stört euch. Morgen früh hol ich euch ab.«
Er nickt Fernando noch einmal zu, für uns andere hat er keinen Blick mehr übrig. In der nächsten Sekunde verschwindet er genauso leise in der Dunkelheit, wie er aufgetaucht ist.
Ich bin erleichtert, dass die Begegnung mit ihm so schnell vorbei ist. Etwas Düsteres, Bedrohliches geht von ihm aus. Vielleicht liegt es am Friedhof oder an der Dunkelheit, vielleicht an seinen Tätowierungen, ich weiß nicht – jedenfalls hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ein einziges falsches Wort oder auch nur ein einziger falscher Blick würde reichen, um den Typ ausrasten zu lassen.
Fernando deutet auf das Gemäuer, von dem der Mara gesprochen hat. Es gibt mehrere davon auf dem Friedhof, sie wirken wie kleine Grabmäler. Als wir näher kommen, sehe ich, dass auf den Wänden die gleichen Zeichen sind wie auf dem Baum. Anscheinend gehört beides zum Herrschaftsbereich der Maras. Wir klettern hoch und setzen uns aufs Dach, das noch ganz warm von der Sonne ist.
»Was soll das heißen: Wer Scheiße baut, fliegt vom Zug?«, zischt Jaz. »Der Kerl hat sie ja wohl nicht mehr alle!«
»Ach!« Fernando winkt ab. »Du darfst nicht alles so ernst nehmen, was er sagt. Die Arbeit auf den Zügen ist von allem, was die Maras tun, so ziemlich das Ungefährlichste. Das machen nur die, die sich für die richtigen Sachen noch bewähren müssen. Oder gar nicht erst dafür in Frage kommen.«
»Du meinst – er ist nicht so hart, wie er tut?«, frage ich ihn.
»Jedenfalls nicht so hart, wie er gern wäre. Verglichen mit den wirklich üblen Jungs ist er harmlos. Zeigt schon sein Name. Die brutalen Typen geben sich gern niedliche Namen, so wie El Gorrino, das Schweinchen, oder La Lagartija, die Eidechse. Vor denen musst du dich in Acht nehmen. Die mit den finsteren Namen sind kleine Fische, die sich erst noch hocharbeiten müssen.«
»Und ich hab schon gedacht, aus der Sache wird nichts«, sagt Jaz. »Als er Ángel und mich so blöd angesehen hat. Du meinst also wirklich, es geht klar mit ihm?«




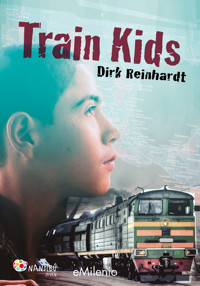
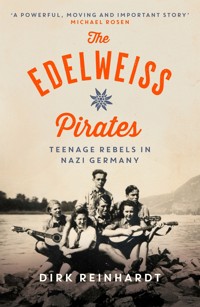













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









