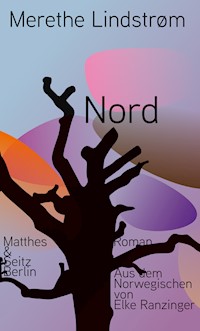
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Krieg geht zu Ende. Irgendwann. Irgendwo. Menschen irren durchs Land. Vertrieben aus Häusern, Dörfern, Lagern. Wie der siebzehnjährige Junge, dessen Schulterblätter wie Flügelstummel aus dem Rücken stehen. Er hat es geschafft zu entkommen. Dem Todesmarsch, dem Örtchen Welcherweg und auch der jungen Aneska, die ihn anstelle ihres im Krieg verschollenen Ehemanns bei sich behalten wollte. Nun folgt er seinem inneren Kompass in Richtung Nord, wo er einmal zu Hause war. Unterwegs begegnet er einem anderen Jungen, auch er mit einer tief eingegrabenen Geschichte, deren Geheimnis er unter der zerschlissenen Kleidung trägt. Ohne Hoffnung und ohne Ziel schließt er sich dem Erzähler an, und eine gewisse Zeit bewegen sie sich gemeinsam durch die von Schönheit und Zerstörung gleichermaßen bestimmte Landschaft. Merethe Lindstrøm erforscht in Nord, was mit gewöhnlichen Menschen unter extremen Bedingungen geschieht. Sie umkreist in diesem eindringlichen, unheimlichen Roman den Nullpunkt der Existenz, der in jeder Kriegs- und Fluchtsituation entsteht, wenn Nahrung, ein Zuhause, ein Bett fehlen, schlicht ein Ort, an den man gehört. Nord umfasst alle Kriege, in denen Gesellschaften und Strukturen zerstört wurden, und doch gelingt es Lindstrøm, auch von der Hoffnung zu erzählen und von der betörenden Schönheit der Natur in einem dunklen Universum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Merethe Lindstrøm
Nord
Aus dem Norwegischen von Elke Ranzinger
Für Mira
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Der Junge saß auf einem Baum.
Ich entdeckte ihn, weil ich nach oben schaute und wieder nicht nach unten, so stolpere ich manchmal beim Gehen, die Bäume locken wispernd und winkend zum Licht dort, ich achte nicht mehr auf meine Schritte. Der Junge im Baum war nur ein Gesicht, alles andere an ihm ein schroffes Relief, ein paar Kleiderfetzen, Stiefel, mit Haut überzogene Knochen. Unter dem Baum lag der Weg, verlassen wie die Felder und Hügel.
Niemand kann wissen, was er dort oben getrieben hat. Interessiert auch niemanden. Ich bin selbst nur Bruchstücke von mir, Augen, Ohren, Knochen, oder gar weniger, alles ist Weg. Ich gehe und gehe, nach Nord, entlang an Feldern, auf Waldwegen, auf breiten Schotterstraßen, auf denen der Hund, wenn er könnte, vor mir herlaufen würde. Der Winter ist nun aus dieser Gegend gewrungen wie aus einem alten dreckigen Lappen. Tagelang nichts zu sehen, auch nicht der Hund. Dann der Junge im Baum. Als ich hochrief, antwortete er nicht, glotzte bloß. Der Baum war grau, vielleicht von seiner eigenen Asche, und die Kälte hatte beinahe die gesamte Rinde abgeknabbert, nur um die dicksten Äste schuppten sich noch ein paar grobe Borkenstücke. Der Junge klammerte sich fester an den Stamm, wollte nicht herunterkommen, tat so, als spähte er in alle Richtungen. Er hätte wissen sollen, wie dumm es ist, sich auf einem Baum niederzulassen, sichtbar fürs ganze Tal. Hätte sich lieber ein Versteck am Boden suchen sollen, denn noch immer kommen Flugzeuge, diese scharf geschnittenen Silhouetten vorm Himmel, mit dicken Bäuchen und vollen Gedärmen, die sich über den Berghängen entleeren. Im Laufe der Wintermonate haben sie die Bäume niedergestreckt, die Hügel sind durch die Einschläge von tiefen Furchen und Rissen gezeichnet.
Ich scharrte mit dem Fuß im Schotter, ging ein paar Schritte, rief, dass ich etwas zu essen für ihn habe, und dass ich ihm gern sagen kann, was, falls es ihn interessiert: ein paar Wurzeln und einen Kanten. Aber der Junge war offenbar nicht hungrig. Irgendwann hatte ich dann genug von seinem stummen Starren durch die Zweige, ich pinkelte an den Baumstamm und beobachtete, wie es nach unten rann; was da mittlerweile aus mir herauskommt, sieht nicht mehr aus wie Pisse, sondern wie zähes Baumharz oder die eitrige Schmiere in den Augenwinkeln des Hunds, der außerdem wohl verschwunden ist. Der Baum hatte ein Maul, ein dunkles Loch groß wie meine Faust, da floss ein wenig hinein. Ich begab mich wieder auf den Weg, in den Takt, den er vorgibt, schleppte meine Füße weiter vorwärts. Drehte mich um und bemerkte, dass der Junge vom Baum geklettert war und sich nach dem Kanten bückte, den ich zurückgelassen hatte. Und wann immer ich mich später umsah, war der Junge hinter mir. Trottete mir nach. So wie früher der Hund oft, der gleiche räudige Anblick.
Während meiner ersten Tage auf dem Weg nach Nord merkte ich mir Besonderheiten entlang des Wegs, wie das dichte Moos auf einem Baumstumpf, einen umgestürzten Zaunpfahl, einen Vogelkadaver, ich ließ Kieselsteinchen hinter mich auf den Boden fallen, um nicht zu vergessen, woher ich gekommen war, wie Kinder in Märchen, wenn sie Angst haben, sich im tiefen Wald zu verlaufen. Für jeden vergangenen Tag steckte ich ein Hölzchen in die Hosentasche, doch ihre Anzahl stimmte nie, die Tage krochen ineinander, waren unmöglich auseinanderzuhalten, einige waren wie Nächte, undurchdringlich grau, während mich manche Nächte mit einem eigentümlich gleißenden Licht wachhielten. Auch früher, als man mich und die anderen Lagerhäftlinge auf die langen Märsche gezwungen hatte, hatten sich Tag und Nacht nicht voneinander unterschieden, aber ich erinnere mich noch an eine Frau, die zu meinem Marschglied aufgeschlossen war, sie trug ein Kopftuch über ihren weißen Haaren, eine hellblaue Schürze und an jedem Arm baumelte ein großer Korb, sie nickte lächelnd allen und keinem zu, schritt so schnell aus, dass sie bald schon den Zug anführte, munter, als wären wir zu einer Wanderung durch den Wald unterwegs. Der Tag wurde lichter, die Wachmänner scherzten mit ihr, pfiffen plötzlich gut gelaunt, und wir richteten uns auf, auch wir wollten an ihr dranbleiben, vergaßen für ein paar Minuten, wer wir waren, dass wir jeden Moment auf diese Straße sacken konnten wie frischer Dung, ich war mir sicher, den Duft von frischgebackenem Brot zu riechen, von Wurst und Käse; aus einem Fenster, an dem wir vorbeimarschierten, zog der Geruch von etwas wie Kaffee. Aus der Ferne erklang Musik, eine Trommel wurde geschlagen, als wollte sie uns den richtigen Takt vorgeben, uns und unseren geschundenen Füßen, so habe ich zumindest später darüber gedacht. Aber natürlich waren wir nicht zu einer Wanderung durch den Wald unterwegs gewesen, die Frau war immer weiter vorausgeschritten. Ich weiß nicht, wo sie abgeblieben ist, mit ihrer Schürze, den zwei Körben und dem Geruch von Essen, wie sehr wir uns auch abgemüht haben, wir konnten nicht mit ihr mithalten.
Gehen, immer nur gehen, ständig drei Schritte hinter mir. Ich weiß nie, ob der Junge, wenn ich mich umdrehe, da ist, ich höre seit dem Faustschlag eines Wachmanns auf mein rechtes Ohr schlecht, sein Gesicht werde ich nie vergessen, er schrie und brüllte, und ich schwankte und hörte im Inneren des Ohrs diesen wunderschönen, tiefen Ton, wie ein gedrückter Akkordeonknopf. Der Junge geht immer auf der Wegseite, auf der alles lautgedämpft ist. Er ist nicht so klein, wie ich dachte, wenngleich auch nicht kräftig, ein windiges Stöckchen, notfalls könnte ich ihn niederringen. Das schmutzige Hemd reicht ihm bis über die Oberschenkel, die Stoppeln auf dem kahlgeschorenen Schädel sind stahlglänzend im Sonnenlicht und schwarz, wenn wir vorm Regen unter einen Busch flüchten. Dann beäugt er mich. Ich weiß, wie ich jetzt aussehe, und fällt mein Blick in die Fensterscheibe eines verlassenen Hauses, an dem wir vorbeikommen, erkenne ich dieses Gespenst selbst nicht, ich bleibe stehen, schaue. Schultern einer abmagerten Ziege, knochige Greisenfinger. Vor ein paar Tagen hatte ich Geburtstag, hier auf dem Weg. Den siebzehnten, am selben Tag habe ich den Jungen gefunden.
Sein Alter weiß ich nicht, denke ich jetzt darüber nach, erscheint auch er mir wie ein abgemagertes Tier, vielleicht ein paar Jahre jünger als ich, ich sollte selbst jünger sein, als ich bin, und irgendwo in mir glimmt es auch, das Jungsein, aber nicht in meinen Gliedern und nicht mehr im Denken. Der Junge schläft mit einem Stein im Mund, wahrscheinlich vor Hunger, du solltest nicht mit einem Stein im Mund schlafen, sage ich. Du verschluckst dich noch daran. Wenn er nachdenkt, entsteht auf seiner Stirn eine Falte, kein Problem, sagt er, er schläft nicht so tief. Sein schmales Gesicht verschlingt den Stein wie eine graue Zunge. Bald werden wir in unwegsameres Gelände gelangen, wo alles dichter wächst, ich mag den Wald, er umarmt, die Bäume behüten, was in ihm ist, und es ist still. Abgesehen davon spricht auch der Junge nicht viel, er schont seine Stimmbänder. Aber ich habe Menschen ihre Stimme verlieren sehen, ganz ohne ein Wort zu sagen. Er ist mager, ausgedörrt, wenn ich am Morgen aufwache, bin ich mir sicher, dass er während der Nacht vertrocknet ist, dass er aufgewirbelt und fortgeweht wurde oder ich ihn nichtsahnend eingeatmet habe, er setzt sich in mir ab wie der Staub des Wegs. Ich werde ihn nie mehr los. Der Junge wird bei jedem Atemzug in meiner Luftröhre kitzeln. Aber ich wache auf und er ist noch da.
Möglicherweise kommt der Junge aus einem der Dörfer weiter im Osten, vielleicht auch nicht, jedenfalls spricht er wie die Leute dort. Sicher ist er auch geflohen, jetzt, da der Krieg fast vorbei ist und die Befreier anrücken, um die Menschen von ihren Häusern und Landstrichen zu befreien. Manche haben vor zu bleiben, die Soldaten, die von noch weiter östlich kommen, sie krallen sich Land, krallen sich Flüsse, Häuser, Mädchen. Kein Wunder, dass der Junge abgehauen ist. Eines Tages ist er losgelaufen, ist so weit gegangen, wie er konnte, und hat sich dann auf einen Baum gesetzt.
Wohin gehst du, fragt er. Nach Nord, antworte ich. Er fragt, warum Nord, als wäre das eine Frage, da ist die Heimat, sage ich. Er versteht mich offenbar nicht, oder vielleicht erinnert er sich nicht mehr daran, dass es etwas wie Heimat gibt, oder etwas wie Süd, Nord, Ost und West, aber wie weißt du, wo das ist, fragt er mit aufgerissenen Augen, sein ganzes Gesicht fragt mich. Ich hole den Kompass heraus, er leuchtet und funkelt in der Sonne, die Augen des Jungen werden noch größer, aber er sagt nichts. Und er, wo er hinwill? Der Junge zuckt mit den Schultern, der lange Hals ragt aus dem Kopfloch seines Hemds, ein gräulicher Graben mit einem ausgefransten Saum aus Dreck.
Er beäugt mich, den Kompass, meinen Rücken, der nicht ganz so aussieht, wie er das kennt, aber auch nicht so missgestaltet, dass er wegschauen müsste. Sieht man ihn zum ersten Mal, denkt man an eine Unebenheit auf dem Weg, man meint, man kann ihn vielleicht mit dem Blick tilgen, verkleinern, beheben. Dass die Leute gucken und glotzen, dagegen bin ich wehrlos, sie vielleicht auch. Ich trage diesen Rücken oder er trägt mich. Ich bücke mich und kratze mich am Knie, damit der Junge seine Musterung in Ruhe beenden kann. Dann frage ich ihn, ob er vielleicht hier in der Gegend einen Hund gesehen hat, einen sagen wir mal hässlichen, braungrauen Mischling. Er schüttelt den Kopf, diesen Kopf auf dem schmalen Hals.
Ich denke an den Hund, habe ihn lange nicht gesehen, was wohl bedeutet, dass er weg ist. Aber vielleicht ist er mir gefolgt, Hunde finden, wen sie finden wollen, sie rennen, bis sie nicht mehr können, ruhen sich aus und rennen weiter. Das Gesicht des Hunds, seine Augen, wenn er wartet. Ich weiß, was er gesehen hat. Der Junge und ich haben vor einer Weile den Weg verlassen und stapfen nun durch eine seichte, schlammige Lache, wir sind in einem Tal, vor den flachen Hügeln bildet der Wald ein Wehr und wo er sich nach vorn hin lichtet, erstrecken sich Wiesen und Ebenen. Aber wir sind zwischen den Bäumen sicherer, die Äste umarmen uns, in ihren Armbeugen verstecken sich Eichhörnchen und fette Eulen, und im Dunkeln reißen die Sterne wie Metallsplitter Löcher in die Nacht, graben Tunnel aus Licht. Die Nacht, auch nur ein Stück zerschlissener Stoff. Der Junge schlägt sich beim Gehen die Arme um den Leib, er friert, weil nicht mehr als die dünne Schicht Haut sein Inneres vom Außen trennt, am Bauch ist sie zart wie Papier. Er bräuchte mehr, was ihn zusammenhält, das seine Eingeweide schützt, etwas Dickeres als Haut, stärker und zäher.
Er fragt nicht, warum ich mich immer wieder umdrehe und den Blick auf den Weg hinter uns werfe, und starrt nach ein paar Tagen auch nicht mehr so oft auf meine Schulterblätter, guckt dafür häufiger zu der Markierung auf meiner Haut, eingeritzt vor den Märschen, jetzt eine Narbe, er guckt, wenn er sich unbeobachtet fühlt, und guckt schnell weg, wenn ich ihn dabei erwische. Dem Tätowierer damals war vor lauter Eile ein Patzer unterlaufen, die Ziffern waren ihm zu eng aneinander gerutscht und zu einem Baum geworden, oder vielleicht hatte er auch nur etwas Schönes schaffen wollen. Vielleicht hatte er genug von den Zahlenfolgen, vom Schmerz in den Gesichtern vor ihm, an diesem Eingang zu den Sammellagern, lange bevor man uns dort wie Viehherden wieder heraustrieb. Ich konnte den Märschen entkommen, ich fiel hin, als ich nicht sollte. Wer hinfiel, kam nicht durch, löste sich an Ort und Stelle auf. Ich aber bin durchgekommen, das ist wahr. Falls der Junge fragt, kann ich ihm davon erzählen. Die bleiche, harte Erde glitzerte unter mir, und zu fallen fühlte sich nicht an wie Fallen, sondern eher wie Laufen, als trügen mich meine Beine die Zeit bis zum Aufprall im Laufschritt nach unten, als liefe ich die Strecke zum Boden hinab. Mein Körper hatte eine Stimme, eine sanfte Stimme, die singend fiel, während die Erde jammerte und schrie.
Ich war nicht der Einzige, der hingefallen war, in diesen Wochen auf dem Weg, als wir ein Schwarm waren, ein schwarzer Schwarm in Bewegung. Der Kommandant trat heran und brüllte missgelaunte Befehle, sie konnten niemanden mehr überzeugen. Möglicherweise rappelten sich ein paar auch wieder hoch, andere lagen mit dem Gesicht am Boden, blieben zurück, als würden sie schlafen, durften dort liegen bleiben und Wurzeln schlagen wie die geknickten Grashalme, die sie waren. Dem Gebrüll des Kommandanten folgte das Nachladen der Waffe, er war wohl eilig zum Nächsten getreten, denn es ertönte ein weiterer Schuss. Er kam näher, ich hörte seine Schritte, die Schüsse, jemand schrie leise, manche waren zusammengesackt und erinnerten eher an ein Pilzgeflecht am Grabenrand, andere hielten sich noch auf den Beinen, wenn auch mit gebeugten Knien, als wollten sie sich hinsetzen, sie wirkten wie Tische oder Stühle, die man an ihren Scharnieren zusammenklappte. Oder wie Bücher, die sich eines nach dem anderen schlossen. Ich wartete. Ich dachte nichts mehr, im Warten gibt es keine Gedanken. Ich muss am Boden aufgeschlagen sein, denn der Knall, den ich hörte, stammte nicht von der Waffe, sondern von etwas anderem, auf der Erde lagen Splitter dessen, was auf der anderen Seite des Tals zerstört wurde. Um mich wurde es still. Als ich aufwachte, war ich allein, niemand mehr da, die Lebenden waren verschwunden.
Möglicherweise waren ein paar Stunden vergangen, ich machte die Augen auf, nahm eher Helligkeit wahr als tatsächliches Licht, als würde es in meinem Inneren ebenso leuchten wie draußen, als vibrierte es hinter meiner Netzhaut. Über mir hatte sich der Himmel gesenkt und hing tief, ein ausgebleichtes Laken, kein Zufluchtsort, nirgends, Dunkelheit am Rand der Welt, die Bäume um mich herum ragten in die Höhe. Da hatte ich Zeit zu denken, denn im Moment nach dem Fallen hatte ich noch immer das Fallen gespürt, als wäre ich noch nicht am Boden aufgeschlagen. Aber danach, als ich da lag und merkte, wie der Tag sich mit den Stunden veränderte, konnte ich mich selbst sehen, wie ich rannte, konnte mich daran erinnern, dass ich einmal Kraft gehabt hatte. Als Junge war ich oft gerannt, eine Straße entlang, über ein Feld. Ich starrte in die Fetzen des Himmels, der Boden war kalt, womöglich schneite es gleich. Mehr Gefühl existierte nicht in meinem Körper oder dem, was nach dem wochenlangen Marsch davon übrig war, und so meinte ich, ich wäre noch immer in der Luft, ich würde noch schweben, ich überlegte, warum ich damals vor langer Zeit wohl gerannt war, es hatte kein Ziel gegeben, nur die Straßen, die jetzt alle in weiter Ferne lagen.
Stiefel standen vor meinen Augen. Sie konnten ebenso gut leer sein, nicht Teil von etwas, nicht jemanden tragen, zumindest keinen Menschen, zwei abgewetzte Stiefel mit einer Feder am Schaft. Irgendwo schwoll ein Geräusch an, eine Trompete, vielleicht in mir, oder gar unter der Erde, durchdringend und klar. Der Klang öffnete die Ohren, ließ die Haut erzittern. Was die fremden Stiefel auch wollten, es gab immer eine Folge von Prozeduren zur Auswahl, genaue Protokolle. Ich wartete auf das Kommando: Los, hoch jetzt, du dreckiger Abschaum, schau, dass du deine Leichenbeine zum Laufen bringst, sonst drück ich dir deine Augen in den Schädel. Oder: der hier hat Finnen und wackelt wie ein Idiot, untauglich, aber vielleicht freut sich der Lazarettarzt über ihn, der sammelt die mit Defekten.
Zwei vom Dunkel gerahmte Gesichter, keines sagte etwas. Heimlich waren die Kulissen der Nacht auf ihre Plätze geglitten, höhere Bäume, näher rückende Gesichter. Die Stiefel standen noch immer vor meinen Augen, und daneben ein auf die Erde gestützter Kolben, der sich in einen Zylinder auswuchs, ein Gewehrlauf. Am anderen Ende wartete sicher eine Kugel. Ich machte die Augen nicht zu, nicht, nachdem ich sie jetzt geöffnet hatte, sowieso trennte nichts das Dunkel vom Dunkel, nur ein dünnes Häutchen, eine unsichere Wand in einem der seelenlosen Häuser am Wegrand. Ich hatte aufgehört zu warten. Ohne Gedanken gab es keine Zeit, ich trieb dahin, wurde hochgehoben, knallte auf hartes Holz. Man breitete den Mantel eines anderen, glückloseren, über mich, der Karren setzte sich in Bewegung und meine Augen glitten wieder zu. Irgendetwas lag neben mir und donnerte, wenn die Karrenräder über Bodenunebenheiten holperten, gegen die Holzplanken, es hatte Augen und sah sich gewiss um, rollte weiter, hin und her, hin und her, auf der Suche nach einem Körper. Vielleicht war es aber auch nur ein runder Stein oder ein Kohlkopf, dann waren wir da.
Ich glaube nicht, dass es nur diesen Weg gibt, sagt der Junge, dessen Schädel kahlgeschoren ist, und dreht sich so, dass der Wind seine Stimme fortträgt, sein Blick hastet herum, kommt nirgends zur Ruhe, er meint, sonst würden doch alle dem Weg folgen, aber wir sind allein. Alle anderen, als wären sie in dieselbe Richtung wie wir unterwegs.
Aber wir müssen hier lang, sage ich, und er nickt, kratzt sich an seinem runden Schädel. Ja, sagt er zögernd, nur glaube ich. Er führt den Satz nirgendwo hin, verlässt ihn einfach, verdreht den schmalen Jungennacken, sieht zu den Bäumen hoch, zu ihren hellgrünen Kronen. Mittlerweile mag ich ihn ein wenig, es ist schön, nicht allein zu sein, vor unserer Begegnung hatte ich schon angefangen, mit mir selbst zu sprechen. Tag für Tag nur der Weg und der starre Blick auf die eigenen Zehen. Jetzt mache ich dieselben Gesichter wie er, wenn er sich kratzt, muss ich mich kratzen, wenn er gähnt, gähne ich auch, wenn er ausspuckt, habe ich den unbändigen Drang ebenfalls auszuspucken, als wäre ich nur ein Spiegel, ein Spiegel, sonst nichts.
Ich mag mich selbst nicht mehr besonders, deswegen ist es seltsam, dass ich nur ein paar Wochen vor der Begegnung mit dem Jungen mein Ich verdoppelt habe, die Einsamkeit ertrug sich damals nicht mehr und erschuf einen anderen, wenn auch ganz gleichen, öfter und öfter war ich zwei. Jedes Mal, wenn ich mir sagte, ich bin nur einer, ich bin allein hier, jedes Mal wieder war da noch jemand in mir, der herauswollte: die Stimme kam von irgendwo in meinem Inneren. Ich sah ihn auch aus den Augenwinkeln, ein flüchtiger Schemen, mir war klar, dass er auch ich war. Er, wenn ich ihn so nennen kann, quengelte, wir würden Gesellschaft brauchen, selbst wenn man einer ist und nicht zwei, muss man nicht allein sein, er hatte meine Stimme, sprach wie ich. Er, der ich ist, ich habe ihn vor allem, wenn ich müde war, gesehen, dann war er da, ein Gespenst von etwas, das ich einmal war, von mir selbst in meinen Gedanken, vielleicht widerfährt das den Wanderern auf diesen Wegen, sie wandern aus sich heraus, aus ihrem Verstand und hinein in den Wahnsinn, derlei ist auch auf den Märschen geschehen, ich erinnere mich an einen von uns, der zu lachen begann, kichernd in sich hineinlachte, stehen blieb und lachte, nicht laut, aber dennoch lachte. Seine Augen leuchteten auf, zogen sich irgendwohin zurück, vielleicht zu einer im hintersten Schädel hängenden Erinnerung. Sein Freund, oder auch nur sein Marschnachbar, boxte ihm in die Seite, denn hier lachte man nicht, hier wollte man nicht lachen, das war kein Ort zum Lachen, denn zu lachen bedeutete, man stolperte in das Land, in dem alle verschwanden, die unterwegs den Verstand verloren, sodass jetzt nur noch diese leere, bedauerliche Erscheinung aus Beinen und Lumpen zurückblieb. Der Schmerz ließ ihn nicht mal die Augen aufreißen, aber er hörte zu lachen auf.
Seit der Junge aufgetaucht ist, zeigt er sich seltener, der andere. Der Junge ist zu leibhaftig. Natürlich habe ich die ersten Tage lang gedacht, dass ich den Jungen erfunden habe, ohne es zu wissen, dass auch er nur ein anderer Teil von mir ist, was, wenn er nur eine bessere Version derselben Stimme ist, wenn ich ein geschickterer Regisseur meiner Imaginationen geworden bin, oder einfach verrückter. Natürlich war ich misstrauisch. Aber der Junge tut Dinge, die mir nie einfallen würden, klettert häufig auf Bäume, schnell und ohne die Angst, man könnte ihn sehen, ich habe nie auf Bäumen gehockt, nie irgendwo so gesessen, dass man mich hätte entdecken können, vielleicht erhebe ich mich einfach nicht gern über andere, ich hatte immer Angst davor, runtergezogen zu werden, mit Gelächter, Spott. Ich habe also schnell verstanden, dass er nicht ich sein kann. Aber eines Nachts wache ich auf, während er schläft, und durch meinen Bauch kriecht der Zweifel, eine reizbare Larve, ich strecke den Arm aus und berühre den Jungen, lege ihm die Hand auf den Kopf und ziehe sie rasch wieder zurück, er fühlt sich nicht an wie ich, allerdings weiß ich auch nicht, wie ich mich anfühle. Ich erahne Fremdes in ihm, Orte, Wege, Zimmer, Dinge, die ich nicht erlebt, nicht gesehen habe, von denen ich nichts weiß, und die ich deshalb nicht erfunden haben kann. Er ist nicht ich. Er ist, egal wie trostlos und klein, er selbst. Ich vergrabe mein Gesicht in der Decke und weine, heilfroh, dass er nicht auch ein Gespenst ist. Weine, bis der Schlaf die Gedanken mitsamt ihrer Wurzeln ausreißt und ins Ödland des Bewusstseins schleudert.
In den Tagen vor der Begegnung mit dem Jungen, als ich als zwei unterwegs war und mein anderer Teil hörbar größer wurde, sprachen wir über Dinge, die ich vergessen hatte. Dieser andere war irgendwie langsamer, dachte mehr, und ließ uns an eine Zeit erinnern, als wir Kinder waren, wie er es nannte, in der wir gespielt oder Hausaufgaben gemacht hatten; das Zimmer mit dem Blick auf den Park, der Ausblick vom Wohnzimmer auf eine Laube, er erinnerte mich daran, dass wir immer lieber drinnen gewesen waren, wir hatten auf der Suche nach Verstecken alle Zimmer durchstreift, waren oft unter die Treppe gekrochen, ein schöner Platz, meinte er, um liegend die Beine an der Wand hochzustrecken, oder der Balkon, auf dem wir manchmal mit einer Gießkanne gespielt hatten, das Wasser hatte sich durch die Düse fächerförmig in der Luft verteilt und ein wenig davon war in den Blumenkästen im Stockwerk unter unserer Wohnung gelandet und von da weiter auf die Straße getropft, und wenn wir richtig viel ausgegossen hatten, glaubten die Menschen dort unten, dass es regnete, ich sagte, ich kann mich nicht erinnern, wir mögen Schokolade mit Sahne, sagte er, und frostige Wintertage, und so machte er weiter.
Er durchstreifte die Vergangenheit, wollte aber nicht über die Märsche sprechen, nicht über das Aufwühlende, Üble, er war wie ein Text mit nur einem Absatz, ich musste ihn an all das erinnern. Auch er war beschädigt. Ich habe mich von ihm abgekehrt, von dem Teil in mir, in dem er lebt, habe ihn verlassen wie eine alte Adresse, wie das Haus, in das wir, wie er uns in Erinnerung rief, gehört hatten. Er hat versucht, Schritt zu halten, hat sich danach gesehnt, mitzugehen und nicht länger allein zu sein. Ich sehe ihn, er wartet hinter einer Kurve und lehnt sich an den Zaun, wenn ich vorbeigehe. Jetzt ist die Stimme schwächer oder der Junge übertönt sie.
Der Sohn, so wurde ich als Kind genannt, meine Eltern erzählten anderen von ihrem Kummer mit dem Sohn, in dem ich mich nicht wiedererkannte. Was sie sahen, erschuf jemand anderen, einen anderen Jungen als mich, er war der, der ich in ihren Augen war. Verrückte verfangen sich in ihren Gedanken und kommen nicht davon los, wie der Junge in dem alten, aufgetragenen Mantel, der daheim in Nord immer an der Ecke des Kolonialwarenladens stand. Der ist krank, sagten alle; er hatte einen eigenartigen Blick und trieb sich den ganzen Tag dort herum, bis ihn sein Vater abholte und nach einer Ohrfeige den groß gewachsenen Jungen vor sich herschubste, damit er schneller ging. Sobald der Sohn stehen blieb, stieß ihm der Vater in den Rücken und der Oberkörper des Manteljungen, der diesen Schlag nie erwartete, schnellte vor und seine Beine versuchten irgendwie hinterherzukommen. Ein langer, ungelenker Körper, das erschrockene Gesicht, wenn ihn der Vater aus dem Gleichgewicht brachte. Irgendwann sprach er mich an, als ich an ihm vorbeikam, Jol, sagte er. Vielleicht meinte er, dass ich Jol bin, oder dass er das ist. Ich lief schnell weg, während er sein unverständliches Zeug schrie.
Er wollte mir einen Namen geben, der Name war schön, einsam. Ich mochte den Jungen nicht, diese Glubschaugen, den alten Mantel, die anderen Kinder hänselten ihn und lachten. Aber selbst die dunkelsten, einsamsten Gedanken brauchen einen Ort zum Leben, und jetzt auf diesem Weg bin ich Jol geworden; er steht dort zwischen den Bäumen, sein Mantel ist alt, sein Haar lang, der Blick verwirrt, suchend, ist man einer wie er, bleibt man immer allein.
Als sie den Sohn, mich, nach der Geburt sahen, bemerkten unsere Eltern die leichte Deformation, die Schulterblätterformung, fast ein Gewaltakt, diese unerwartete Härte an dem zarten Körper. Das Baby erschien ihnen ungewöhnlich kompakt, wenn sie mich im Arm hielten. Manch einer musste von der Seite betrachtet an beispielsweise Flügel denken, schmetterlingsgleich, zusammengeklappt. Eine solche Beschreibung fassten meine Eltern als Nettigkeit auf, da ja dieses mein Merkmal ganz augenscheinlich ein Fehler war. Und nur wenn sie selbst die Ähnlichkeit zwischen dem gepuckten Säugling und einer Insektenvorstufe bemerkten, der Chrysalis, einer nur an einem Punkt befestigten, hängenden Puppe, fest eingesponnen, erwachte in ihnen die Unruhe, ihr könnte beim Öffnen etwas ganz anderes entschlüpfen, etwas Bedrohliches, weder schmetterlingsgleich noch menschlich.





























