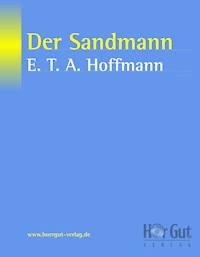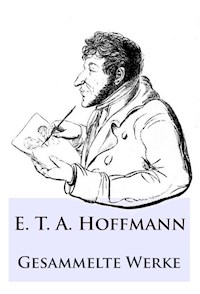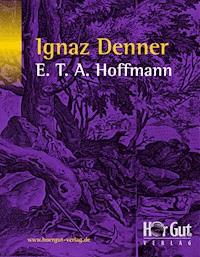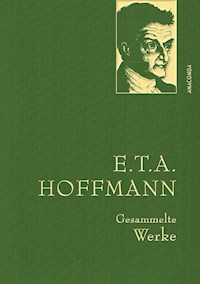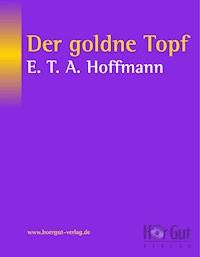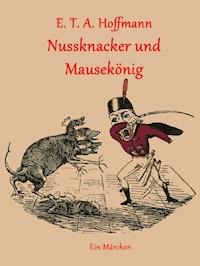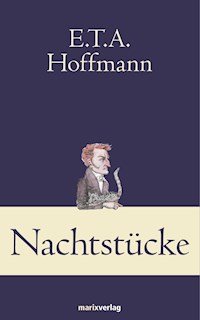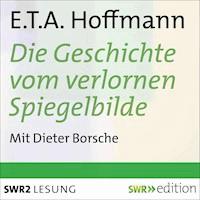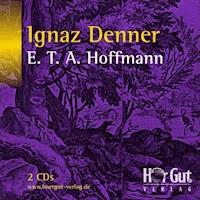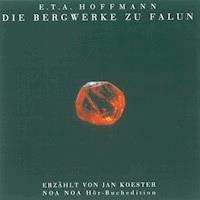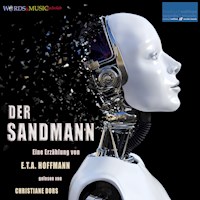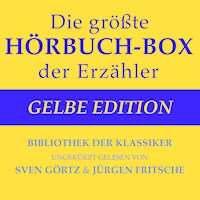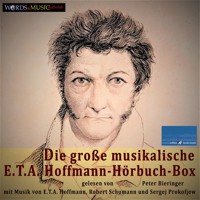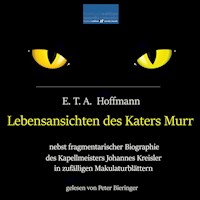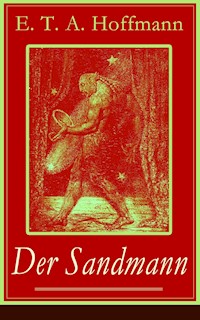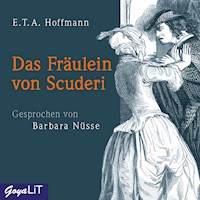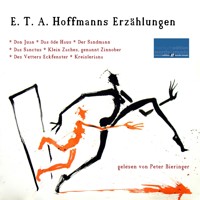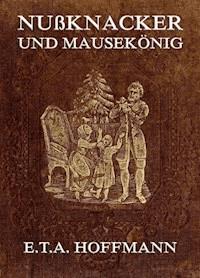
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Kunstmärchen und die Vorlage zu Tschaikowskys Ballett "Der Nußknacker". Marie, Tochter des Medizinalrats Stahlbaum, entdeckt am Weihnachtsabend auf dem Gabentisch einen Nussknacker. Der Bruder Fritz knackt mit der neuen Nürnberger Holzpuppe so harte Nüsse, dass sie sich die Zähne ausbeißt. Marie nimmt den lädierten Nussknacker in ihre Obhut und platziert ihn neben Fritzens Husarenarmee. Die rekrutiert sich aus lauter Spielzeugsoldaten und steht in der Vitrine .... (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nußknacker und Mausekönig
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Inhalt:
Ernst Theodor Amadeus (E.T.A.) Hoffmann – Biografie und Bibliografie
Nußknacker und Mausekönig
Der Weihnachtsabend
Die Gaben
Der Schützling
Wunderdinge
Die Schlacht
Die Krankheit
Das Märchen von der harten Nuß
Fortsetzung des Märchens von der harten Nuß
Beschluß des Märchens von der harten Nuß
Onkel und Neffe
Der Sieg
Das Puppenreich
Die Hauptstadt
Beschluß
Nußknacker und Mäusekönig, E.T.A. Hoffmann
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849616175
www.jazzybee-verlag.de
Ernst Theodor Amadeus (E.T.A.) Hoffmann – Biografie und Bibliografie
Einer der originellsten und phantasiereichsten deutschen Erzähler, zugleich auch Musiker und Maler, geb. 24. Jan. 1776 zu Königsberg i. Pr., gest. 24. Juli 1822 in Berlin. Er studierte in seiner Vaterstadt die Rechte, arbeitete seit 1796 bei der Oberamtsregierung in Großglogau und seit 1798 bei dem Kammergericht in Berlin, wurde 1800 Assessor bei der Regierung in Posen, aber wegen einiger anzüglichen Karikaturen, die er gefertigt, 1802 als Rat nach Plozk und 1803 in gleicher Eigenschaft nach Warschau versetzt, wo damals auch J. E. Hitzig und Zacharias Werner als preußische Beamte tätig waren. Der Einmarsch der Franzosen 1806 machte hier seiner amtlichen Laufbahn ein Ende. Ohne Vermögen und ohne Aussichten im Vaterland, benutzte er seine musikalischen Talente zum Broterwerb und ging 1808 auf Einladung des Grafen Julius v. Soden als Musikdirektor bei dem neuerrichteten Theater nach Bamberg. Als dieses bald nachher geschlossen wurde, geriet er in die größte Not. Nachdem er sich einige Zeit durch Musikunterricht und Arbeiten für die Leipziger »Allgemeine musikalische Zeitung« die nötigsten Unterhaltsmittel erworben, erhielt er 1813 die Stellung als Musikdirektor bei der Secondaschen Schauspielergesellschaft und leitete bis 1815 das Orchester dieser abwechselnd in Dresden und in Leipzig spielenden Truppe. 1816 wurde er wieder als Rat bei dem königlichen Kammergericht in Berlin angestellt; er starb daselbst an der Rückenmarksschwindsucht nach qualvollen Leiden. H. hatte sich von Jugend auf mit Vorliebe dem Studium der Musik gewidmet. In Posen brachte er das Goethesche Singspiel »Scherz, List und Rache« aufs Thea ter, in Warschau »Die lustigen Musikanten« von Brentano, dazu die Opern: »Der Kanonikus von Mailand« und »Liebe und Eifersucht«, deren Text er nach ausländischen Mustern selbst bearbeitete. Auch setzte er die Musik zu Werners »Kreuz an der Ostsee« und komponierte für das Berliner Theater Fouqués zur Oper umgestaltete »Undine«, deren Partitur samt den prächtigen, nach Hoffmanns Entwürfen gefertigten Dekorationen bei dem Brande des Opernhauses zugrunde ging. Die Aufforderung, seine in der »Musikalischen Zeitung« zerstreuten Aufsätze zu sammeln, veranlaßte ihn zur Herausgabe der »Phantasiestücke in Callots Manier« (Bamberg 1814, 4 Bde.; 4. Aufl., Leipz. 1864, 2 Bde.), die großes Aufsehen machten und ihm die unterscheidende Bezeichnung »H.-Callot« verschafften. Weiter folgten: »Vision auf dem Schlachtfeld von Dresden« (Leipz. 1814); »Elixiere des Teufels« (Berl. 1816); »Nachtstücke« (das. 1817, 2 Bde.); »Seltsame Leiden eines Theaterdirektors« (das. 1818); »Die Serapionsbrüder« (das. 1819–21, 4 Bde.; nebst einem Supplementband, der Hoffmanns letzte Erzählungen enthält, das. 1825); »Klein Zaches, genannt Zinnober« (das. 1819, 2. Aufl. 1824); »Prinzessin Brambilla, ein Capriccio nach Jakob Callot« (das. 1821); »Meister Floh, ein Märchen in sieben Abenteuern zweier Freunde« (Frankf. 1822); »Lebensansichten des Katers Murr, nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler, in zufälligen Makulaturblättern« (Berl. 1821–22, 2 Bde.); »Der Doppelgänger« (Brünn 1822) und einige kleinere Erzählungen, von denen »Meister Martin und seine Gesellen«, »Das Majorat«, »Das Fräulein von Scudéry«, »Der Artushof«, »Doge und Dogaresse« etc. wahre Meisterstücke der Novellistik genannt zu werden verdienen. H. war ein durchaus origineller Mensch, mit den seltensten Talenten ausgerüstet, wild, ungebunden, nächtlichem Schwelgen leidenschaftlich ergeben (wobei er in Berlin besonders an Ludwig Devrient einen geistesverwandten Genossen hatte) und doch ein trefflicher Geschäftsmann und Jurist. Voll scharfen und gesunden Menschenverstandes, der den Erscheinungen und Dingen sehr bald die schwachen und lächerlichen Seiten ablauschte, gab er sich doch allerlei phantastischen Anschauungen und abenteuerlichem Dämonenglauben hin. Exzentrisch in seiner Begeisterung, Epikureer pis zur Weichlichkeit und Stoiker bis zur Starrheit, Phantast bis zum fratzenhaftesten Wahnsinn und witziger Spötter bis zur phantasielosen Nüchternheit, vereinigte er die seltsamsten Gegensätze in sich, Gegensätze, in denen sich auch seine meisten Novellen bewegen. In allen seinen Dichtungen fällt der Mangel an Ruhe zuerst auf, seine Phantasie und sein Humor reißen ihn unaufhaltsam mit sich fort. Finstere Gestalten umkreisen und durchkreuzen stets die Handlung, und das Wilddämonische spielt selbst in die Welt der philisterhaften und modernen Alltäglichkeit hinein. In der Virtuosität, gespenstiges Grauen zu erwecken, werden wenige Erzähler H. erreicht haben; es ist glaubhaft, daß er sich, wie man erzählt, vor seinen eignen gespenstigen Gestalten gefürchtet habe. Die Sprache handhabte er mit großer Gewandtheit, wenn auch nicht ohne Manier. Als Musikkritiker hielt er zu Spontini und den Italienern gegen K. M. v. Weber und die aufblühende deutsche Oper, wirkte aber für das Verständnis Mozarts und Beethovens. Eine Sammlung seiner »Ausgewählten Schriften« erschien Berlin 1827–28, 10 Bde., denen seine Witwe Micheline, geborne Rorer, 5 Bände Supplemente (Stuttg. 1839) beifügte, welche die Erzählungen aus seinen letzten Lebensjahren und die 3. Auflage von Hitzigs Biographie (»Hoffmanns Leben und Nachlaß«, zuerst Berl. 1823) enthalten. Eine neue Ausgabe erschien u. d. T. »Gesammelte Schriften« (Berl. 1871–73. 12 Bde.), in der Hempelschen Sammlung (das. 1879–83, 15 Tle.) und, besorgt von E. Griesebach, in M. Hesses Klassikerausgaben (»Sämtliche Werke«, Leipz. 1899, 15 Bde.); eine gut kommentierte Auswahl der »Werke« bot Schweizer (das. 1896, 3 Bde.), eine andre mit Einleitung von Lautenbacher erschien im Cottaschen Verlag (Stuttg. 1894, 4 Bde.). Vgl. auch »Das Kreislerbuch, Texte, Kompositionen und Bilder.« Zusammengestellt von Hans v. Müller (Leipz. 1903). H. war auch ein geschickter Karikaturenzeichner, von dem mehrere Karikaturen auf Napoleon I. herrühren. Interessante Erinnerungen an H. gab Funck (K. F. Kunz) in seiner Schrift »Aus dem Leben zweier Dichter, Ernst Theod. Wilh. H. und Fr. G. Wetzel« (Leipz. 1836). Im Ausland, besonders in Frankreich, ist H. vielfach übersetzt und nachgeahmt worden. Vgl. Ellinger, E. T. A. Hoffmann, sein Leben und seine Werke (Hamb. 1894); O. Klinke, E. T. A. Hoffmanns Leben und Werke. Vom Standpunkte des Irrenarztes (Braunschw. 1903).
Nußknacker und Mausekönig
Der Weihnachtsabend
Am vierundzwanzigsten Dezember durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über durchaus nicht in die Mittelstube hinein, viel weniger in das daranstoßende Prunkzimmer. In einem Winkel des Hinterstübchens zusammengekauert, saßen Fritz und Marie, die tiefe Abenddämmerung war eingebrochen und es wurde ihnen recht schaurig zumute, als man, wie es gewöhnlich an dem Tage geschah, kein Licht hereinbrachte. Fritz entdeckte ganz insgeheim wispernd der jüngern Schwester (sie war eben erst sieben Jahr alt geworden) wie er schon seit frühmorgens es habe in den verschlossenen Stuben rauschen und rasseln, und leise pochen hören. Auch sei nicht längst ein kleiner dunkler Mann mit einem großen Kasten unter dem Arm über den Flur geschlichen, er wisse aber wohl, daß es niemand anders gewesen als Pate Droßelmeier. Da schlug Mariie die kleinen Händchen vor Freude zusammen und rief: "Ach was wird nur Pate Droßelmeier für uns Schönes gemacht haben." Der Obergerichtsrat Droßelmeier war gar kein hübscher Mann, nur klein und mager, hatte viele Runzeln im Gesicht, statt des rechten Auges ein großes schwarzes Pflaster und auch gar keine Haare, weshalb er eine sehr schöne weiße Perücke trug, die war aber von Glas und ein künstliches Stück Arbeit. Überhaupt war der Pate selbst auch ein sehr künstlicher Mann, der sich sogar auf Uhren verstand und selbst welche machen konnte. Wenn daher eine von den schönen Uhren in Stahlbaums Hause krank war und nicht singen konnte, dann kam Pate Droßelmeier, nahm die Glasperücke ab, zog sein gelbes Röckchen aus, band eine blaue Schürze um und stach mit spitzigen Instrumenten in die Uhr hinein, so daß es der kleinen Marie ordentlich wehe tat, aber es verursachte der Uhr gar keinen Schaden, sondern sie wurde vielmehr wieder lebendig und fing gleich an recht lustig zu schnurren, zu schlagen und zu singen, worüber denn alles große Freude hatte. Immer trug er, wenn er kam, was Hübsches für die Kinder in der Tasche, bald ein Männlein, das die Augen verdrehte und Komplimente machte, welches komisch anzusehen war, bald eine Dose, aus der ein Vögelchen heraushüpfte, bald was anderes. Aber zu Weihnachten, da hatte er immer ein schönes künstliches Werk verfertigt, das ihm viel Mühe gekostet, weshalb es auch, nachdem es einbeschert worden, sehr sorglich von den Eltern aufbewahrt wurde. - "Ach, was wird nur Pate Droßelmeier für uns Schönes gemacht haben", rief nun Marie; Fritz meinte aber, es könne wohl diesmal nichts anders sein, als eine Festung, in der allerlei sehr hübsche Soldaten auf und ab marschierten und exerzierten und dann müßten andere Soldaten kommen, die in die Festung hineinwollten, aber nun schössen die Soldaten von innen tapfer heraus mit Kanonen, daß es tüchtig brauste und knallte. "Nein, nein", unterbrach Marie den Fritz: "Pate Droßelmeier hat mir von einem schönen Garten erzählt, darin ist ein großer See, auf dem schwimmen sehr herrliche Schwäne mit goldnen Halsbändern herum und singen die hübschesten Lieder. Dann kommt ein kleines Mädchen aus dem Garten an den See und lockt die Schwäne heran, und füttert sie mit süßem Marzipan." "Schwäne fressen keinen Marzipan", fiel Fritz etwas rauh ein, "und einen ganzen Garten kann Pate Droßelmeier auch nicht machen. Eigentlich haben wir wenig von seinen Spielsachen; es wird uns ja alles gleich wieder weggenommen, da ist mir denn doch das viel lieber, was uns Papa und Mama einbescheren, wir behalten es fein und können damit machen, was wir wollen." Nun rieten die Kinder hin und her, was es wohl diesmal wieder geben könne. Marie meinte, daß Mamsell Trutchen (ihre große Puppe) sich sehr verändere, denn ungeschickter als jemals fiele sie jeden Augenblick auf den Fußboden, welches ohne garstige Zeichen im Gesicht nicht abginge, und dann sei an Reinlichkeit in der Kleidung gar nicht mehr zu denken. Alles tüchtige Ausschelten helfe nichts. Auch habe Mama gelächelt, als sie sich über Gretchens kleinen Sonnenschirm so gefreut. Fritz versicherte dagegen, ein tüchtiger Fuchs fehle seinem Marstall durchaus so wie seinen Truppen gänzlich an Kavallerie, das sei dem Papa recht gut bekannt. - So wußten die Kinder wohl, daß die Eltern ihnen allerlei schöne Gaben eingekauft hatten, die sie nun aufstellten, es war ihnen aber auch gewiß, daß dabei der liebe Heilige Christ mit gar freundlichen frommen Kindesaugen hineinleuchte und daß wie von segensreicher Hand berührt, jede Weihnachtsgabe herrliche Lust bereite wie keine andere. Daran erinnerte die Kinder, die immerfort von den zu erwartenden Geschenken wisperten, ihre ältere Schwester Luise, hinzufügend, daß es nun aber auch der Heilige Christ sei, der durch die Hand der lieben Eltern den Kindern immer das beschere, was ihnen wahre Freude und Lust bereiten könne, das wisse er viel besser als die Kinder selbst, die müßten daher nicht allerlei wünschen und hoffen, sondern still und fromm erwarten, was ihnen beschert worden. Die kleine Marie wurde ganz nachdenklich, aber Fritz murmelte vor sich hin: "Einen Fuchs und Husaren hätt ich nun einmal gern."
Es war ganz finster geworden. Fritz und Marie fest aneinandergerückt, wagten kein Wort mehr zu reden, es war ihnen als rausche es mit linden Flügeln um sie her und als ließe sich eine ganz ferne, aber sehr herrliche Musik vernehmen. Ein heller Schein streifte an der Wand hin, da wußten die Kinder, daß nun das Christkind auf glänzenden Wolken fortgeflogen - zu andern glücklichen Kindern. In dem Augenblick ging es mit silberhellem Ton: Klingling, klingling, die Türen sprangen auf, und solch ein Glanz strahlte aus dem großen Zimmer hinein, daß die Kinder mit lautem Ausruf: "Ach! - Ach!" wie erstarrt auf der Schwelle stehenblieben. Aber Papa und Mama traten in die Türe, faßten die Kinder bei der Hand und sprachen: "Kommt doch nur, kommt doch nur, ihr lieben Kinder und seht, was euch der Heilige Christ beschert hat."