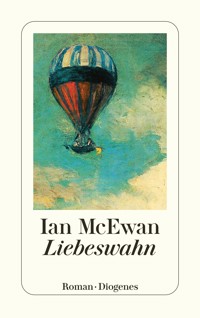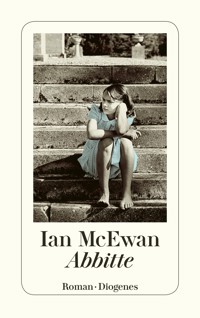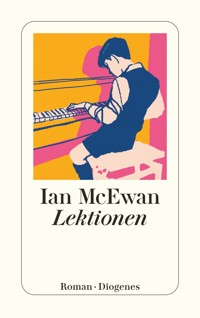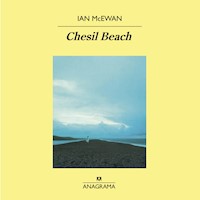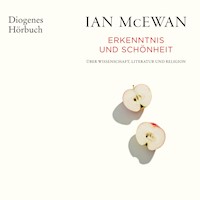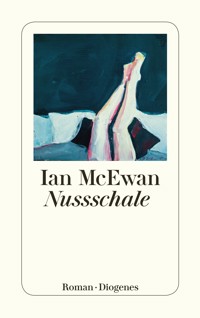
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine klassische Konstellation: der Vater, die Mutter und der Liebhaber. Und das Kind, vor dessen Augen sich das Drama entfaltet. Aber so, wie Ian McEwan sie erzählt, hat man diese elementare Geschichte noch nie gehört. Verblüffend, verstörend, fesselnd, philosophisch – eine literarische Tour de Force von einem der größten Erzähler englischer Sprache.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Ian McEwan
Nussschale
Roman
Aus dem Englischen von Bernhard Robben
Diogenes
{5}Für Rosie und Sophie
{7}O Gott, ich könnte in eine Nussschale eingesperrt sein und mich für einen König von unermesslichem Gebiete halten, wenn nur meine bösen Träume nicht wären.
Shakespeare, Hamlet
{9}1
So, hier bin ich, kopfüber in einer Frau. Ich warte, die Arme geduldig gekreuzt, warte und frage mich, in wem ich bin und worauf ich mich eingelassen habe. Sehnsüchtig schließe ich die Augen, denke ich daran zurück, wie ich einst im durchsichtigen Fruchtsack trieb, verträumt in der Blase meiner Gedanken schwebte, in Zeitlupe Purzelbäume durch meinen privaten Ozean schlug und dann und wann sanft an die transparenten Grenzen meiner Umfassung stieß, dieser mitteilsamen Membran, die vibrierte vom Widerhall der leicht gedämpften Stimmen der Verschwörer und ihrer schändlichen Pläne. Das war in meiner sorglosen Jugend. Nun – längst gedreht und ohne einen Zentimeter freien Raum, Knie eng an den Bauch gezogen, Kopf ins Becken gesenkt – laufen meine Gedanken auf Hochtouren. Das Ohr Tag und Nacht an die blutdurchströmten Wände gepresst, bleibt mir auch keine andere Wahl. Ich lausche, merke mir alles und mache mir Sorgen, denn ich {10}höre Bettgeflüster, das von einer tödlichen Intrige kündet, und zittere bei dem Gedanken an das, was mich erwartet. Wo werde ich da hineingezogen?
Ich schwimme in Abstraktionen, und allein die sich ständig mehrenden Beziehungen zwischen ihnen schaffen die Illusion einer bekannten Welt. Wenn ich ›blau‹ höre, eine Farbe, die ich nie gesehen habe, stelle ich mir ein mentales Ereignis vor, das jenem von ›grün‹ ähnlich ist, einer Farbe, die ich gleichfalls noch nie sah. Ich zähle mich zu den Unschuldigen, bin von Bündnissen und Verpflichtungen unbeschwert, ein freier Geist trotz meines beschränkten Lebensraumes. Es gibt niemanden, der mir widerspräche, der mich ermahnte, ich habe keinen Namen, keine Adresse, keine Religion, keine Schulden und keine Feinde. Mein Terminkalender, wenn es ihn denn gäbe, vermerkte höchstens den baldigen Tag meiner Geburt. Ich bin – oder war –, trotz allem, was die Genetiker heute behaupten, ein unbeschriebenes Blatt, eine leere Schiefertafel. Wenn auch eine aus glitschigem, porösem Schiefer, wie er in keinem Klassenzimmer, keinem Häuserdach Verwendung fände, eine Schiefertafel, die wächst und sich dabei selbst beschreibt und deren leere Fläche stetig abnimmt. Ich zähle mich zu den Unschuldigen, und doch spiele ich offenbar eine Rolle in einem Komplott. Meine Mutter, gesegnet {11}sei ihr unablässig laut mahlendes Herz, scheint darin verwickelt zu sein.
Scheint, Mutter? Nein, ist. Du bist. Du bist verwickelt. Ich habe es von meinem Anfang an gewusst. Lasst mich ihn heraufbeschwören, jenen Moment der Schöpfung, der übereinfällt mit meinem ersten Gedanken. Vor langer Zeit, vor mehreren Wochen, wölbten sich die Neuralwülste auf, um mein Rückgrat zu bilden, und viele Millionen junger Neuronen, wuselig wie Seidenraupen, spannen und webten mit Hilfe ihrer Axonschweife das herrliche goldene Gewebe meiner ersten Idee – ein so simpler Begriff, dass er sich mir heute wieder entzieht. War es ich? Zu selbstverliebt. War es jetzt? Zu dramatisch. Dann etwas, das beidem vorausgeht und beides enthält, ein einzelnes Wort, Ausdruck eines stillen Seufzers, eines Schwindelgefühls der Hinnahme, des reinen Seins, etwas wie – dies? Zu gewählt. Meine Idee, ganz nahe dran, hieß sein. Und wenn nicht sein, dann die grammatische Variante ist. Das war mein Urbegriff, der springende Punkt – ist. Nur das. Im Geiste von: Es muss sein. Der Beginn des bewussten Lebens war das Ende der Illusion – der Illusion des Nichtseins – und zugleich die Eruption des Realen. Der Triumph des Realismus über die Magie, von ist über scheint. Meine Mutter ist in eine Verschwörung verwickelt, {12}und folglich bin ich es auch, selbst wenn es mir zufiele, ihre Pläne zu durchkreuzen. Oder mich zu rächen, falls ich – zaudernder Narr, der ich bin – zu spät zur Welt komme.
Doch ich will nicht jammern, denn eigentlich habe ich Glück gehabt. Von Beginn an, als ich aus goldenem Tuch das Geschenk meines Bewusstseins wickelte, begriff ich, dass ich zu schlimmerer Zeit an schlimmerem Ort hätte ankommen können. Das Allgemeine steht bereits fest, meine familiären Probleme sind dagegen vernachlässigbar, sollten es zumindest sein. Es gibt Anlass zur Freude. Ich erbe alle Vorzüge der Moderne (Hygiene, Ferien, Narkosemittel, Leselampen, Apfelsinen im Winter) und lebe in einer privilegierten Gegend dieses Planeten, im wohlgenährten, seuchenfreien Westeuropa. Das alte Europa, verkalkt und überwiegend altersmilde, von den eigenen Geistern heimgesucht, wehrlos gegen Brutalität und Tyrannei, seiner selbst unsicher und zugleich ersehntes Ziel Millionen Leidender. Meine unmittelbare Umgebung wird indes nicht das unbeschwerte Norwegen sein – meine erste Wahl schon wegen des gewaltigen Staatsfonds und der großzügigen Sozialleistungen. Auch nicht Italien, wegen der Küche und des sonnengebadeten Verfalls meine zweite Wahl. Nicht einmal die dritte Wahl {13}wird es sein, Frankreich mit seinem Pinot Noir und dem sorglosen Selbstbewusstsein seiner Bewohner. Stattdessen werde ich in einem ganz und gar nicht Vereinigten Königreich leben, regiert von einer allseits verehrten, betagten Queen, in welchem der Prinz – bekannt für seinen Geschäftssinn, seine guten Werke, seine Elixiere (Blumenkohlsud zur Reinigung des Blutes) und seine verfassungswidrigen Einmischungen – ungeduldig auf die Krone wartet. Dies wird meine Heimat sein, und sie wird genügen. Ich hätte auch in Nordkorea zur Welt kommen können, wo die Thronfolge zwar ebenso unangefochten ist, Freiheit und Essen aber zu wünschen übriglassen.
Wie kommt es, dass ich, der ich noch nicht einmal jung bin, noch nicht einmal von gestern, so viel weiß, oder doch genug weiß, um mich in so vielem irren zu können? Ich habe meine Quellen, ich lausche. Trudy, meine Mutter, hört, wenn sie nicht mit ihrem Freund Claude zusammen ist, gern Radio und lieber Wortbeiträge als Musik. Wer hätte in den Anfängen des Internets den unaufhaltsamen Aufstieg des Radios vorhergesehen? Oder die Renaissance des archaischen Wortes ›drahtlos‹? Über den Waschmaschinenlärm von Magen und Gedärm hinweg höre ich Nachrichten, diesen Born aller bösen Träume. Ein Drang zur Selbstkasteiung lässt {14}mich aufmerksam alle Analysen, jeden Widerspruch verfolgen. Stündliche Wiederholungen und halbstündliche Kurzfassungen langweilen mich nicht. Ich dulde sogar den BBC World Service mit seinen infantilen Fanfaren – synthetische Trompeten und Xylophone – zwischen den einzelnen Beiträgen. In so mancher langen, ruhigen Nacht habe ich meiner Mutter einen heftigen Tritt verpasst. Sie wurde wach, konnte nicht wieder einschlafen und tastete nach dem Radio. Grausam, ich weiß, aber am Morgen waren wir beide besser informiert.
Außerdem hört sie sich mit Vorliebe Podcasts an: Hörbuch-Ratgeber – Werde Weinkenner in fünfzehn Folgen –, Biographien von Dramatikern des siebzehnten Jahrhunderts oder Klassiker der Weltliteratur. Bei James Joyces Ulysses schläft sie ein, obwohl ich hell begeistert bin. Und wenn sie sich Kopfhörer aufsetzt, vernehme ich jedes Wort noch klarer und deutlicher, so gut werden Schallwellen durch Kieferknochen und Schlüsselbein übertragen, hinab durch ihr Skelett und zügig weiter durchs nährende Fruchtwasser. Selbst das Fernsehen entfaltet den Großteil seines bescheidenen Nutzens durch Schall. Und manchmal, wenn sich meine Mutter mit Claude trifft, reden sie auch über den Zustand der Welt, beklagen ihn zumeist, obwohl sie planen, zu seiner Verschlechterung {15}beizutragen. In meiner Wohnstatt, in der mir nichts weiter bleibt, als an Körper und Geist zu wachsen, nehme ich alles wahr, selbst Triviales – und davon gibt es reichlich.
Denn Claude ist ein Mann, der es liebt, sich zu wiederholen. Ein Mann der immerselben Leier. Schüttelt er einem Fremden die Hand, sagt er – zweimal schon hab ich’s gehört – »Claude, wie in Debussy«. Doch er irrt. Er ist Claude wie in Bauunternehmer, ein Mann, der nichts erfindet, nichts komponiert. Gefällt ihm ein Gedanke, spricht er ihn laut aus, denkt er ihn später noch einmal, spricht er ihn wieder aus – warum auch nicht? Die Luft mit seinem Gedanken ein zweites Mal in Schwingung zu versetzen, bereitet ihm Vergnügen. Er weiß, dass jeder weiß, dass er sich wiederholt. Nur weiß er nicht, dass andere es nicht so toll finden wie er selbst. Aus einer »Reith Lecture« der BBC habe ich gelernt, dass man so was ein Referenzproblem nennt.
Hier ein Beispiel für Claudes Art zu reden und auch dafür, wie ich Informationen sammle. Meine Mutter und er haben sich am Telefon (ich höre beide Seiten) für den Abend verabredet. Ein Essen à deux bei Kerzenschein – wie so oft zählen sie mich nicht mit. Woher ich das mit dem Kerzenschein weiß? Als es so weit ist und sie zu ihrem {16}Platz geführt werden, höre ich, wie meine Mutter sich beklagt. Überall brennen die Kerzen, nur nicht an unserem Tisch.
Der Reihe nach folgen: ein verärgertes Luftschnappen von Claude, ein herrisches Schnippen trockner Finger, serviles Gemurmel, wie es ein vermutlich vornübergebeugter Kellner von sich gibt, das Ratschen eines Feuerzeugs. Und schon haben sie ihren Kerzenschein. Fehlt nur noch das Essen. Die schweren Speisekarten liegen jedoch bereits auf ihrem Schoß – quer über mein Kreuz kann ich den unteren Rand von Trudys Karte spüren. Und erneut muss ich mir Claudes abgedroschene Kommentare zur Speisekarten-Prosa anhören, als wäre er der Erste, dem diese belanglosen Abstrusitäten auffielen. Er regt sich über ›in der Pfanne gebraten‹ auf. Was ›in der Pfanne‹ hier anderes sei als eine weihevolle Verneblung des vulgären und ungesunden ›gebraten‹? In was bitte solle man Jakobsmuscheln mit Chili und Zitronensaft denn sonst braten? In einer Eieruhr? Ehe er fortfährt, wiederholt er dieses oder jenes mit unterschiedlicher Emphase. Und dann sein zweiter Hassliebling: ›fangfrisch‹. Stumm formen meine Lippen seine Erläuterungen, ehe er auch nur ansetzt, als mir eine leichte Neigung meiner vertikalen Achse verrät, dass Trudy sich vorbeugt, um einen beschwichtigenden {17}Finger auf sein Handgelenk zu legen und ihn in liebenswürdigem, ablenkendem Ton zu bitten: »Such doch bitte den Wein aus, Darling. Einen guten Tropfen.«
Ich teile mir gern ein Glas Wein mit meiner Mutter. Womöglich haben Sie es längst vergessen oder auch nie erlebt, wie herrlich ein durch die Plazenta dekantierter Burgunder schmeckt (die mag sie am liebsten) oder ein Sancerre (mag sie ebenfalls). Noch ehe der Wein zu mir fließt – heute Abend ein Sancerre von Jean-Max Roger –, spüre ich auf dem Gesicht, kaum wird der Korken gezogen, die Liebkosung einer Sommerbrise. Ich weiß, dass Alkohol meiner Intelligenz schadet. Er schadet jedermanns Intelligenz. Aber ach, ein wonniger, die Wangen rötender Pinot Noir, ein stachelbeeriger Sauvignon lassen mich durchs inwendige Meer taumeln und purzeln, bis ich gegen die Wände meines Schlosses kugle, dieser Springburg, in der ich hause. Zumindest war das so, als ich noch Platz hatte. Jetzt genieße ich bedächtig, allein beim zweiten Glas wuchern die Spekulationen mit der wilden Kraft der Poesie. Meine Gedanken sprudeln in gedrechselten Blankversen, mal im strengen Zeilenstil, mal mit Enjambements, immer hübsch abwechslungsreich. Nie aber gönnt sich meine Mutter ein drittes Glas, und das kränkt mich.
{18}»Ich muss an das Baby denken«, höre ich sie sagen, während sie tugendsam eine Hand übers Glas legt. Das ist der Moment, in dem ich am liebsten an meiner öligen Schnur zerren würde, wie man in einem herrschaftlichen Landhaus die Samtkordel an der Wand zieht, um prompte Bedienung zu verlangen. Noch eine Runde für uns Freunde! Aber dalli!
Doch nein, aus Liebe zu mir hält sie sich zurück. Und ich liebe sie auch – wie könnte ich anders? Die Mutter, der ich noch nie begegnet bin, die ich nur von innen kenne. Nicht genug! Ich sehne mich danach, ihr Äußeres zu sehen, denn auf den Anschein kommt es an. Ich weiß, dass ihr Haar »strohblond« ist und in »wilden Locken wie lauter Münzen« auf Schultern »weiß wie Apfelblüten« fällt, denn in meinem Beisein hat mein Vater ihr ein Gedicht vorgelesen, das er darüber verfasste. Claude pries gleichfalls ihr Haar, wenn auch mit weniger gewählten Worten. Ist ihr danach, flicht sie sich die Locken in engen Zöpfen um den Kopf, genau wie Julija Timoschenko, sagt mein Vater. Ich weiß außerdem, dass die Augen meiner Mutter grün sind, dass sie eine Nase hat, winzig »wie ein Perlenknopf«, die sie zu klein findet, auch wenn beide Männer für ihr Näschen schwärmen und versuchen, sie in dieser Hinsicht zu beruhigen. Oft {19}hat man ihr gesagt, sie sei schön, doch bleibt sie skeptisch, was ihr eine unschuldige Macht über die Männer verleiht, zumindest hat mein Vater ihr dies eines Nachmittags in der Bibliothek gestanden. Sie erwiderte, falls er recht habe, sei es eine Macht, die sie nicht suche und nicht wolle. Es war ein ungewöhnliches Gespräch, und ich hörte aufmerksam zu. Mein Vater, er heißt John, sagte: Besäße er eine solche Macht über sie oder allgemein über Frauen, könnte er sich nicht vorstellen, je darauf zu verzichten. Eine Wellenbewegung, die mein Ohr kurz von der Bauchwand löste, verriet mir, dass meine Mutter energisch mit den Schultern zuckte, als wollte sie sagen: Männer sind also anders. Na und? Zudem erklärte sie laut, was immer sie angeblich an Macht besitze, sei nur, was Männer ihr in ihren Phantasien zuschrieben. Dann klingelte das Handy, mein Vater ging beiseite, um den Anruf anzunehmen, und dieses eigenartige, interessante Gespräch über Macht und jene, die sie haben, wurde nie fortgesetzt.
Doch zurück zu meiner Mutter, meiner ungetreuen Trudy, nach deren blütenweißen Armen, Brüsten und grünen Augäpfeln ich mich sehne. Ihre unerklärliche Leidenschaft für Claude ist älter noch als meine erste Wahrnehmung, mein frühestes Sein. Oft spricht sie mit ihm, und er mit ihr, {20}im Flüsterton, sei es im Bett, in der Küche oder im Restaurant, fast als fürchteten sie, ein Mutterbauch könnte Ohren haben.
Ich hielt das früher für nichts weiter als gewöhnliche, verliebte Intimität. Jetzt aber bin ich mir sicher. Sie schonen ihre Stimmbänder, weil sie Schreckliches planen, eine Tat, die, das hörte ich sie sagen, im Falle eines Fehlschlags ihrer beider Leben ruiniert. Sie meinen, wenn es ihnen ernst damit ist, sollten sie rasch handeln und bald. Sie ermahnen sich zu Ruhe und Geduld, erinnern einander daran, was sie ein Scheitern ihres Plans kosten würde, wiederholen, dass er aus mehreren Teilen besteht, die sich zusammenfügen müssen, und dass, sollte auch nur ein Detail misslingen, alles misslingt, »wie bei einer dieser alten Christbaum-Lichterketten« – ein unverständlicher Vergleich von Claude, der doch nur selten Rätselhaftes sagt. Was sie beabsichtigen, macht ihnen Angst und widert sie auch an, weshalb sie nie direkt darüber reden. Stattdessen flüstern sie Ellipsen, Euphemismen, murmeln Aporien, gefolgt von Räuspern und raschem Themenwechsel.
Letzte Woche, in einer heißen, ruhelosen Nacht, als ich dachte, beide schliefen längst, sagte meine Mutter plötzlich ins Dunkel – es war zwei Stunden vorm Morgengrauen, jedenfalls laut der Kaminuhr {21}unten im Arbeitszimmer meines Vaters: »Wir können das nicht tun.«
Worauf Claude gleich mit tonloser Stimme erwiderte: »Doch, das können wir.« Und nach einem Augenblick des Nachdenkens: »Wir können es.«
{22}2
Zu meinem Vater nun, John Cairncross, einem großen Mann, der zweiten Hälfte meines Genoms, dessen spiralförmige Schicksalswindungen für mich von größter Bedeutung sind. In mir allein verschmelzen meine Eltern auf immer, im Guten wie im Bösen vereint entlang zweier Zucker-Phosphat-Ketten, der Rezeptur meines ureigenen Ichs. Auch in meinen Tagträumen verquicke ich John und Trudy und möchte – wie jedes Kind getrennt lebender Eltern – die beiden wieder zusammenbringen, mein Basenpaar, auf dass die Begleitumstände zu meinem Genom passen.
Kommt mein Vater hin und wieder nach Hause, bin ich überglücklich. Manchmal bringt er Smoothies aus seinem Lieblingsladen in der Judd Street mit. Er hat eine Schwäche für dieses klebrig süße Zeug, das angeblich sein Leben verlängert. Ich weiß nicht recht, warum er uns besucht, da er uns stets in trauriger Stimmung wieder verlässt. Einige meiner Mutmaßungen erwiesen sich in der {23}Vergangenheit als falsch, doch habe ich aufmerksam zugehört und nehme vorläufig Folgendes an: dass er nichts von Claude weiß, dass er nach wie vor bis über beide Ohren in meine Mutter verliebt ist und hofft, eines Tages wieder mit ihr zusammenzuleben, und dass er immer noch die Geschichte glaubt, die sie ihm aufgetischt hat, derzufolge diese Trennung ihnen »Zeit und Raum« gebe, »sich zu entfalten« und ihre Bande aufs Neue zu stärken. Dass er ein erfolgloser Dichter ist, aber dennoch weitermacht. Dass er einen bettelarmen Verlag besitzt und leitet, der die ersten Werke heute bekannter Dichter herausgebracht hat, klingende Namen, darunter gar ein Nobelpreisträger. Werden sie berühmt, wechseln sie wie erwachsen gewordene Kinder zu größeren Verlagen. Dass er die Untreue der Dichter als eine Tatsache des Lebens hinnimmt und sich wie ein Heiliger freut, wenn sie gute Kritiken kriegen, die auch seine Cairncross Press legitimieren. Dass ihn das eigene Versagen als Dichter eher bekümmert als verbittert. Einmal hat er Trudy und mir einen Verriss seiner Gedichte vorgelesen. Darin hieß es, sein Werk sei überholt, zu steif, zu formell und zu ›schön‹. Die Lyrik aber ist sein Leben, immer noch trägt er meiner Mutter Gedichte vor, er lehrt Poetik, rezensiert Gedichtbände, fördert junge Dichter, sitzt in Preis-Jurys, rührt in {24}Schulen die Werbetrommel, schreibt Essays für kleine Zeitschriften und redet im Radio über Lyrik. In den frühen Morgenstunden haben Trudy und ich ihn einmal gehört. Er besitzt weniger Geld als Trudy, viel weniger als Claude. Er kennt über tausend Gedichte auswendig.
So weit mein Fundus an Fakten und Annahmen. Wie ein geduldiger Philatelist beuge ich mich über meine Sammlung, die ich vor kurzem um einige Neuheiten erweitern konnte. Mein Vater leidet an Psoriasis, einer Hautkrankheit, die seine Hände schuppig, ledrig und rot werden lässt. Trudy hasst ihren Anblick, mag sie nicht anfassen und sagt ihm, er solle Handschuhe tragen. Er weigert sich. Er hat einen sechsmonatigen Mietvertrag für drei schäbige Zimmer in Shoreditch abgeschlossen, hat Schulden, Übergewicht und sollte mehr Sport treiben. Erst gestern konnte ich meiner Sammlung – um im Briefmarken-Bild zu bleiben – eine Penny Black hinzufügen: Das Haus, in dem meine Mutter lebt und ich in ihr, das Haus, in das Claude allabendlich kommt, ist ein georgianischer Kasten an der protzigen Hamilton Terrace und war das Elternhaus meines Vaters. Mit Ende zwanzig – als er sich gerade den ersten Bart wachsen ließ, kurz nach der Hochzeit mit meiner Mutter – erbte er den Familiensitz. Seine geliebte Mutter war da schon lange {25}tot. All meine Quellen stimmen darin überein, dass das Haus eine Bruchbude ist. Nur Klischees werden ihm gerecht: verwohnt, heruntergekommen, baufällig. Frost überzieht im Winter die Vorhänge gelegentlich mit Rauhreif und lässt sie steif gefrieren, bei heftigem Unwetter schütten die Regenrinnen wie verlässliche Banken reichlich Rendite aus, und im Sommer stinken sie wie schlechte Banken zum Himmel. Aber seht hier, zwischen den Enden der Pinzette, mein seltenstes Stück, die British Guiana: Selbst in solch ruinösem Zustand kriegt man für diese elenden 550 Quadratmeter sieben Millionen Pfund.
Die meisten Männer, die meisten Menschen, würden es ihrem Ehepartner nicht gestatten, sie aus dem Haus ihrer Kindheit zu vertreiben. John Cairncross ist anders. Hier meine Schlussfolgerungen: Geboren unter gefälligen Sternen, bestrebt, es jedem recht zu machen, allzu freundlich, allzu ernst, fehlt ihm die stille Habgier ehrgeiziger Poeten. Er schreibt ein Gedicht zu ihrem Lob (zum Lob ihrer Augen, ihrer Haare, ihrer Lippen), kommt vorbei, liest es ihr vor und glaubt im Ernst, dass er sie damit umstimmen kann und sie ihn im eigenen Haus wieder willkommen heißen wird. Sie aber weiß, dass ihre Augen nicht wie »Galways Auen« sind, womit er wohl »sehr grün« meint, und {26}da in ihren Adern kein irisches Blut fließt, bleibt dieser Vers anämisch. Hören meine Mutter und ich meinem Vater zu, schlägt ihr Herz langsamer, und ich spüre, wie eine Kruste der Langeweile ihre Netzhaut überzieht, die sie blind für das Pathos dieser Szene macht – ein großer, großherziger Mann, der ohne alle Hoffnung in der altmodischen Form eines Sonetts um sie wirbt.
Tausend war vielleicht übertrieben. Viele Gedichte, die mein Vater kennt, sind allerdings so lang wie Die Feuerbestattung des Sam McGee und Das wüste Land, diese berühmten Werke zweier Bankangestellter. Trudy lässt weiterhin das eine oder andere Gedicht über sich ergehen. Ein Monolog von ihm ist ihr lieber als ein Streitgespräch, lieber als ein weiterer Rundgang durch den verkrauteten Garten ihrer Ehe. Vielleicht tut sie ihm den Gefallen, weil sie ein schlechtes Gewissen hat, wenn auch nur einen kargen Rest. Das Rezitieren von Gedichten gehörte früher wohl zu ihren Liebesritualen. Merkwürdig, dass sie ihm nicht gestehen mag, was er vermuten und sie ihm irgendwann doch sagen muss. Nämlich dass sie ihn nicht mehr liebt. Dass sie einen Liebhaber hat.
Am Radio erzählte heute eine Frau, wie sie einmal nachts auf einsamer Straße einen Hund überfahren hat, einen Golden Retriever. Im Licht der {27}Scheinwerfer hockte sie neben ihm, hielt die Pfote des sterbenden, in panischem Schmerz zuckenden Tieres, das sie aus großen braunen Augen bis zuletzt ansah, unverwandt, vergebungsvoll. Mit der freien Hand griff die Frau nach einem Stein und hieb damit mehrmals auf den Schädel des armen Hundes ein. Um John Cairncross zu erlösen, bräuchte es nur einen einzigen Schlag, einen coup de vérité. Stattdessen setzt Trudy, sobald er zu rezitieren beginnt, ihren gelangweilten Zuhörerblick auf. Ich aber lausche konzentriert.
Gewöhnlich gehen wir dafür in die Lyrik-Bibliothek im ersten Stock. Während er auf seinem üblichen Stuhl Platz nimmt, ist nur die klickende Unruh der Kaminuhr zu hören. Und hier, in Anwesenheit eines Dichters, lasse ich meinen Phantasien freien Lauf. Blickt mein Vater zur Decke auf, um seine Gedanken zu sammeln, sieht er wohl, wie sehr der klassizistische Stuck gelitten hat. Verfall lässt Gipsstaub wie Puderzucker über die Buchrücken berühmter Werke rieseln. Meine Mutter wischt den Sessel ab, ehe sie sich setzt. Ohne weitere Umschweife holt mein Vater Luft und beginnt. Er rezitiert flüssig und mit Gefühl. Die meisten modernen Gedichte lassen mich kalt, zu viel vom eigenen Ich, zu glasig-kühl der Blick auf andere, zu viel Gejammer in zu kurzen Zeilen. John Keats {28}und Wilfred Owen dagegen – wie eine brüderliche Umarmung. Ich spüre ihren warmen Atem auf meinen Lippen. Ihren Kuss. Wer wünschte sich nicht, er hätte »Kandierte Äpfel, Quitten, Pflaumen, Kürbis« geschrieben oder »Der Mädchen Blässe soll ihr Grabtuch sein«?
Ich stelle sie mir vor, sehe sie durch seine liebenden Augen, wie sie am anderen Ende der Bibliothek in dem großen Ledersessel sitzt, der noch aus dem Wien Sigmund Freuds stammt. Die schlanken, bloßen Beine hat sie anmutig untergeschlagen, ein angewinkelter Arm ruht auf der Lehne und stützt den Kopf, damit er nicht vornübersinkt; sacht trommeln die Finger der freien Hand auf ihrem Knöchel. Die Fenster stehen offen an diesem heißen späten Nachmittag, der Verkehr in St. John’s Wood ist kaum mehr als ein angenehmes Brausen. Ihre Miene wirkt nachdenklich, die volle Unterlippe hängt herab. Sie fährt mit makelloser Zunge darüber. Einige blonde Locken kleben feucht am Hals. Das Baumwollkleid, locker geschnitten, damit auch ich drunterpasse, ist blassgrün, blasser als ihre Augen. In ihrem schwangeren Leib arbeitet es unablässig, und Trudy ist müde, auf angenehme Weise müde. John Cairncross sieht die sommerliche Röte auf ihren Wangen, die entzückende Kontur von Hals, Schulter, geschwollenen Brüsten, {29}sieht jene hoffnungsvolle Wölbung, die ich bin, die von der Sonne unberührte Blässe ihrer Schenkel, die glatte Sohle eines nackten Fußes, die unschuldigen Zehen, aufgereiht von Groß nach Klein wie Kinder auf einem Familienfoto. Alles an ihr makellos, denkt er, durch ihre Umstände zur Vollendung gebracht.
Er merkt nicht, wie ungeduldig sie darauf wartet, dass er wieder geht. Wie pervers die Verbannung ist, die sie ihm in diesem, unserem dritten Trimester auferlegt. Ist er denn wirklich ein so bereitwilliges Werkzeug seines eigenen Untergangs? Ein derart großer Kerl, eins neunzig wie ich hörte? Ein Hüne mit mächtigen, schwarz behaarten Armen, ein Riesennarr, der es für klug hält, seiner Frau jenen ›Raum‹ zu geben, den sie angeblich braucht. Raum! Ich möchte sie mal hier drinnen sehen, wo ich kaum mehr einen Finger krümmen kann. Im Vokabular meiner Mutter ist ›Raum‹ und ihr Bedürfnis danach eine ungestalte Metapher, wenn nicht gar ein Synonym für Egoismus, Tücke und Grausamkeit. Doch halt, ich liebe sie, sie ist meine Göttin, und ich brauche sie. Ich nehme alles zurück! Die Verzweiflung sprach aus mir. Ich bin so verblendet wie mein Vater. Und es ist wahr, ihre Schönheit, ihre Unnahbarkeit und Entschlossenheit sind eins.
{30}Ich stelle mir vor, dass sich von der morschen Bibliotheksdecke plötzlich eine Wolke wirbelnder Staubpartikel löst, die aufschimmernd durch einen Sonnenstrahl driftet. Und auch Trudy selbst schimmert geradezu in dem rissigen braunen Ledersessel, in dem sich Hitler, Trotzki oder Stalin in ihren Wiener Tagen gerekelt haben mögen, als auch sie kaum mehr als Embryonen ihres künftigen Selbst waren. Ich bekenne, ich gehöre ihr mit Haut und Haar. Wenn sie es mir geböte, dann würde auch ich nach Shoreditch ziehen und im Exil aufwachsen. Eine Nabelschnur ist dafür nicht nötig. Mein Vater und ich sind in hoffnungsloser Liebe zu ihr verbunden.
All ihren Signalen zum Trotz – knappe Antworten, Gähnen, allgemeine Unaufmerksamkeit – bleibt er bis zum frühen Abend, vielleicht, weil er auf ein gemeinsames Essen hofft. Meine Mutter aber wartet auf Claude. Schließlich treibt sie ihren Mann mit den Worten aus dem Haus, sie müsse sich ausruhen. Sie bringe ihn noch zur Tür. Wie wollte man das Bedauern in seiner Stimme überhören, als er sich widerstrebend von ihr verabschiedet? Mich plagt der Gedanke, dass er jede Demütigung ertragen würde, nur um einige Minuten länger in ihrer Nähe bleiben zu können. Allein sein Naturell hindert ihn daran, das zu tun, was {31}andere vielleicht getan hätten – ihr voran ins Schlafzimmer zu gehen (jenes Gemach, in dem er und ich gezeugt wurden), sich auf dem Bett zu fläzen oder in die Wanne zu legen, umhüllt von üppigen Dampfwolken, dann ein paar Freunde einzuladen, Wein einzuschenken und Herr im eigenen Haus zu sein. Stattdessen hofft er, sein Ziel mit Freundlichkeit und selbstloser Rücksicht auf ihre Bedürfnisse zu erreichen. Ich hoffe, ich irre mich, doch fürchte ich, er wird gleich zwiefach scheitern, verachtet sie ihn doch für seine Schwäche, weshalb er mehr als nötig leiden wird. Seine Besuche finden kein Ende, sie laufen aus. In der Bibliothek hinterlässt er ein Echo nachhallenden Trübsinns, die Ahnung einer Gestalt, ein enttäuschtes Hologramm, das den Stuhl noch immer in Beschlag nimmt.
Nun nähern wir uns der Haustür, zu der Trudy ihn geleitet. Die diversen baulichen Verfallserscheinungen waren schon mehrfach Thema: Ich weiß, dass sich ein Scharnier aus dem Rahmen gelöst hat. Holzfäule verwandelte den Türsturz in gepressten Staub. Einige Fliesen fehlen, andere haben einen Sprung – georgianische Fliesen in farbenfrohem Diamantmuster, unmöglich zu ersetzen. Plastiktüten mit leeren Flaschen und schimmligen Lebensmitteln verdecken Lücken und Risse. Wo sie überquellen, hinterlassen sie am Boden die {32}Wahrzeichen häuslicher Verwahrlosung: Pappteller mit ekligem Ketchupblut, der Inhalt von Aschenbechern, herabbaumelnde Teebeutel gleich winzigen Kornsäcken, wie sie Mäuse oder Elfen horten mögen. Schon lange vor meiner Zeit hat die Putzfrau resigniert. Und Trudy weiß, es kann wohl kaum die Aufgabe einer Schwangeren sein, Mülltüten in hohe Tonnen zu wuchten. Dabei müsste sie bloß meinen Vater bitten, den Flur aufzuräumen, aber sie tut es nicht. Aus Haushaltspflichten leiten sich womöglich Haushaltsrechte ab. Und vielleicht heckt sie bereits eine clevere Geschichte darüber aus, wie er sie im Stich ließ. Claude bleibt in dieser Hinsicht ein Besucher, ein Außenstehender, auch wenn ich ihn sagen hörte, wenn man eine Ecke putze, zeige sich das restliche Chaos nur umso deutlicher. Trotz der Hitzewelle bin ich bestens gegen den Gestank geschützt. Meine Mutter klagt darüber beinahe jeden Tag, wenn auch fast schon gelangweilt. Dies ist nur ein Aspekt des häuslichen Verfalls.
Womöglich glaubt sie, ein Klecks Quark auf dem Schuh oder der Anblick einer kobaltblau verpelzten Orange vor der Fußleiste könnte die Abschiedszeremonien meines Vaters verkürzen. Sie irrt. Die Tür steht offen, er verharrt auf der Schwelle, sie und ich sind gleich vorn im Flur. In einer Viertelstunde erwartet sie Claude. Manchmal {33}kommt er früher. Also ist Trudy aufgeregt, doch fest entschlossen, müde auszusehen. Sie steht auf Eierschalen. Ein schmieriges Papierrechteck, in das einmal ein Klumpen ungesalzener Butter eingewickelt war, klebt unter der Sandale und hat ihre Zehen eingefettet. Davon wird sie Claude bald in launigem Ton erzählen.
Mein Vater sagt: »Hör mal, wir müssen wirklich miteinander reden.«
»Ja, aber nicht jetzt.«
»Wir schieben es nur immer weiter auf.«
»Ich kann dir nicht sagen, wie müde ich bin. Ich muss mich jetzt einfach hinlegen. Du hast ja keine Ahnung, wie das ist.«
»Natürlich, deshalb überlege ich ja auch, wieder hier einzuziehen, damit ich …«
»Bitte, John, nicht jetzt. Das hatten wir alles doch bereits. Ich brauche mehr Zeit. Nimm ein bisschen Rücksicht. Schließlich bin ich mit deinem Kind schwanger, schon vergessen? Jetzt ist wohl kaum die Zeit, an dich zu denken.«
»Es gefällt mir einfach nicht, dass du allein hier bist, wenn ich …«
»John!«
Ich höre ihn seufzen, als er sie so fest umarmt, wie sie es nur gestattet. Als Nächstes spüre ich, wie sie den Arm ausstreckt, um sein Handgelenk {34}zu fassen – wobei sie bestimmt darauf achtet, die hautkranke Hand nicht zu berühren –, wie sie ihn umdreht und sanft hinaus auf die Straße schiebt.
»Darling, bitte, jetzt geh …«