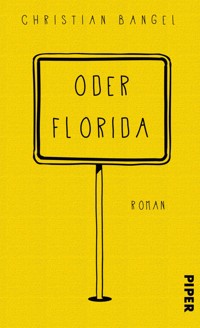
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Man kann alles erreichen, wenn man nur will - daran würde Matthias Freier, 20, so gerne glauben. Aber wenn er im Jahr 1998 in seiner Platte sitzt und auf seine Heimatstadt Frankfurt (Oder) blickt, weiß er nicht recht: Ist das der wilde Osten der unbegrenzten Möglichkeiten oder nur eine öde Brache, die fest in der Hand der Angst und Schrecken verbreitenden Nazis ist? Freiers Kumpel Fliege hat sich entschieden, sein und Freiers Schicksal in die Hand zu nehmen. Der Plan: die Frankfurter SPD durch organisierten Masseneintritt übernehmen. Das Wahlprogramm: endlich besseres Wetter für Frankfurt. Zur Sonne, zur Freiheit! Christian Bangel hat einen so humorvoll-nostalgischen wie scharfsichtig-visionären Roman geschrieben – denn wir alle sind Freier, und dabei doch kein bisschen frei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
ISBN 978-3-492-97765-4Oktober 2017© Piper Verlag GmbH, München 2017Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: FinePic®, MünchenDatenkonvertierung: psb, BerlinSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Für Lisa und Greta
Langsam wurde es peinlich. Zehn Fragen hatte ich auf dem Zettel, sieben hatte ich schon gestellt, nur drei hatte sie beantwortet. Wobei eine davon die gewesen war, wie es ihr gehe. Dieses große Interview, das ich all meinen Bekannten lange angekündigt hatte, es entwickelte sich zu einer riesigen Pleite.
Flieges Plan war eigentlich nicht schlecht gewesen: die bekannteste Frau Deutschlands, auf ihre subversive Art subversiv, Pornografie als stumme Selbstverständigung der Mettbrötchen-Deutschen. Das klang gut, wenn man es von Fliege hörte, der, Füße auf dem Schreibtisch, seinen Bleistift wie einen Taktstock schwang und die nächste Ausgabe unseres Stadtmagazins orchestrierte.
Aber jetzt, da ich Dolly Buster tatsächlich gegenübersaß, kriegte ich sie einfach nicht in die Falle. Ich war ungefähr der Zwanzigste, der sie in diesem öligen, engen Zelt befragte. Draußen waren es mindestens achtundzwanzig Grad, aus irgendeinem Grund stand das Backstagezelt in der prallen Sonne. Dolly Buster schien das besser abzukönnen als ich. Vielleicht, weil sie einen Bikini trug. Ich dagegen sah in meinem schwarzen Rollkragenpulli aus wie ein Schiedsrichter nach einem Fußballspiel um die Mittagszeit in Mexico City.
Dolly Buster war wieder ganz in die Computer Bild versunken. »Was kann Windows 98?«, stand in großen Lettern auf dem Titel. Sie schien echt interessiert, mehr jedenfalls als an meinen Fragen. Zehn Minuten blieben mir noch, um irgendetwas von ihr zu bekommen, was ich in der Redaktion abliefern konnte. Ich lehnte mich vor und sah ihr direkt in die Augen:
»Wie stehen Sie zu Helmut Kohl?«
Immerhin, ich schien sie überrascht zu haben. Sie schaute auf, sah mich forschend an und sagte nichts. Das war gut.
»Sag mal«, fragte sie, »bist du überhaupt Journalist?«
Was sollte das denn jetzt? Das ging ja wohl ziemlich unter die Gürtellinie. Sollte ich ihr meine Akkreditierung zeigen, oder was?
»Zeig mir mal deine Akkreditierung«, sagte Dolly Buster. Sie hatte wirklich diesen tschechischen Akzent, den man immer im Fernsehen hörte. Aber sie lächelte nicht. Und so, wie sie mich gerade anschaute, erinnerte sie mich eher an meine Mutter, wenn sie misstrauisch war, als an einen Pornostar. Das war wirklich albern. Ich kramte trotzdem den Zettel aus meiner Umhängetasche.
»0335«, las sie. »Bescheuerter Name.«
Ich schwieg. Sie ließ den Zettel sinken und sah mich unangenehm direkt an. »Dein wievieltes Interview ist das hier?«
»Mein drittes.«
Das stimmte sogar, wenn man Raiko mitzählte, den Discofascho aus Alt Zeschdorf. Sie wirkte nun etwas versöhnlicher. »Hör mal, wenn du gute Antworten von mir haben willst, kannst du mich nicht fragen, wie ich mich als Wichsvorlage der deutschen Trucker fühle.«
»Aber das ist provokant«, protestierte ich.
»Nein«, sagte Dolly Buster, »das ist blöd.«
Eigentlich hätte ich ahnen können, dass es so kommen würde. Zwei Stunden hatte ich im Backstagezelt auf Dolly Busters Manager gewartet, und als er endlich aufgetaucht war, wusste er meinen Namen nicht. Dabei konnte sogar ich ihn auf dem Zettel lesen, den er in der Hand hielt: »Freier, 0335, 12:45«. Ziemlich am Ende der Liste, unter Antenne Brandenburg. Doch der Manager hatte nur gesagt: »Du da. Bist in einer Dreiviertelstunde dran. Fünfzehn Minuten, keine Fotos.« Immerhin: Zeit genug, um das klebrige Zelt noch einmal zu verlassen und eine Runde über das Festgelände am Seeufer zu drehen.
Es war Samstagmittag, und schon jetzt war halb Frankfurt am See. Die Stadt verlor an jedem Sommerwochenende die Hälfte ihrer Bevölkerung, und diese Hälfte tauchte dann geschlossen an dem acht Kilometer entfernten See wieder auf. Zehntausende zwängten sich in ihre unklimatisierten Kompaktwagen, kurbelten die Fenster runter und spürten den Fahrtwind auf ihren Oberarmen. Sie überschritten das Tempolimit auf der B112, rochen schon bald nach dem Abzweig in Lossow den See. Sie parkten zwischen flimmernden Frontscheiben, trugen Sonnenöl auf und eilten auf dieses unfassbare Blau zu, das vor ihnen zwischen den Kiefern glitzerte.
Ein paar Dutzend Leute saßen jetzt auf den Bierbänken in Hörweite der großen Bühne. Heute Nachmittag war großes Programm. Der Regionalstar Frederic Rosmarin würde seine neue Single Bella Elena vortragen, außerdem war ein internationaler Stargast angekündigt. Morgen dann das große »Hau den Mercedes«.
Aber der eigentliche Star war der Helenesee. Er war so anders als die vielen Brandenburger Waldseen. Die Kommunisten hatten die alte Kiesgrube vor Frankfurt in den Sechzigern zum Erholungsgebiet ernannt und mit Wasser volllaufen lassen. Dabei war ihnen ein echtes Kunstwerk gelungen. An den Rändern gab es kilometerweit feinen weißen Sand, weshalb der See sofort »die kleine Ostsee« getauft worden war. Und das war kein bisschen übertrieben. Es gab sogar eine Strandpromenade.
Heute war Franziskus-Fest. Beziehungsweise Franziskus-Center-Hansa-Nord-Fest, aber wer nannte das schon so. Der Name änderte sich jedes Jahr, je nachdem, was Franziskus’ neuestes Großprojekt war. Zu meiner Schulzeit hatte es BMW-Franziskus-Fest geheißen. Später dann Beste-Jahreswagen-bei-Franziskus-Fest. Irgendwann hatte ich den Überblick verloren. Ich bekam nur mit, wie Mutti sich fürchterlich aufregte, weil Frankfurts Mogul in einem Zeitungsinterview verlangt hatte, dass das Fest auch offiziell Franziskus-Fest heißen sollte. Ich kapierte damals weder meine Mutter noch Franziskus. Das Ding hieß doch sowieso schon Franziskus-Fest.
»Herrgott und Maria«, seufzte Dolly Buster. »Deine Fragen werden wirklich immer noch dämlicher.«
Die beiden Typen hinter mir lachten laut auf. Sie arbeiteten fürs Stadtfernsehen und waren nach mir dran. Keine Ahnung, wer die hier reingelassen hatte. Anfangs glucksten sie nur, inzwischen hatten sie jede Scheu verloren.
»Zeig mir mal deine restlichen Fragen«, sagte Dolly Buster.
Das ging zu weit. Ich wollte eben keine blöden Fragen stellen. Ich wollte die Inszenierung Dolly Buster verstehen. Warum spielte sie nicht einfach mit?
»Nein, Frau Buster. Das ist ein Interview.«
»Das ist kein Interview«, sagte sie. »Und es wird auch keins mehr. Außer ich helfe dir. Also gib mir den Zettel.«
Die Fernsehtypen konnten nicht mehr vor Lachen.
»Was soll das?«, herrschte Dolly Buster die beiden an. »Ihr Knalltüten fliegt gleich raus.«
Und zu mir gewandt: »Nun gib schon her.«
Was sollte ich tun? Ohne Interview brauchte ich in der Redaktion nicht aufzutauchen. Dabei hatte ich endlich allen zeigen wollen, dass ich nicht nur deshalb schrieb, weil es in der Agentur keinen anderen gab, der den Job übernahm.
Ich gab ihr den Zettel. Dolly Buster legte ihr Magazin beiseite und las.
Okay, vielleicht hätte ich mich besser vorbereiten sollen. Aber am See war es nahezu unmöglich, einen ruhigen Ort zu finden, um meine Notizen noch einmal durchzugehen. Bis ganz nach hinten, wo der Wald anfing, nichts als rot-weiße Schirme und Badehandtücher. Oben auf der Promenade hatten sie Buden aufgebaut, zwischen denen sich die Leute drängelten. Es musste doch irgendwo einen Ort geben, an dem man Ruhe hatte vor der Franziskus-Kirmes. Ich wollte mich gerade auf ein Dixie-Klo zurückziehen, da hörte ich eine aufgekratzte Stimme hinter mir.
»Freier! Hierher!«
Fliege. Er stand zwischen Dutzenden Menschen hinter dem Tresen einer Bude, mit frisch gefärbtem pinken Iro und einem klaren Getränk in der Hand. Über ihm prangten auf einem weißen Schild die roten Lettern »MoSü«. Und darunter, etwas kleiner: »Masseneintritt organisieren – SPD übernehmen«. Hinter ihm hing ein Plakat, auf dem ein SPD-Logo mit flatternden Entenflügeln zu sehen war. Fliege winkte.
MoSü, wie das jetzt also hieß, war eine klassische Fliege-Idee. Ein bisschen krank, aber faszinierend und nicht komplett abwegig. Schon seit der Wende stellte die SPD in Frankfurt den Bürgermeister: Werner Krautzig, der Ewige. Gleichzeitig hatte der SPD-Ortsverband nicht einmal hundert Mitglieder, inklusive der Karteileichen. In zwei Monaten standen Wahlen an, und weil niemand in der Partei mit einem Gegenkandidaten rechnete, war die Kür kein großes Ereignis, sondern eine einfache Gremiensitzung, ein paar Wochen vor der Wahl. Fliege wollte durch einen organisierten Masseneintritt die Mehrheit im Ortsverband gewinnen und so den Kandidaten bestimmen können, der dann fast automatisch Bürgermeister werden würde.
Wir hatten in unserer Stammkneipe, dem Eastside, gesessen, als Fliege mir von seiner Idee erzählte. Nach jedem zweiten Satz schnippste er eine Pistazienschale in die Luft. Eine war in meinem Bier gelandet. Ich hatte auf die Schale geblickt, die wie ein kleines Boot auf hoher See in meinem Pils schwamm, und gegrinst. Nach zwei, drei Gläsern konnte man gut an Flieges Ideen glauben. Und es war schon mein viertes gewesen.
Seitdem war Fliege nur noch für das Projekt Bürgermeister zu sprechen. Im Eastside waren wir fast gar nicht mehr, ich war nicht mal dazu gekommen, ihm von Nadja zu erzählen. Wahrscheinlich hätte er eh nur ins Leere geschaut und irgendeine Alibinachfrage gestellt. Fliege war im Jagdmodus, alles hatte sich nur noch der Frage unterzuordnen, wie die Übernahme der Frankfurter SPD gelingen könnte.
Auch die Auswahl unserer Interviewpartner für die 0335stand inzwischen im Zeichen des politischen Kampfes. Fliege verlangte mehr Prominenz. Ich hatte Eißfeldt oder Tocotronic vorgeschlagen. »Kennt kein Schwein«, sagte Fliege. »Wir müssen jetzt in den Mainstream. Aber kritisch!«
So war es zu dem Plan gekommen, ein »feuilletonistisches Interview« mit Dolly Buster zu führen. Zitat Fliege.
An seinem Stand wurde er gerade von einer Gruppe alter Damen umringt. Fliege gab mir ein Zeichen, dass er mit mir reden müsse: »Ich brauch dich morgen im Sea Park«, sagte er. »Tisch ist reserviert. Freier, mach dich auf was gefasst!«
Ins Sea Park Cuisine? In diesen Nobelschuppen? Was wollten wir denn da? Doch Fliege hatte sich schon wieder unters Volk gemischt und tippte gegen sein Handgelenk. Ich tippte gegen meine Stirn und drehte mich um.
»Versau es nicht!«, rief er mir hinterher.
»So, und jetzt noch die Charity-Frage«, sagte Dolly Buster.
»Die was?«
Sie rollte mit den Augen. »In jedem anständigen Interview kommt am Ende was Soziales. Tierschutz, Kindern helfen, Hunger bekämpfen. So was. Also stell mir jetzt die Charity-Frage.«
Es nahm kein Ende. Sie hatte alle meine Fragen gestrichen und durch neue ersetzt: Würden Sie gern eine zweite Karriere als Schauspielerin beginnen? Fühlen Sie sich manchmal allein im Showbusiness? Ich hatte ihr trotzdem noch jede Frage vortragen müssen, damit es, wie sie sagte, authentisch wirke. Was für eine Demütigung.
Die beiden Kameratypen lachten nur noch manchmal, dafür schrieben sie jetzt permanent SMS. Wahrscheinlich wusste längst die ganze Stadt Bescheid.
»Tun Sie denn überhaupt etwas Soziales?«
»Du bist aber auch keine Hundertwattbirne, oder? Es reicht, wenn ich mich für etwas Soziales ausspreche. Du kannst dir also ein Thema einfallen lassen.«
Sie nahm wieder die Computer Bild zur Hand.
Na, guten Tag, dachte ich und überlegte. Es dauerte ein bisschen, aber dann hatte ich es.
»Finden Sie nicht auch, dass das Wetter besser sein könnte?«
Ich warf die Wohnungstür in Schloss, hängte die Tasche an den Nagel und zog den Rollkragenpulli aus. Die nasse Baumwolle blieb an meiner Nase hängen und klebte im Gesicht. Ich schmiss das Ding in die Ecke. Irgendwo musste noch eine Packung Eistee sein.
Meine Wohnung war eigentlich nur ein Zimmer auf Etage vier. Meine Eltern hatten nichts Billigeres für mich gefunden, als sie vor vier Jahren raus nach Güldendorf gezogen waren. Siebenundzwanzig Quadratmeter, die sich auf einen Raum, einen winzigen Flur und ein Klo verteilten. Trotzdem war die Bude perfekt. Direkt an der Grenze, Blick bis zum Oderturm. Bester Tribünenplatz. Alle, die unten in der Stadt unterwegs waren, kamen an meinem Hochhaus vorbei.
Im Kühlschrank war der Eistee nicht, überhaupt war der Kühlschrank ziemlich leer. Die Butter und der Frischkäse waren weg. Ich blickte mich im Zimmer um. Auf dem Tisch stand ein rotes Paket mit Weihnachtssternen, mein einziges Weinglas stand auf dem Fensterbrett, es waren Stiefmütterchen drin. Und jemand hatte »putzen« in den Staub auf den Bildschirm geschrieben. Meine Mutter war hier gewesen.
Auf dem Tisch, gleich neben Nadjas Brief, lag ein Zettel.
»Junge, ich hab dir ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Die verfallenen Sachen aus deinem Kühlschrank hab ich entsorgt. Umarmung, Mutti«. Und PS: »Denk dran, morgen ist Sonntag, da haben alle Geschäfte zu.«
Oh Mann. Ich musste einen Weg finden, ihr endlich den Wohnungsschlüssel abzunehmen. Ich riss am Paketband, wühlte in dem Paket. Oben lagen abgepacktes Brot und Kokosflocken, darunter Wattestäbchen und Walnüsse. Ich würde ihr irgendwie erklären müssen, warum ich den Schlüssel brauchte. Ein paar Äpfel und Dauerwurst. Ich biss in einen Apfel und schob ein Stück Salami hinterher.
Die Pakete waren leider wieder wichtig geworden, seit ich nicht mehr Zivi war. Was waren das für Zeiten gewesen. Wie Fliege und ich zusammen in der Agentur die 0335 entwickelt hatten. Unser eigenes Stadtmagazin, vierfarbig, Auflage zwanzigtausend. Nachts mit dem Taxi nach Hause, und bei Hunger einfach was bestellen. Und dafür gab es jeden Monat auch noch tausend Mark plus Miete vom Bundesamt für den Zivildienst. Das hatte Fliege genial gedeichselt.
Aus und vorbei, seit zwei Monaten. Man konnte seinen Zivildienst leider nicht verlängern. Klar machte ich weiter die 0335, aber was Fliege mir in der Agentur zahlte, reichte für die Miete und für wenig mehr. Obwohl Fliege meinen Satz schon verdoppelt hatte. Immerhin fand sich im Agentur-Kühlschrank immer irgendwas zu essen. Und auf jeden Fall war der Job besser, als in den Westen zu gehen oder Gurken zu ernten oder den ganzen Tag Schreibtisch und Telefon zu machen wie Mutti. Oder Bankkaufmann zu werden. Aus unserer Schulklasse hatten fünf Leute Bankkaufmann gelernt, und keiner von ihnen freiwillig. Jetzt saßen sie in ihrer Filiale und sahen aus wie die Auslegeware unter ihnen. Bevor ich Fliege und Nadja kennengelernt hatte, hatte ich überlegt, ob ich das auch machen sollte. Immer noch besser als Gurken ernten, dachte ich damals. Dann kam Fliege auf die Idee mit der 0335 und fragte mich, ob ich nicht Journalist für das Magazin werden wolle. Was für eine Frage. Leute wie Jan Carpentier und Ulrich Wickert hatte ich schon immer bewundert. So kritisch und mutig wollte ich auch sein.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























