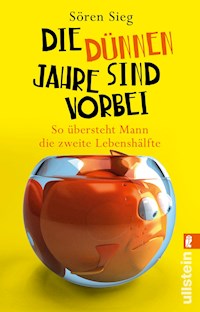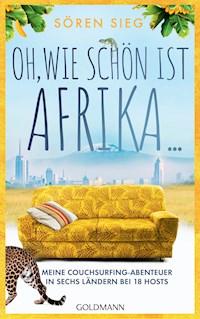
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Afrika ist vielleicht der Kontinent auf diesem Planeten, den wir in Europa am wenigsten kennen und verstehen. Bestsellerautor und Globetrotter Sören Sieg hat sich auf den Weg dorthin gemacht, Hotelzimmer gegen private Unterkunft getauscht und in sechs Ländern auf den Couches von achtzehn Gastgebern übernachtet. Auf Hochzeiten und Beerdigungen, in Tonstudios und Moskitoschwärmen, in abgelegenen Dörfern und lauten Megacitys hat er unzählige unglaubliche Geschichten erlebt und gehört. Lebendig berichtet er von afrikanischer Musik, neuen Freundschaften, halsbrecherischen Motorradtaxitouren auf der Gegenfahrbahn und Menschen, deren Energie, Witz, Optimismus und Mut ihresgleichen suchen. Ein vielschichtiger und gleichzeitig ernsthafter Reisebericht mit Einblicken in die Wohnzimmer und das Leben südlich der Sahara.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Ähnliche
Der Autor
Sören Sieg, geboren 1966, veröffentlichte bereits elf Bücher, darunter die SPIEGEL-Bestseller »Ich bin eine Dame, Sie Arschloch« und »Ich hab dich rein optisch nicht verstanden« mit Axel Krohn. Er tourte 18 Jahre lang mit dem A-cappella-Quartett LaLeLu durch Deutschland und schrieb die Kolumne »Schönen Sonntag!« im Weser-Kurier. Seine afrikanisch inspirierte Kammermusik feierte Premieren auf der ganzen Welt. Mit Frank Lüdecke schreibt er die Stücke für die Stachelschweine in Berlin. Er lebt als freier Autor und Komponist in Hamburg.
SÖREN SIEG
Oh,wieschönistAfrika…
MEINE COUCHSURFING-ABENTEUER IN SECHS LÄNDERN BEI 18 HOSTS
Dieses Sachbuch schildert meine persönliche Geschichte und beruht auf Erfahrungen, Erlebnissen und Aufzeichnungen. Ich gebe hier meine persönliche Sicht wieder, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Alle Informationen und Angaben in diesem Buch wurden vom Autor sorgfältig erwogen und geprüft.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe Juli 2022
Copyright © 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2022 by Sören Sieg
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München,
unter Verwendung von Fotos von © Sören Sieg und Motiven von © FinePic®, München
MP · Herstellung: CF
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
978-3-641-27620-1
www.goldmann-verlag.de
Inhalt
Inhalt
Vorwort
Derandere Planet
1. Der weiße Wurm
2. Nairobbery
3. »Dann lassen sie die Leute nachts verschwinden.«
4. Der Wille des Schöpfers
5. Picasso und Sane Wadu
6. Der Preis des Brautpreises
7. »Möchtest Du eine Frau? Oder zwei?«
8. Hunger
9. Der geschiedene Vater
10. Im Haus des Friedens und im Dorfmuseum
11. Die Ngoni, die kein Ngoni spricht
12. Die Künstlerkolonie
13. Indisches Karma
14. Kimmys Geburtstag
15. Nummer Einundzwanzig
16. Karaoke in der Matwiga Bar
17. Sieben Schläge für ein Vergehen
18. Auf Gras gebaut
19. »Du hast keine Ahnung, wie das für mich war!«
20. Virtual reality und die 37-Stundenkilometer-Bahn
21. Schweinefleisch mit Banane und ein zerquetschter Lastwagen
22. Marathon ohne Masken
23. Zuckerrohrschnaps im Europa Afrikas
24. Albtraum Fernbus
25. Wunderschön ist die Insel
26. Maui in der Hölle
27. Die Schildkrötenretterin
28. »Mehr kann ich nicht tun.«
Nachwort: Was Afrika für mich ist
Danksagung
Vorwort
Als ich im Januar und Februar 2016 durch Äthiopien, Uganda, Südafrika und Ghana reiste, hatte ich keine Ahnung, dass ich einmal dieses Buch schreiben würde. Ich führte aber damals schon minutiös Tagebuch, fotografierte und machte Videos in dem sicheren Gefühl, etwas Einmaliges zu erleben, besonders wegen meiner gewählten Reisemethode: dem Couchsurfing. Auch als ich im August 2018 mit meinem Sohn Uganda bereiste und im Oktober erneut dorthin flog, wusste ich noch nichts von diesem Buchprojekt. Aber als ich zu Hause von diesen Reisen und meinen Gastgebern erzählte, wollten alle hören, wie es mir in Afrika ergangen war. So auch Nina, meine Agentin, die mich nachdrücklich darum bat, ein Buch darüber zu schreiben. Und so machte ich weiter mit dem Couchsurfing: im Mai 2019 in Kenia und im Februar und März 2021 in Tansania. Ich wollte noch weiter nach Sambia, Ruanda, Burundi und Malawi, aber im Zuge der Corona-Pandemie waren die Grenzen geschlossen worden. Aus meinen Aufzeichnungen ist dieses Buch entstanden. Es geht darin um meine Reisen, meine Eindrücke, vor allem aber um meine wunderbaren afrikanischen Gastgeber: ihr Leben, ihren Alltag, ihre Geschichten, ihre Sicht auf die Welt. Ich gebe sie so genau und wahrheitsgetreu wie möglich wieder. Es ist mir eine Ehre, ihre Geschichten erzählen zu dürfen.
Ich verzichte explizit darauf, ihre Erzählungen zu bewerten, einzuordnen, zu überprüfen oder zu korrigieren. Ich möchte nicht der Weiße sein, der es »besser weiß« – und dabei vielleicht nur wieder eigenen Vorurteilen oder Wunschdenken zum Opfer fällt. Ich hörte zu und gebe nun wieder – so unvoreingenommen wie möglich, ein teilnehmender Beobachter. Ich übernehme auch die Wortwahl meiner Gastgeber. Dabei ist es manchmal herausfordernd, eine sinnvolle und korrekte Übersetzung zu finden: Tribe beispielsweise kann man mit Stamm, Volksgruppe, Ethnie oder Volk übersetzen – und jeder dieser Begriffe lädt zu Missverständnissen ein. Daher habe ich es beim Originalbegriff belassen. Dasselbe gilt für Chief of Tribe: »Häuptling« klingt nach Karl May, »politischer Führer einer ethnischen Minderheit« nach einer Parodie. Auch das Wort Muzungu lässt sich kaum übersetzen. So werden Weiße in Ostafrika von Einheimischen auf der Straße angesprochen (in Äthiopien als ferengi, in Ghana als obroni). Ursprünglich heißt Muzungu »sinnloser Wanderer« – weil die Afrikaner sich darüber wunderten, was die weißen Forschungsreisenden eigentlich in ihre Gegend verschlug.
Und obwohl es in Afrika Tausende von Sprachen und Tribes gibt, haben meine afrikanischen Gesprächspartner durchgehend von Africa gesprochen und darüber philosophiert. Man kann das als Verallgemeinerung kritisieren, und die Kritik ist berechtigt. Aber man kann nicht in Abrede stellen, dass sich die Menschen vor Ort als Afrikaner verstehen. All models are wrong but some are useful, sagen die Engländer.
Ich möchte an dieser Stelle betonen, trotz meines Soziologie- und Geschichtsstudiums und der Lektüre vieler Bücher über Afrika: Dies ist keine wissenschaftliche Forschungsarbeit! Ich bin nicht nach Afrika gereist, um bestimmte Hypothesen zu überprüfen oder zu beweisen. Sondern weil ich neugierig war, weil ich die Musik liebe, die Menschen und ihre Mentalität. Deswegen habe ich mich auch für Couchsurfing entschieden. Auf keine andere Weise komme ich Menschen und ihrer Kultur so nahe. Dabei habe ich Außerordentliches erfahren, mehr als auf jedem anderen Kontinent: Schönes und Trauriges, Lustiges und Schreckliches, Skurriles und Bewegendes. Ich habe nicht nur andere Länder und Menschen kennengelernt – sondern auch mich selbst. Ich sah mich plötzlich von außen und begriff, wie sehr ich doch bin, was ich vielleicht gar nicht sein möchte: ein Muzungu. Und zwar ein Muzungu, der Afrika liebt, aber manchmal auch unter Afrika leidet. Beides gehört unauflöslich zusammen.
DeranderePlanet
Ich bin ein geborener Angsthase. Gerade mal 1,68 Meter groß, schmächtig und unsportlich, als Kind immer einen Kopf kleiner als meine Mitschüler, die mich zu ihrem Vergnügen schon mal in den Papierkorb steckten. Ich hatte Angst vor Hunden und Einbrechern, habe keinen Kampfsport gelernt, kann nicht mit Waffen umgehen, fürchte Schmerzen und gehe körperlichen Konflikten aus dem Weg. Ich bin sozusagen Pazifist aus Alternativlosigkeit. Aus Angst, jemanden zu verletzen, habe ich nie einen Führerschein gemacht und bin seit meinem achtzehnten Geburtstag Vegetarier. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich einmal in der Weltgegend landen würde, die die meisten Deutschen vor allem mit Gefahr verbinden, mit katastrophalen Straßen, geringer Lebenserwartung, unheimlichen Krankheiten, mit Moskitos und Malaria, wo Straßenbeleuchtung und fließendes Wasser eine Seltenheit sind, wo von Polizisten und Soldaten fast schon erwartet wird, dass sie sich unter Verweis auf ihre Bewaffnung etwas dazuverdienen, die Wahrscheinlichkeit also, dass ich mich dorthin trauen würde, für längere Zeit und abseits aller touristisch-westlichen Infrastruktur, war in etwa so gering wie, dass jener zu klein geratene Sohn eines Polizisten und einer Kellnerin aus einem bayerisch-österreichischen Grenzdorf 2005 der erste deutsche Papst seit 500 Jahren wurde. Wie konnte es nur dazu kommen?
Diese Geschichte beginnt 1984 mit der CD African Marketplace von Dollar Brand, einem schwarzen Pianisten aus Südafrika. Ich spiele Klavier und komponiere, seit ich fünf bin, ich liebe die Melancholie Chopins, das Pathos Beethovens und Schuberts Wehmut, aber diese Musik, Dollar Brand, hat mich mitten ins Herz getroffen. Diese unbedingte Energie, dieses Ja zum Leben, dieser Enthusiasmus, darin habe ich mich wiedererkannt. Hier war endlich Musik, die meinem Lebensgefühl entsprach: wild, emotional, hemmungslos positiv, vor Freude übersprudelnd. Meine Liebe zu Afrika begann also als Fernbeziehung: Ich hörte afrikanische Musik und begann wenige Jahre später, Musik für klassische Ensembles zu komponieren, die von diesem Geist inspiriert war. Aber im Traum wäre ich nicht auf die Idee gekommen, selbst dorthin zu reisen.
Und dann kam Couchsurfing. Eine klassische Subkultur: Obwohl die meisten noch nie davon gehört haben, sind allein in Deutschland über 1,2 Millionen Gastgeber bei Couchsurfing.com registriert. Sie nehmen kostenlos Reisende bei sich zu Hause auf – für eine Nacht, eine Woche oder sogar länger. »Wir hatten diesen Christoph, er kam auch aus Deutschland, so wie du«, erzählt Ruth, meine Gastgeberin in Naivasha, Kenia. »Er wollte nur einen Monat bleiben. Am Ende blieb er zwei Jahre – und heiratete ein Mädchen hier aus dem Dorf. Inzwischen leben die beiden in Deutschland.«
Ich selbst begann 2012 damit, Couchsurfer aus aller Welt in meiner Hamburger Wohnung aufzunehmen: einen Opernsänger aus Sydney, ein Filmemacherpärchen aus Sankt Petersburg, eine wanderlustige Chinesin, eine Konzertpianistin aus Südkorea, eine nach Indien ausgewanderte französische Fotografin, eine ehrgeizige Geigerin aus Spanien, eine türkische Liedermacherin, eine vor Energie sprühende Körpertherapeutin aus der Schweiz.
Und viele, viele mehr. Und dann war da Douglas, ein amerikanischer Christ, der über zehn Jahre Entwicklungshilfe in Afrika geleistet hatte. Wir tranken Kaffee, liefen um die Alster, aßen Kaiserschmarrn im Cliff, und Douglas erzählte mir von seiner Zeit in Tansania. Das ist dieser magische Moment beim Couchsurfing: Zwei Wildfremde begegnen sich, öffnen einander ihr Herz, erzählen sich ihr Leben. Als hätte man beim Schicksal ein Los gezogen. Der Zauber funktioniert fast immer: Man hat sich einander anvertraut. Also vertraut man einander. Und gibt sich preis. Das ist etwas anderes als ein Smalltalk mit einem Kellner, einem Tourguide oder einem Sitznachbarn im Zug. Es geht immer ums Ganze.
Zehn Jahre hatte Douglas in einer abgelegenen Gegend Tansanias verbracht. Ein Engländer spendete seinem Dorf eine ganze Bibliothek und eröffnete sie feierlich. »Das war bestimmt gut gemeint«, erzählt Douglas. »Aber es waren lauter englische Bücher. Und dort kann niemand Englisch. Wenn überhaupt, dann Kiswahili.« Douglas zeigte den lokalen Künstlern, welche Art von Kunst die Touristen mögen und wie man sie im Netz präsentieren könnte. Er hatte einen Waisenjungen von der Straße aufgelesen und adoptiert und ein Musik- und Tanzfestival ins Leben gerufen, das zu internationaler Berühmtheit gelangte und sich vor Besuchern nicht retten konnte. Leider ging das Festival ein, sobald er in die USA zurückgekehrt war.
Und während Douglas erzählte und erzählte, pflanzte er in mein Herz den Traum, endlich den Kontinent zu bereisen, auf den ich mich nie getraut hatte. Denn obwohl er zehn Jahre dort gelebt hatte, saß er jetzt vor mir und aß Kaiserschmarrn, ohne Narben, Prothesen und Augenklappe. In dem Moment wusste ich: Die Zeit der Ausreden und Ängste ist vorbei. Ich muss nach Afrika.
Und so machte ich mich – trotz der panikartigen Warnungen meiner Freunde und meiner Familie – auf meine erste, große Afrikareise im Januar und Februar 2017. Sie führte mich durch Äthiopien, Uganda, Südafrika und Ghana. In Addis Abeba, Kampala und Accra meldeten sich über fünfzig Couchsurfing-Gastgeber, die mich unbedingt eine Woche bei sich aufnehmen wollten. »Ich habe noch nie mit einem Weißen gesprochen«, schrieb mir ein Gastgeber in Kampala, »ich möchte dich unbedingt hosten!« Was ich davon zu Hause erzählte, beeindruckte meinen Sohn so sehr, dass wir 2018 zusammen vier Wochen durch Uganda reisten. 2019 couchsurfte ich durch Kenia und 2021, mitten in der Pandemie, fünf Wochen durchs restriktionsfreie Tansania, eine fast surreale Erfahrung.
Ich bin also Wiederholungstäter. Mich zieht es immer wieder auf den Kontinent. Das hat zum einen mit mir persönlich zu tun. Für mitteleuropäische Verhältnisse rede ich nämlich zu laut und zu hektisch, lache zu wild und umarme Menschen zu schnell. In Afrika bin ich damit eher etwas unter dem Durchschnitt. Dort fällt dieses Verhalten nicht weiter auf: Wenn ich Afrikanern diese Geschichte erzähle, lachen sie überrascht. Sie rechnen nicht damit, dass ein Weißer etwas Selbstironisches erzählt. Aus ihrer Sicht sind wir Menschen, die nicht zu leben verstehen: kein Spaß, kein Tanz, keine Party, kein Sex, keine Religion, keine Tradition, keine Kinder. Nur Geld und Karriere. Armer Muzungu!
Nach Afrika zu reisen ist auch eine Art Reality Check. Ein anderer Planet. Bei uns zahlt man sechzig Euro Strafe, wenn man bei einer leeren Straße über eine rote Ampel geht. Dort gibt es kaum Ampeln. Wir beklagen uns über die Verspätungen der Deutschen Bahn. Dort gibt es fast keine Züge. Bei uns kann man fast kostenlos studieren, dort nehmen sogar die Grundschulen Gebühren (die sich keineswegs alle leisten können). Dort stellen sich die Menschen, die ich treffe, mit ihrem Namen und ihrem Tribe vor, und beim Einchecken im Hotel muss ich angeben, zu welchem Tribe ich gehöre. Bei uns bringen Eltern ihre Kinder zum Ballett, zum Fechten und zum Klavierunterricht, dort laufen die meisten Kinder in großen Gruppen durch die Gegend, ohne einen Erwachsenen in Sichtweite. Bei uns hat der Pfarrer Mühe, die wenigen Gottesdienstbesucher zum Singen zu motivieren, dort kann ein überfüllter Gottesdienst nach fünf Stunden wegen Lärmbelästigung von der Polizei beendet werden. Bei uns kosten fünfzehn Minuten Taxifahren fünfundzwanzig Euro, dort zahle ich für eine ähnliche Strecke auf dem Motorradtaxi dreißig Cent, und der Fahrer gestikuliert mit einer Hand oder sogar beiden Händen, während er im Stockdunkeln ohne Helm eine Schotterpiste entlangrast. Bei uns wird der Müll getrennt und zwei Mal die Woche abgeholt, dort sammelt er sich am Strand, am Stadtwald, neben Häusern oder auch mitten auf dem Gemüsemarkt in spontanen Haufen, die niemand wegräumt. Bei uns heiratet man, weil man sich dazu entschieden hat, dort muss man der Familie der Frau einen Brautpreis zahlen – in Höhe von mehreren Jahreseinkommen. Bei uns bekommt man für einen Ladendiebstahl eine kleine Bewährungsstrafe, dort kann man mit ein wenig Pech für ein geklautes Huhn zehn Jahre ins Gefängnis wandern. Wir verdienen im Schnitt ein paar Tausend Euro im Monat, Ugander und Tansanier verdienen zwischen 400 und 600 Dollar im Jahr. Das ist für sie völlig normal. Und meistens tragen sie trotzdem schickere Schuhe als wir.
Das Improvisationstalent kennt keine Grenzen. Holzbrettbuden dienen als Läden, Wellblechhütten als Kirchen, Wassereimer als Dusche, ein Loch im Boden als Toilette, eine nackte, schwache Glühbirne als Wohnzimmerbeleuchtung und zerbeulte, uralte Kleinbusse (»Matatus«) als Hauptverkehrsmittel. Es sind Lebensumstände, die viele von uns als widrig und deprimierend empfinden – und wenn zwei Muzungus in Afrika aufeinandertreffen, reden sie sehr bald darüber, wie man die Dinge dort verbessern könnte. Aber dann gibt es eben das, was ich das afrikanische Paradox nenne: Wir sind diejenigen, die eher Grau und Schwarz tragen, ihre Kleider sind bunt. Unsere Lieder sind traurig, ihre fröhlich; wir leiden unter Depressionen und schlechter Laune, sie sprühen vor Energie und Selbstironie; wir sehen das Ende der Welt nahen, sie bersten vor Optimismus. Man verzeihe mir diese fürchterlichen Verallgemeinerungen. Aber der Kontrast ist so offenkundig, so spürbar, so allgegenwärtig wie der zwischen europäischem Einzelkind und afrikanischer Großfamilie, zwischen hochmodernem ICE und zerbeultem Matatu, zwischen ekstatischem Gesang und leise gemurmeltem Vaterunser. Ich liebe diese Energie. Ich versuche, sie in meiner Musik einzufangen. Ich wünsche mir mehr davon bei uns.
Es geht in diesem Buch, vielleicht sollte ich das gleich zu Beginn betonen, nicht um die Serengeti, die Big Five, den Regenwald und die Wüste. Safari-Tourismus ist teuer. Ich hatte gar nicht das Geld für Naturparks, Lodges und Guides. Es geht weder um Tiere noch um Hilfsprojekte, und erst recht nicht darum, wie man »Afrika entwickeln« kann, was auch immer das heißen mag.
Es geht um Joy aus Nairobi und Sandeep aus Daressalam, um Racheal aus Mbale und Sophie aus Accra, um Steven aus Moshi und Mutalemo aus Arusha, um die Polizistin Tinna, die Anwältin Xaveria, den Pastor Geoffrey, den Kunstmaler Sane Wadu und die Katzenretterin Shara Khamis, um all die wunderbaren Gastgeber und Gastgeberinnen, die mich in Äthiopien, Kenia, Uganda, Tansania und Ghana aufgenommen, die ihr Leben und ihre Lebensgeschichten mit mir geteilt haben.
Afrika ist für viele vor allem ein Spiegel ihrer Wünsche. Entweder suchen wir jemanden, dem wir helfen, den wir retten können: das schwarze Kind mit den großen, traurigen Augen. Oder wir sehnen uns nach dem unverfälschten, ursprünglichen Leben, dem Paradies auf Erden, den Jägern im Urwald. Was dabei unter den Tisch fällt, ist Afrika selbst. Die Menschen, ihre Geschichten, ihre Ideen, ihre Kultur. Davon möchte ich hier erzählen.
1.DerweisseWurm
Nairobi ist die Hauptstadt von Kenia und hat fünf Millionen Einwohner – aber vermutlich viel mehr. Schon vor vier Millionen Jahren siedelten hier, am ostafrikanischen Grabenbruch, die ersten Menschen. Heute ist Kenia die sechstgrößte Wirtschaft südlich der Sahara und hat die viertmeisten Touristen Afrikas – nach Südafrika, Simbabwe und der Elfenbeinküste. Tansania ist deswegen neidisch auf Kenia, aber dazu später. Im Schnitt bekommen kenianische Frauen heute vier Kinder, zweiundvierzig Prozent der Bevölkerung sind jünger als fünfzehn Jahre alt.
Von 1895 bis 1963 war Kenia von den Briten besetzt, die den Bewohnern das Land raubten, sie in Reservate abdrängten, später in großem Umfang internierten und den Mau-Mau-Aufstand blutig niederschlugen. 1963 wurde Jomo Kenyatta erster Präsident des unabhängigen Kenia, seine Familie wurde in den Folgejahren zur reichsten des Landes, politische Gegner ließ er einsperren und töten. Heute prangt Kenyatta auf jeder Münze und jedem Geldschein, jede zweite Straße ist nach ihm benannt, und sein Sohn Uhuru Kenyatta ist der vierte Präsident des Landes. TIA sagen meine Gastgeber dazu, das geläufige Kürzel für: This is Africa!
Joy war eine der Ersten, die sich auf meine Anfrage für Nairobi auf Couchsurfing meldete. Sie ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern, hat dunkelbraune Haut, offene, freundliche Augen und eine angenehme Stimme. Sie trägt dichte, in der Mitte gescheitelte, lockige Haare, ist vierundvierzig Jahre alt, sieht aber eher aus wie Mitte dreißig, und wohnt in Umoja, einem östlichen Vorort von Nairobi, in dem es seit Monaten kein fließendes Wasser gibt, selbst jetzt nicht, wo die heftigen Regenfälle eingesetzt haben. Ich treffe sie mittags vor ihrem Haus, direkt gegenüber dem weitläufigen Gelände der Deliverance Church – einer Kirche, von der ich noch nie gehört habe, die hier aber eine große Sache ist. Sowohl die Kirche als auch Joys Apartmenthaus sind mit schweren, hohen Eisengittern und bewaffneter Security geschützt. Das Wohngebäude hat einen fast lichtlosen, dreieckigen Innenhof. Hier spannen Mütter lange Wäscheleinen, unter denen ihre Kinder spielen.
»It’s a simple house if you don’t mind«, hatte Joy geschrieben. Wir betreten die Wohnung durch die schwer und mehrfach gesicherte Tür und stehen sofort im Wohnzimmer, das Joy mit viel Liebe hergerichtet hat: Zwei Sofas gruppieren sich um einen Flachbildfernseher an der Wand, eingerahmt von zwei schwarzen, afrikanischen Masken und einem bunten Wandteppich. In zwei Vitrinenschränken bewahrt sie das feine Geschirr auf. An der Stirnseite vier Spiegel mit Bildern ihrer siebenjährigen Tochter Lisa, die sie Princess nennt: Lisa als Kleinkind, bei der feierlichen Einschulung, in Großaufnahme. Von ihren anderen Kindern Maryam und Faraja gibt es keine Bilder.
Joy hat aufgeräumt, absolut nichts liegt herum. Leider ist das Wohnzimmer ebenso lichtlos wie das danebenliegende Schlafzimmer, in dem Joy mit Maryam, Faraja und Lisa schlafen wird, denn beide Zimmer gehen auf den dunklen Innenhof hinaus. Im Gegensatz zum Wohnzimmer stapeln sich im Schlafzimmer Wäsche und Krimskrams in riesigen Haufen auf Boden und Betten, es sieht aus wie nach einer Explosion. Möglicherweise hat Joy einfach vor meiner Ankunft alle Sachen aus dem Wohnzimmer hier reingeworfen. Ich bekomme das Zimmer daneben, das einzige mit Tageslicht; normalerweise schlafen hier Faraja und Lisa. Die Fenster meines Schlafzimmers sind wie in einer Gefängniszelle sehr hoch angebracht und lassen sich nicht öffnen. Es müffelt. Drei der Wände werden durch jeweils einen Gegenstand verziert: ein zehn Jahre altes, unscharfes Foto von Joy, ein rotes, an einem Nagel hängendes Käppi und ein zerbrochener Spiegel. Im Gegensatz zum braun und orange gestrichenen Wohnzimmer sind die Wände hier nur verputzt, nicht gestrichen. Die Toilette hat keine Brille und keine Spülung, es gibt keine Dusche und keinen Wasserhahn. Überall stehen bunte Wasserkanister herum. Es gibt ein Waschbecken, in dem man sich die Hände waschen oder die Zähne putzen kann, das Wasser läuft dann direkt durch ein Rohr in einen Eimer. Mit dem kalten und gebrauchten Wasser aus diesem Eimer kann man sich dann mit einer Schöpfkelle duschen – oder das Klo spülen. In der Küche gibt es einen niedrigen Herd mit zwei Flammen, auf dem ein großer, grauer Blechtopf steht mit undefinierbaren grünen Speiseresten, vermutlich Spinat vom vorigen Abend. Joy geht erst mal duschen, ich höre, wie sie sich ein paar Mal mit dem Wasser aus dem Eimer übergießt, dann kommt sie raus, nur ein knappes Handtuch um den Körper geschlungen, und sucht seelenruhig im Kleiderschrank meines Zimmers nach Klamotten, während ich dort auf dem Bett liege und lese. Ist das hier üblich, frage ich mich in diesem Moment, oder will sie mit mir flirten?
Es riecht nicht gut, ich möchte raus und schlage vor, sie zum Mittagessen einzuladen. Wir laufen die Straße vor ihrem Haus herunter. Morgens war ich noch zum Sightseeing im Zentrum von Nairobi – asphaltierte Straßen, Fußgängerwege, Straßenlaternen, moderne Autos und Hochhäuser, Cafés, Restaurants, alte Kolonialbauten, fast wie eine westliche Stadt. Hier, nur wenige Kilometer weiter östlich, ist alles so, wie ich es aus Äthiopien und Uganda kenne: Sandpisten, übersät mit Geröll, Steinen, Müll und Kot von den herumstreifenden Ziegen und Hühnern, sehr viele Kinder auf der Straße, ab und zu ein Motorradtaxi (»Boda Boda«) oder ein uraltes Fahrrad mit absurd großer Ladung auf dem Gepäckträger, am Straßenrand lauter Mini-Shops in improvisierten Hütten, Safaricom, Family Butchery, Friseur und Kosmetik, Gemüse und Obst. Sofas, Bettgestelle und Matratzen werden auf die Straße gestellt und verkauft, daneben Abwasserkanäle voll stinkendem Müll. Ein Mann stellt sich an den Kanal und pinkelt hinein. An einer Hauswand steht: »Bitte hier nicht pinkeln.« An einer größeren Straßenkreuzung besteigen wir ein zerbeultes Matatu. Gerade morgens hatte ich in The Nation einen Bericht darüber gelesen, wie ein Matatu in Nairobi von vier Fahrgästen gekapert wurde, die übrigen Fahrgäste mussten Portemonnaies und Handys abgeben. Danach fuhr das Matatu in buschartiges Gelände, die Männer wurden verprügelt, die Frauen vergewaltigt, bis heute wurde niemand gefasst.
Uns passiert nichts dergleichen. Die Sitze sind knallgrün, die Lederverkleidung an der Decke ist zerschlissen, die Fenster sind beschmiert, verdreckt und zerkratzt, die Musik – davor wurde ich schon gewarnt – spielt laut wie in einem Club. Macht nichts, ich liebe afrikanische Popmusik. Joy bezahlt mit ein paar Münzen, wir steigen aus und wandern noch zwei Kilometer, vorbei an wilden Müllkippen und weiteren Barackenshops zur kleinsten Mall Nairobis. Joy möchte direkt ins Java House, die teuerste Café-Kette Kenias, die Hälfte der Besucher sind Muzungus, die Preise europäisch: Für zwei Gerichte, zwei Limonaden und zwei Kaffee zahle ich 3000 Shilling (achtundzwanzig Euro). Die Gehälter sind freilich nicht europäisch: Ein Kellner hier verdient 15 000 Shilling, also 140 Euro im Monat.
Es stellt sich heraus, dass eine Verwandte von ihr dieses Restaurant managt – sie hat aber heute frei – und dass ihre Tochter auch in einem Java House arbeitet. Ich wundere mich, dass die Speisekarte fast dieselbe ist wie die vom Café Javas in Uganda. Ist es dieselbe Kette? Oder haben die Kenianer von den Ugandern geklaut? Im Gegenteil, entrüstet sich Joy, das Java House gibt es seit vielen Jahrzehnten in Kenia, das Café Javas habe das erfolgreiche Konzept hemmungslos abgekupfert.
Joy hat achtunddreißig Referenzen von Gästen aus aller Welt: aus Japan, Russland, Schottland, Iran, Dubai, Saudi-Arabien, Serbien, Argentinien, Nigeria, Frankreich, Spanien, USA, Deutschland. Ich frage sie, wie es war, achtunddreißig Couchsurfer aus über zwanzig Ländern zu beherbergen. Sie lacht. In Wirklichkeit, erzählt sie, waren es über zweihundert. Aber die meisten würden keine Referenzen schreiben. Es wird auch schnell klar, warum sie das Ganze macht: Sie ist freiberuflicher Tourguide. Schon früh im Chat fragt sie die Surfer, wozu sie nach Kenia kämen. Die meisten kommen wegen der Tiere und Nationalparks. Denen verkauft sie dann ihre Touren.
Wie denn die Surfer aus Saudi-Arabien gewesen waren, will ich wissen. Total nette Jungs. Aber was deren Verhältnis zu Frauen angehe – das Schlimmste sei, dass sie da überhaupt kein Problem erkennen. Es sei völlig normal für sie, dass Frauen keine Verträge unterschreiben und nicht ohne Mann aus dem Haus gehen könnten. Besonders angetan war sie von den Gästen aus dem Iran (»so bescheiden!«) und von dem Trio aus Deutschland, das über Monate durch Afrika geradelt ist.
Irgendwelche schlechten Erfahrungen? Ja, überlegt sie, zwei Mal. Ein Russe, der nie gelächelt hat, unfreundlich zu ihren Kindern war und kein Wort Englisch konnte. Er war auf Google-Translator angewiesen, aber zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Wifi in ihrer Wohnung. Das verschlechterte seine Stimmung noch weiter. Und ein junger Pakistani. Ihre beiden jüngeren Kinder waren in jener Nacht bei ihrer Tante, die ältere Tochter schlief im Schlafzimmer, sie selbst im Wohnzimmer auf der Couch. Um zwei Uhr nachts stand er plötzlich nackt vor ihrem Bett und wollte Sex. Sie zischte ihm zu, er solle sich verziehen, aber er wiederholte immer nur, er wolle Sex. Sie wollte schon schreien, aber da wurde ihr bewusst, dass dann ihre Tochter reinkommen und den nackten Pakistani sehen würde. Also forderte sie ihn flüsternd auf zu gehen, morgen Früh werde man weitersehen. Stoisch fragt er nochmals nach Sex. »Wie kann man nur so dreist sein«, regt sie sich auf. »In einem fremden Land! In einer fremden Wohnung! Ich hätte die Polizei holen können, er wäre für Jahre in den Knast gewandert!«
Morgens um fünf schmeißt sie ihn samt Gepäck raus. Als sie ihm um neun Uhr morgens eine negative Referenz schreiben will, hat er sie schon blockiert. Sein Profil sei immer noch aktiv.
Nach diesem Schock nahm sie sechs Monate lang nur noch Frauen oder Paare auf. Und fragte jeden, was er denn in Kenia wolle. Ein Ägypter habe geschrieben: Clubbing, Dating, Sex. Bislang habe er in jedem Land, in dem er gesurft sei, mit einer Gastgeberin geschlafen. Sie zeigt mir sein Profil. Er ist Mitte zwanzig, stämmig-muskulös und praktisch auf jedem Bild mit nacktem Oberkörper zu sehen, mal am Strand, mal auf einer Liege, mal mit einem Drink, mal mit einem gebratenen Hähnchen. Immer trägt er Sonnenbrille und strahlt. Ein Playboy. So wie auch der portugiesische Gast, der vor Joy damit prahlte, er habe in Kenia schon mit fünfzehn Frauen geschlafen. »Und«, habe sie ihn gefragt, »bist du stolz darauf?« Nun, das sei eben so, erklärt Joy. Kenianische Frauen träumten von einem Muzungu, von einem weißen Freund. Wenn dann ein Weißer nach Sex frage, überlegten sie nicht zweimal.
Sie selbst war siebzehn Jahre lang unglücklich verheiratet. Obwohl ihr Vater sogar auf den Brautpreis, die sogenannte Dowery, verzichtete, denn sie war die jüngste, zehnte Tochter, habe ihr Mann sie von Anfang an geschlagen. Immer wieder, und immer habe er es auf den Alkohol geschoben. Als sie das zweite Mal schwanger wurde, mit Zwillingen, forderte er sie auf abzutreiben. Sie lehnte ab, er war stinksauer und wollte sich trennen. Als sie im siebten Monat war, kam er betrunken nach Hause und verprügelte sie so heftig, dass sie Wehen bekam und ins Krankenhaus musste. Die Zwillinge kamen. Der erste starb nach fünf Tagen. Der zweite war halbseitig gelähmt und kaum lebensfähig. Fünf Monate musste sie mit ihm im Krankenhaus bleiben. Sie nannte ihn Faraja, das heißt Trost. Mit ihrem Mann habe sie danach sechs Jahre wie Bruder und Schwester gelebt. Dann wurde sie wieder schwanger, mit Lisa. Nach der Geburt trennte er sich endgültig von ihr und lehnt seither jede finanzielle Verantwortung ab. Sie musste dem Krankenhaus 7000 Shilling zahlen, außerdem Behandlung und Medikamente für Faraja, obwohl sie keinerlei Job oder Einkommen hatte. Letzten Sonntag habe ihre Tochter zum ersten Mal ihren Vater gesehen – an einer Bushaltestelle, für zehn Minuten. Er sei sehr in Eile gewesen.
Inzwischen arbeitet sie als freiberufliche Fremdenführerin, aber im Moment ist Nebensaison. Und dann, so berichtet sie mir, gebe es da noch das Problem mit Tansania. Dort sei man nämlich neidisch auf den Muzungu-Tourismus in Kenia: Die Hauptattraktion Kenias ist die Big Migration, die große Wanderung. Von Juli bis September strömen Hunderttausende von Wildtieren aus der Serengeti in Tansania nach MasaiMara in Kenia. Dort wächst in der Regenzeit von März bis Juni das Gras einen Meter hoch, und das fressen die Wildtiere bis auf englische Rasenlänge ab. Früher konnte sie mit ihren Reisenden Touren machen von Masai Mara zur Serengeti und zurück. Inzwischen aber habe Tansania den kenianischen Fremdenführern verboten, tansanisches Land zu betreten. Und um den Kenianern noch mehr zu schaden, hätten die Tansanier letztes Jahr das hohe Gras in der Serengeti in Brand gesetzt. Die Tiere konnten sich nicht nach Kenia durchfressen, die große Wanderung blieb aus, Zehntausende Touristen in teuren Hotels warteten vergeblich auf ihr Fotomotiv.
Eine große Migration von Menschen gebe es auch, nämlich aus dem Südsudan, Somalia und dem Kongo, so Joy. Aber die Migranten aus dem Südsudan seien undankbar und unerträglich. Statt sich für die Aufnahme zu bedanken, würden sie jeden kenianischen Mann umbringen, der es wage, eine südsudanesische Freundin zu haben.
Wir holen ihre Tochter von der Schule ab. Schüchtern schmiegt sich die zarte, siebenjährige Lisa an den Busen ihrer Mutter, als sie mich sieht. Dann kommen nacheinander Maryam und Faraja nach Hause. Maryam ist dreiundzwanzig und im siebten Monat schwanger. Bald will ihr Freund sie heiraten. Den Brautpreis wird ihr Vater bekommen, der nie für seine Kinder gezahlt hat. Faraja ist dreizehn Jahre alt, halbseitig gelähmt, sehr dünn und schaut düster. Er lächelt nicht ein einziges Mal während meines Aufenthaltes. »He is too serious for life!«, lacht Lisa. Stumm macht Faraja seine Hausaufgaben und blickt mich ab und zu ungerührt aus seinen schmalen Augen an. Hasst er alle Couchsurfer, weil sie sein Kinderzimmer belegen, oder speziell mich, weil ich nicht aufhöre, ihn anzulächeln? Maryam schaut sehr laut fern: Disney-Kinderfilme.
Joy und ich kaufen Gemüse an der Holzbude um die Ecke: ein Pfund Tomaten, ein Pfund Zwiebeln, ein Kilo Kartoffeln, eine Avocado, zwei Paprika für 210 Shilling, zwei Euro. Im Innenhof daneben steht ein Wagen mit vier platten Reifen. Es sieht aus, als stünde er hier seit Maryams Geburt. Wieder zu Hause schäle ich die Kartoffeln, während Maryam umgeschaltet hat, Nachrichten auf Swahili. Joy kocht ein indisches Reisgericht: Sie brät rote Zwiebeln an, fügt indische Gewürze hinzu, Knoblauch und Ingwer, dann Kartoffeln und Reis. Direkt neben diesem Currytopf steht immer noch der Topf mit den grünen Essensresten von heute Morgen, und ich sehe plötzlich, wie ein großer, weißer, fingernageldicker Wurm darin herumkriecht und frisst. Mir wird übel. Ich kann es gar nicht glauben. Aber Joy scheint ihn nicht zu sehen. Da kommt Lisa hereingestürmt, zeigt auf den Wurm im Topf und gibt ihrem Ekel auf Swahili Ausdruck. Joy schickt sie unwirsch aus der Küche, schmeißt aber den Wurm und die Essensreste immer noch nicht weg. Stattdessen beginnt sie, über Uhuru Kenyatta zu schimpfen, den Präsidenten, während der Wurm immer noch ihre Essensreste verzehrt. Es gebe nur eine Ursache dafür, dass Kenia nicht vorankomme, nämlich die Korruption. Und was tue Kenyatta dagegen? Gar nichts. Wie auch, wo sein Innenminister im Zentrum der Korruption stehe? Je länger ich den Wurm beobachte, der sich am Spinatgericht von gestern labt, desto weniger Appetit habe ich. Mühsam zwinge ich mich zehn Minuten später, das fertige Curry aus dem Nachbartopf zu essen. Ein noch so unbestechlicher Präsident, denke ich, könnte nicht durch jede kenianische Küche laufen, um verrottetes Essen zu entsorgen.
Maryam redet so wenig wie Faraja. Auch Lisa sagt mir nur, dass sie die Tafel Ritter Sport nicht mochte, die ich ihr geschenkt habe. Viel lieber hätte sie die andere gehabt, die Joy bekommen hat. Aber beide haben ihre Tafeln schon aufgegessen. Ich komme aus einer Familie, in der viel geredet wird. Immer wieder versuche ich, ein Gespräch in Gang zu bringen.
»How was school?«, frage ich Faraja.
»Good«, sagt er und sieht mich feindselig an.
Maryam hat inzwischen auf eine schlecht ins Englische synchronisierte Bollywood-Serie umgeschaltet. Fast unwirklich gutaussehende, perfekt geschminkte und ausgeleuchtete Menschen hangeln sich von einem Familienzwist zum nächsten. Um 21 Uhr ziehe ich mich in mein Zimmer zurück, um Tagebuch zu schreiben. Dann möchte ich schlafen. Aber obwohl es schon elf ist, lässt Joy den Fernseher auf voller Lautstärke laufen. Um zwanzig nach elf gehe ich noch mal ins Wohnzimmer. »Ich gehe jetzt schlafen«, sage ich, »Gute Nacht!« Sie lächelt nur kurz und lässt den Fernseher laut. Faraja und Lisa liegen auf dem Sofa und sind eingeschlafen. Maryam schläft im Nebenzimmer. Anscheinend haben sich alle außer mir schon an den Fernsehlärm gewöhnt.
Kurz nach Mitternacht stellt Joy den Fernseher aus. Aber schlafen kann ich immer noch nicht. Die Luft ist stickig und riecht unangenehm. Die Fenster lassen sich nicht öffnen. Über meinem Kopf kreisen aufdringlich sirrend Moskitos, ein Netz gibt es nicht. Ich schalte das Licht an, um sie zu jagen, vergeblich. Da sehe ich, wie eine große Wanze über mein Bett kriecht. Eine andere Wanze klebt über mir an der Wand. Ich erschlage sie mit der Tageszeitung The Nation, die ich heute Morgen gekauft habe, knipse das Licht wieder aus und versuche zu schlafen. Keine Chance. Überall juckt es von Moskitostichen. Ich besprühe Arme, Beine und Gesicht mit Anti-Moskito-Spray und schlucke eine Malarone, ein Anti-Malaria-Medikament. Mein Hals zieht sich zu, meine Nase verstopft, ich werde krank. Auf keinen Fall werde ich hier noch einmal übernachten. Joy hat mich für zwei Nächte aufgenommen, aber ich buche noch in derselben Nacht über mein Smartphone ein günstiges Hotelzimmer in Nairobi. Schlafen kann ich immer noch nicht. Ich frage mich, mit welcher Ausrede ich Joy absagen kann. Um fünf Uhr beginnen die Vögel neben meinem Fenster einen Riesenkrach, um Viertel vor sechs steht Faraja auf, er hat einen sehr langen Schulweg. Um sechs dämmere ich endlich weg und bekomme noch zwei Stunden Schlaf.
Mein Wecker klingelt um acht, und ich bin heilfroh, dass ich aufstehen kann. Auf die Dusche mit dem gebrauchten Wasser aus dem blauen Plastikeimer verzichte ich, Deo und Gel müssen reichen. Vermutlich ist es alles eine Frage der Gewohnheit, aber leider komme ich schneller an meine Grenzen, als ich gehofft habe. Joy und ich besuchen ihre Verwandten, die nur zehn Minuten entfernt wohnen, in einer ebenfalls sehr dunklen Wohnung. Es stellt sich heraus, dass Joy nicht nur ihre eigenen drei Kinder großgezogen hat, sondern auch die drei Kinder ihrer verstorbenen Schwester, darunter die sehr korpulente Ada, die mittlerweile eine zweijährige Tochter hat, Shina. Mit ihr hat Joy gestern Abend schon eine Viertelstunde lang geskypt. Dann ist da noch die gertenschlanke Cousine Welma und ein lässig lächelnder, hochgeschossener junger Mann, der jüngste Sohn ihrer verstorbenen Schwester. »Hey, ich bin Mike«, begrüßt er mich. »Aber du kannst mich Magic nennen.« Wir bleiben nur fünfzehn Minuten, denn wir wollen zu David Sheldricks Elephant Orphanage, das nur eine Stunde am Tag geöffnet hat, von elf bis zwölf, wohin ich Joy einlade. Im Uber dorthin verrät mir Joy, dass Magic das Sorgenkind der Familie ist. Die Universität von Nairobi hat ihn mit ein paar Freunden beim Kiffen erwischt und ein Jahr lang der Uni verwiesen. »Und da hat er noch Glück«, erklärt Joy. »Sie hätten ihn auch locker zwei Jahre suspendieren können!«
Im Elefantenwaisengehege sammeln sich ungefähr zur Hälfte weiße Touristen und schwarze Schulklassen in Schuluniformen um eine Absperrung, ehe um fünf nach elf zehn junge Elefanten hierhertraben, um von den Wärtern aus riesigen Flaschen mit Milch gefüttert zu werden. Sie führen sie so nah an die Absperrung, dass die Schulkinder ihr Fell anfassen können. Ich strecke auch meine Hand aus. Eine harte, haarige Kruste. Dieses Waisenhaus ist einmalig. Hier leben Babyelefanten aus ganz Kenia, die ihre Mütter verloren haben und von Wildhütern gefunden wurden. Wenn sie erwachsen sind, werden sie in die Freiheit entlassen. Abends lese ich in The Nation, dass Botswana, wo 135 000 Elefanten in Freiheit leben, das Jagdverbot für Elefanten aufgehoben hat. Westliche Naturschützer protestieren entsetzt, aber die Regierung weist darauf hin, wie zerstörerisch die Elefanten sein können, wenn sie Felder und Ernten zertrampeln und in Dörfer eindringen.
Wir gehen etwas früher, um als Erste im Giraffenzentrum zu sein, das 1500 Shilling Eintritt kostet (14 Euro). Es sind nur zwei Giraffen. Man bekommt von den Wärtern Futter, das aussieht wie kleine Holzpellets, und diese legt man dann auf die sehr langen Zungen, die die Giraffen aus ihrem Mund herausfahren. Eine Giraffenzunge wird bis zu einem halben Meter lang. Überhaupt sind Giraffen faszinierende Tiere. Kein Landtier ist höher gewachsen, es gibt sie schon seit 300 Millionen Jahren, sie rennen bis zu sechzig Stundenkilometer schnell und sind bei ihrer Geburt schon einen halben Meter hoch, sonst könnten sie die Zitzen ihrer Mutter nicht erreichen. Trotz ihres langen Halses haben sie genauso viele Halswirbel wie wir, nämlich sieben.
Danach gehen wir einen Nature Trail hinunter und machen wunderbare Fotos. Joy ist extrem fotogen, eine lebendige Frau mit einem großen Herzen. Nach dem Spaziergang lotst sie mich in einem Uber nach Karen, den reichen Vorort im Westen von Nairobi, wo die legendäre Karen Blixen aus Out of Africa ihre Farm hatte. The Karen Hub ist das luxuriöseste Einkaufszentrum, das ich auf meinen Afrikareisen gesehen habe; Joy läuft mit mir schnurstracks in das indische Restaurant Maharadscha, wo sie noch nie war. Ich bin perplex über die Preise. Das billigste Hauptgericht kostet zwanzig Euro. Zum Glück ist auch Joy perplex. Wir suchen uns das nächste Java House, und Joy erzählt von den Unruhen 2008 nach den Wahlen.
»Weißt du, wir haben siebenundvierzig Tribes in Kenia. Präsident Mwai Kibaki war Kikuyu. Nur weil er nicht wie versprochen freiwillig gehen wollte, waren plötzlich alle Kikuyu die Bösen. Ich bin Luo, aber mein Exmann war Kikuyu. Wenn ich meine Eltern in Kisumu besucht habe, meinem Heimatort, fragten die Leute Maryam nach ihrem Nachnamen. Und sie trägt den Namen ihres Vaters, ein Kikuyu-Name. Das allein war Grund genug, dass sie Maryam umbringen wollten. Kannst du dir das vorstellen? Wegen eines Nachnamens. Ein kleines Mädchen. Das ist Tribalismus. Ich konnte sie hier nicht auf die Schule geben, sie wäre gelyncht worden. Ich musste sie auf eine Boarding-School in Meru geben, 230 Kilometer nordöstlich von Nairobi, fünf Autostunden entfernt. Überhaupt, die Tribes«, klagt Joy. Die Samburu im Norden würden ihre achtjährigen Mädchen beschneiden und verheiraten. Immer noch. An Männer, die vierzig, fünfzig, manchmal sechzig wären oder älter. Und niemand könne etwas dagegen unternehmen. »Sie leben als Nomaden, sie bleiben unter sich. Die Männer heiraten so viele Frauen, wie sie können.«
Es fängt an zu regnen, wir fahren zurück, brauchen für die dreißig Kilometer über eine Stunde. »Es ist merkwürdig«, sagt Joy, »sobald es regnet, steht Nairobi im Stau.«
Der Schlafmangel macht sich bemerkbar, mir fallen ständig die Augen zu. Wir sammeln ihre Tochter und zwei Freundinnen an ihrer Schule ein und kommen zu ihr nach Hause. Der Topf mit den grünen Essensresten steht immer noch auf dem Herd. Ich bringe es nicht übers Herz, ihr die Wahrheit zu sagen, und erfinde stattdessen die Geschichte von einem Freund, der sich gemeldet habe und nur heute Abend in Nairobi sei, daher müsse ich jetzt leider schon los, es tue mir sehr leid. Sie ist geschockt, bleibt aber freundlich. Ich fühle mich schrecklich: weil ich es nicht geschafft habe, eine weitere Nacht zu bleiben, und weil ich es nicht hinbekommen habe, ihr ehrlich zu sagen, warum ich schon gehe. Trotzdem bin ich erleichtert, als ich mit meinem Koffer ins nächste Matatu steige.
Joy. Sie bleibt mir ein Rätsel. Sechs Kinder hat sie allein großgezogen. Sie spricht lebhaft, ihre Augen strahlen, eine so warmherzige wie attraktive Frau. Aber in ihrer Wohnung hätte ich es keine zweite Nacht ausgehalten. Und so wie ihre Gäste aus Saudi-Arabien hat sie vermutlich keine Idee davon, was mich hier überhaupt stören könnte.
2.Nairobbery
»Gefährlich? Nairobi ist doch nicht gefährlich!«, beruhigte mich Joy im Chat vor unserer Reise. »Ich bin hier erst zwei Mal überfallen worden!«
Geradezu ungläubig reagieren Kenianer auf meinen Hinweis, ihr Land gelte bei uns als gefährlich. Mein Lonely-Planet-Reiseführer bittet mich eindringlich, einsame Strände zu meiden, Schmuck in Deutschland zu lassen, Geld und Pass verdeckt am Körper zu tragen, Uhren, Kameras, Taschen und Rucksäcke im Hotel einzuschließen und nach Dämmerung nicht mehr durch Nairobi zu spazieren, das nicht umsonst Nairobbery heiße. Am besten buche man eine Pauschalreise und verlasse das Hotelgelände nur in organisierten Touren. In den Reise- und Sicherheitswarnungen des Auswärtigen Amtes – ja, ich lese sie, und meine Mutter liest sie auch! – klingt es noch dramatischer: »Die Gefahr, Opfer von bewaffneten Überfällen zu werden, besteht in allen Landesteilen. Die Innenstädte Nairobis und Mombasas sollten nachts generell gemieden werden. Es besteht in beiden Städten die erhöhte Gefahr, Opfer eines Raubüberfalles (Fußgänger und Autofahrer) zu werden. Teilweise sind diese verbunden mit der Wegnahme des Fahrzeugs (›Car-Jacking‹). Ärmere Wohngegenden, Slums sowie Busbahnhöfe und -haltestellen sollten möglichst auch bei Tag nicht besucht werden. Auch bei organisierten ›Slum-Touren‹ ist es in der Vergangenheit zu gewalttätigen Übergriffen auf Besuchergruppen gekommen. Die Altstadt von Mombasa sollte nur mit ortskundigen Personen besucht werden. Ebenso besteht bei Spaziergängen an Stränden nach Einbruch der Dunkelheit und außerhalb der Hotelanlagen eine erhöhte Gefahr, überfallen zu werden. Es wird geraten, selbst kürzeste Entfernungen mit einem Taxi zurückzulegen.«
Joy hält das alles für Quatsch. »Brasilien«, sagt sie, »das ist gefährlich. Mexiko. Aber da fahren die Leute doch trotzdem hin! Wen stört das?«
In gewisser Weise hat sie recht: Von den vierzig gefährlichsten Städten der Welt liegt nur eine in Afrika, nämlich Kapstadt (Platz elf), alle übrigen in Süd- und Mittelamerika und der Karibik. Auch die USA sind gefährlicher als Kenia. Andererseits rechnen die Afrikaner vielerorts selbst ständig mit Übergriffen. Als ich abends im Dunkeln in einem Kleinbus durch Nairobi fahre und auf meinem Handy chatte, während wir an einer Ampel halten, höre ich plötzlich die raue, tiefe Stimme meines Sitznachbarn: »Pass auf, Mann. Pack das Handy weg. An jeder Kreuzung könnte jemand die Scheibe einschlagen und es dir aus der Hand reißen.« Jeder Uber-Fahrer weist mich auf diese Gefahr hin. Und tatsächlich werden Taxis, Uber-Wagen und Kleinbusse an Kreuzungen oft von großen Gruppen junger Männer umringt. Wohnsiedlungen werden regelmäßig durch hohe Mauern geschützt, oft noch verstärkt mit Stacheldraht oder eingemauerten Glasscherben, große, eiserne Tore werden bewacht von Sicherheitspersonal mit Pistolen und Gewehren. Wohlhabendere Afrikaner haben rund um die Uhr Wachleute am Eingangstor ihres eingemauerten Grundstücks. An jedem Museum muss man seinen Reisepass abgeben, vor jedem Hotel und jedem Einkaufszentrum wird man gescannt, die Taschen werden durchsucht. In Kenia kommen zur Kriminalität die Terroranschläge der Al-Shabaab-Milizen aus Somalia dazu. Sie üben Vergeltung dafür, dass Kenia Truppen nach Somalia geschickt hat. Erst im Januar 2019 töteten fünf Al-Shabaab-Angreifer einundzwanzig Zivilisten in einem Hotel- und Bürokomplex im Touristen-Stadtteil Westlands mit Bomben und Maschinengewehren, ehe sie selbst von der Polizei erschossen wurden. Als ich Joy frage, was man gegen die schrecklichen Terroranschläge der Al-Shabaab unternehmen könne, schaut sie mich mitleidig an. »Was man dagegen tun kann? Was soll man gegen Muslime und ihren Hass tun?«
Öffentliche Gebäude darf man in Kenia überhaupt nicht fotografieren, weder das Parlament noch die Uni, nicht mal die Musikhochschule. Leider erfahre ich, dass es selbst bei privaten Gebäuden sehr schwierig ist. In Nairobi möchte ich die spektakulären Zwillingstürme von The Nation fotografieren, der großen englischsprachigen Tageszeitung Kenias. Sofort kommen Sicherheitskräfte auf mich zu.
»Why do you do this? Why do you take photos?«
»I am a tourist«, erläutere ich möglichst unbefangen, »it’s for Facebook, Instagram!«
»But you didn’t take a selfie«, wendet der Wachmann ein.
»I hate selfies!«, lache ich, »I don’t want to be on all of my photos!« Der Wachmann sieht mir ungerührt in die Augen: »Don’t do it. It’s no good. Don’t do it again.«