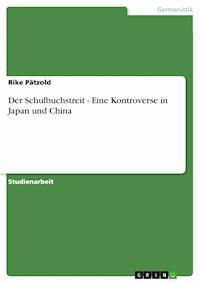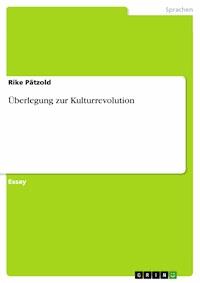17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die große Unbekannte namens Leben
Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an die Ungewissheit. Rike Pätzold, die sich beruflich wie privat mit dem Aushalten ungewisser Zustände beschäftigt, zeigt, dass wir das Unbekannte als Möglichkeitsraum gewinnen können. Sie beschreibt, warum es die Sicherheit, die wir suchen, gar nicht gibt, und warum das auch gut so ist. Wir erfahren, wie wir unsere Zukunft neu denken, um unsere Gegenwart zu gestalten, und uns dafür ein gutes Sicherheitsnetz knüpfen. So können wir mutig handeln und uns den Herausforderungen eines Lebens ohne festen Boden stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Rike Pätzold beschäftigt sich hauptberuflich damit, Menschen in der offenen und konstruktiven Auseinandersetzung mit dem Unbekannten zu unterstützen. Obwohl sie seekrank wird, begab sie sich mit ihrer Patchworkfamilie auf eine dreijährigen Segelreise. Basierend auf ihren Erfahrungen und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, zeigt sie in diesem Buch, wir wir unsere Angst vor dem Ungewissen bewältigen, uns mit ihr versöhnen und erkennen, dass sich in ihr ungeahnte Möglichkeiten verbergen. Rike Pätzold beschreibt, woher unsere inneren Barrikaden gegen Unsicherheit kommen und wie wir diese überwinden, wie wir Fehler und Risiken anders einschätzen. Damit erreichen wir eine Ergebnisoffenheit, die uns hilft, mutig zu handeln, uns den Herausforderungen eines ungewissen Lebens zu stellen und unsere Zukunft zu gestalten.
Rike Pätzold (geb. 1982) ließ sich nach ihrem Studium der Sinologie, Japanologie und Sprachphilosophie an der LMU München in International Leadership und körperorientiertem Coaching ausbilden. Als alleinerziehende Mutter arbeitete sie mehrere Jahre in Asien. Zum Thema Ungewissheit, Selbstorganisationsprozess und Zukunftsgestaltung berät sie Unternehmen und lehrt an Hochschulen, sie forscht, coacht, schreibt, hält Vorträge (u.a. TEDx 2021) und ist eine beliebte Interviewpartnerin. Als Mitgründerin und Leiterin des Instituts für Praktische Emergenz unterstützt sie Organisationen, Städte und Gemeinden im Umgang mit Komplexität und Ungewissheit. Sie lebt mit ihrer Patchworkfamilie in München und auf ihrem Segelboot Ponyo.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen und verlagsüblich zu nennen. Sollte uns dies im Einzelfall nicht möglich gewesen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber.
Bitte beachten Sie: Sollte Sie von Borderline, einer posttraumatischen Belastungsstörung, Panikstörung oder anderen psychischen Erkrankung betroffen sein, kann auch eine einfache Achtsamkeitsübung zu einer Verschlimmerung der Symptome führen. Bitte klären Sie das mit Ihrem Arzt oder Therapeuten ab, bevor Sie Achtsamkeit praktizieren.
Copyright © 2021 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt München
Umschlagmotiv: © alien-tz/Shutterstock.com
Umschlagklappe innen vorne: Karte © Peter Palm, Berlin
Umschlagklappe innen hinten: Fotos © privat
Redaktion: Antje Korsmeier
E-Book Produktion und Satz: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-27997-4V001
www.koesel.de
Inhalt
Vorwort
Kopfüber und mit Anlauf
Segeln als Lehrmeister
»Haftungsausschluss«
Von Unbekannten in der Gleichung
Ungewiss und komplex
Wenn der Boden schwankt
Die Komplexität steigt
Von Maschinen und Systemen
Das Eckige ins Runde
Anpassungskurven und das innere Gleichgewicht(sorgan)
Alles unter Kontrolle?
Glaube nicht alles, was du fühlst
Der Körper ist nicht das Taxi fürs Gehirn
Vom Wissen, nicht viel zu wissen
The map is not the territory
Grenzen unserer Wahrnehmung
Ich weiß, dass ich nichts weiß
Glaube nicht alles, was du denkst
Die Illusion von Objektivität
Das Ende der Perfektion
Durch Fehler besser werden
Die »richtigen« Fehler machen lernen
Der eigene Umgang mit Fehlern
Fehlerkulturen – bei uns und woanders
Andere Sitten, andere Fehlerkulturen
Perfektion, die natürliche Feindin der Anpassung
Eine persönliche Fehlerkultur entwickeln
Diese entsetzliche Lücke!
Aushalten und offen bleiben
Von Mister Spock lernen
Was Zwischenräume mit Intuition zu tun haben
Raum ist nicht leer
4‘33“
Übergänge und die Ränder des Chaos
Alles ist Prozess
Ergebnisoffenheit oder: Umwege erhöhen die Ortskenntnis
Fahren ohne Navi
Serendipity – die Kunst zu finden, ohne zu suchen
Mit allen Sinnen da sein
Es geht immer weiter, irgendwie
Einen Fuß vor den anderen oder Segeln auf Polynesisch
Hart am Wind segeln oder Kurs ändern?
Risiko – kein Anschluss unter Nummer Sicher
Risikowahrnehmung hängt von der Umwelt ab
Die subjektive Wahrnehmung und unsere Urängste
Pascal wettet und Ockham rasiert sich
Wo liegt der »Sweetspot«?
Risiken üben, Ängste normalisieren
Beziehungsnetze zum Auffangen
Am Anfang war Beziehung
Alles Leben ist Vernetzung
Ins Beziehungsnetz einspeisen
Beziehungen bewusst gestalten
Kommunikation hat verschiedene Ebenen
Die Zahl der Möglichkeiten erhöhen
Wenn nichts gewiss ist, ist alles möglich
Annahmen über Zukunft
Zukunft ist nicht Gegenwart 2.0
Zukunft nutzen, um Gegenwart zu gestalten
Welche Geschichte(n) wollen wir erzählen?
Zukünfte anprobieren
Haltung ist ansteckend
Krisenzeiten als Gestaltungsraum
Zum Schluss
Ungewissheit gehört zum Leben dazu
Dank
Weiterführende Literatur
Sachbücher
Fiktion fürs Imaginations-Workout
Serien, Filme, Dokumentationen
Links
Anmerkungen
Meiner wunderbaren Familie
Vorwort
Herzlich willkommen, wie schön, dass Sie dieses Buch aufgeschlagen haben. Vielleicht haben Sie es in die Hand genommen, weil Sie wie ich von den Themen Uneindeutigkeit, Offenheit und Ungewissheit fasziniert sind und gerne mehr darüber erfahren möchten. Vielleicht möchten Sie sich aber auch deshalb genauer darüber informieren, weil Sie in letzter Zeit vermehrt Erfahrungen mit Unerwartetem, mit plötzlichen und unvorhergesehenen Veränderungen und Ungewissheit machen mussten. Unsere Lebensumstände scheinen mehr und mehr plötzlich auftretenden Phänomenen unterworfen, mit denen die wenigsten gerechnet haben. Neben einer weltweiten Pandemie haben wir es zunehmend mit Extremwetterlagen und wirtschaftlichen oder politischen Instabilitäten zu tun, die uns unmittelbar betreffen und unser Sicherheitsgefühl in den Grundfesten erschüttern. Auch technologische Entwicklungen tragen dazu bei, dass Häufigkeit, Tiefe und Geschwindigkeit von Veränderungen zunehmen.
So wurde schon vor Corona von der sogenannten VUKA-Welt gesprochen: Diesem Akronym zufolge wird unser Leben zunehmend von Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität geprägt. Der Begriff entstand in den 90ern in militärischen Kreisen zur Charakterisierung der Welt nach dem Ende des Kalten Krieges, breitete sich später im Kontext strategischer Führung von Unternehmen und anderer Organisationen aus und beschreibt mittlerweile, wie viele inzwischen den Alltag erleben: zunehmend verunsichernd, uneindeutig und unbeständig.1
Selbstverständlichkeiten haben sich besonders in der jüngsten Vergangenheit in Luft aufgelöst, Pläne mussten aufgegeben oder angepasst werden, und uns wird eine kaum gekannte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit abverlangt. Das Fliegen auf Sicht wird vermehrt Teil der »neuen Normalität« und hat Jahresurlaubsplanung und Quartalsziele fürs Erste abgelöst. Der Boden scheint zu schwanken.
Auch bei mir hat die Pandemie einiges durcheinandergewirbelt, umgeschmissen, aufgebrochen, aber auch Überraschendes und Neues in mein Leben gespült. Ursprünglich wollte ich dieses Buch auf unserem Segelboot schreiben, denn nirgends bin ich so frei im Kopf wie dort, wo ich um mich herum nur den Horizont sehe und meine Gedanken nicht an Wänden abprallen. Ich hatte mir das also sehr schön ausgemalt. Aber erstens kommt alles anders, und zweitens als man denkt. Denn das Boot, auf das ich später noch ausführlicher zu sprechen kommen werde, liegt nun pandemiebedingt schon eine Weile fast unerreichbar weit weg. Und so musste ich einen Großteil dieses Buches zu Hause und manchmal unter wenig idealen Bedingungen schreiben.
Überhaupt habe ich diese Idee mittlerweile mehr als einmal verflucht: ein Buch über Ungewissheit zu schreiben, verständlich und alltagsnah. Gerne praktisch und alles gut recherchiert und belegt. Aber da Sie dieses Buch nun in der Hand halten, habe ich wohl nicht aufgegeben!
Warum also will ich gerade über Ungewissheit schreiben? Und was hat das mit dem bewussten Segelboot zu tun? Nun, viele der Erkenntnisse und Entdeckungen, die ich auf den nächsten zweihundert Seiten mit Ihnen teile, stammen aus meiner Zeit auf genau diesem Boot, aber eigentlich begann meine Liebesbeziehung mit der Ungewissheit schon viel früher.
Kopfüber und mit Anlauf
Seit ich denken kann, bin ich immer in alles reingesprungen. So mit Anlauf und kopfüber, ohne zu wissen, wie es dort, wo ich mich hineinstürzte, überhaupt aussah. Das war nicht immer ideal, so viel kann ich im Rückblick sagen. Für jede gute Entscheidung gab es zwei nicht so gute. Andererseits, was weiß ich schon? Vielleicht waren die vermeintlich blöden Entscheidungen genau die richtigen. Und wenn man sich so lange mit dem Thema Ungewissheit beschäftigt wie ich, verschwimmen Kategorien wie gut, schlecht, richtig oder falsch ohnehin; sie verlieren ihre absolute Bedeutung.
Jedenfalls gehöre ich zu den Menschen, die sich von Ergebnisoffenheit geradezu magisch angezogen fühlen. Ich war in meinem ganzen Leben nicht einen Tag fest angestellt, dabei hatte ich mehrere Anläufe unternommen. Aber so richtig wusste ich wohl nie, wie ich es anstellen musste, um mich gut zu verkaufen. Möglicherweise hat meinen Interviewpartnern bei Bewerbungsgesprächen auch der Eindruck von Verlässlichkeit und Beständigkeit gefehlt. Dabei kann ich loyal sein bis zur Selbstaufgabe, nur hat das mein Lebenslauf nie widergespiegelt.
Vielleicht kommt mein Enthusiasmus für ungewisse Zustände daher, dass ich mich von Anfang an mit der Ungewissheit verbünden musste: Ich wurde ohne Schilddrüse geboren. Das kommt auch heutzutage noch relativ selten vor, ist aber meist keine so große Sache mehr. Damals aber war ich – so wurde es mir zumindest erzählt – das erste Baby in Deutschland, bei dem durch den damals gerade eingeführten Fersenpieks gleich nach der Geburt festgestellt wurde, dass ihm etwas fehlte. Zuvor wurden Athyreosen – so der Fachbegriff für das vollständige Fehlen der Schilddrüse – erst deutlich später entdeckt, und dann ließen sich Folgeschäden oft nicht mehr verhindern. Meine arme Mutter verbrachte mit mir Wochen im Krankenhaus und schleppte mich von einer Untersuchung zur nächsten. Ich kann mich natürlich an keine konkreten Situationen mehr erinnern, aber was mir durchaus noch präsent ist, ist ein Gefühl von Verunsicherung, gepaart mit ganz großer Offenheit und vielen Fragezeichen. Meine Eltern wussten nicht, wie ich mich entwickeln würde, ob ich »normal« wachsen und wie alle anderen Kinder zur Schule gehen würde.
Vielleicht hätte ich auch mit einer Schilddrüse denselben Hunger nach Neuem und dieselbe Faszination für ungewisse Ausgänge entwickelt. Vielleicht gibt es auch hier keine Linearität, keine Ursache-Wirkung-Beziehung, sondern nur Zufall und Gleichzeitigkeit. Wie dem auch sei, meine ausgeprägte Experimentierfreude war nicht unanstrengend für meine Eltern, das werden sie nicht müde zu erzählen. Ich wollte alles ausprobieren und alles erleben. Natürlich gab es deshalb ständig Streit, weshalb ich mich mit 15 Jahren für einen Schulbesuch in England bewarb und meine Eltern überredete, mich gehen zu lassen. Ich kannte England nur aus zwei Wochen Sprachferien, Jane-Austen-Büchern und Byron-Gedichten, aber ich wollte unbedingt hin. (Als ordentlicher Teenie litt ich natürlich unsäglich unter meiner bürgerlichen Wohlstandssituation, aus der ich mich in Gedichte und Romane flüchtete, in denen ich die ganze Melodramatik meiner Existenz ausgedrückt sah.)
Und obwohl meine Zeit in England nichts, aber auch rein gar nichts mit der erhofften Internatsromantik zu tun hatte, erlebte ich dort eine wirklich gute Zeit, die meinen Hunger nach Abenteuern noch weiter befeuerte.
Zum Abitur wünschte ich mir ein Flugticket und am Tag nach der Abschlussfeier ging es nach Mittelamerika. Den großen Plan hatte ich nicht, nur die Idee, Spanisch zu lernen, und ein Zimmer bei einer wundervollen Familie in einer costa-ricanischen Kleinstadt, bei der ich vorerst unterkommen konnte. Und so ging es immer weiter von einer Reise zur nächsten Beziehung, zur nächsten Idee. In der Universität tauchte ich eher sporadisch auf, viel lieber verbrachte ich Zeit in der japanischen Galerie, in der ich nebenbei jobbte und wo dauernd etwas los war.
Die ständige Veränderung war aufregend, aber auch anstrengend, zumal es mir zunehmend schwerer fiel, mich nicht sofort zu langweilen, wenn etwas nicht mehr neu und interessant war. Und nicht alle Abenteuer blieben ohne Konsequenzen: Mit 22 wurde ich ungeplant schwanger und tauschte dieses neue Abenteuer gegen alle weiteren Abenteuer ein. Es kam, wie es kommen musste, nach einer Weile war auch das Muttersein nicht mehr neu und ganz so aufregend, eine neue Herausforderung musste her – warum nicht ein Auslandssemester in Taiwan mit einem knapp Zweijährigen dabei?
Es hat alles immer irgendwie geklappt, aber es war auch ermüdend, besonders für die Menschen um mich herum. Mehr als eine meiner Beziehungen ist in die Brüche gegangen, weil ich mich eingesperrt fühlte und Angst hatte, etwas zu verpassen. Es sollte noch viele Jahre und weitere Auslandsaufenthalte dauern, bis ich begriff, dass es in meinem Leben auch Beständigkeit geben darf, ohne dass es dadurch langweilig und vorhersehbar wird. Dass es möglich ist, mit jemandem zusammen Abenteuer zu erleben.
Als ich mit Ende zwanzig meinen jetzigen Partner kennenlernte, einen abenteuerlustigen Meeresbiologen, genau wie ich alleinerziehend, waren wir beide gerade nach München zurückgekehrt, er aus England, ich mal wieder aus Taiwan. Der Grund für die Rückkehr waren jeweils die Kinder – wir selbst fühlten uns in München etwas verloren. Es dauert nicht lange und wir waren ein Paar beziehungsweise eine Patchwork-Familie.
Als unser Leben nach einem Jahr langsam alltäglich wurde, fand ich bei ihm ein Buch über eine Segelreise. Mein Freund ist begeisterter Segler (und Taucher, Schnorchler und Windsurfer) und hatte bereits vergeblich versucht, mich für gemeinsame Segelferien zu gewinnen. Mir wird in eigentlich allen Fahrzeugen schlecht, deshalb waren mir bei aller Abenteuerlust Boote stets sehr suspekt.
Da ich aber gerade nichts anderes zu lesen und mein Freund anderweitig zu tun hatte, schnappte ich mir das Buch und verzog mich auf die Couch. Schon nach wenigen Seiten war ich wie gebannt. Es ging um ein schwedisches Paar, das sich ein Boot gekauft und mit seinen Kindern ein Jahr lang den Nordatlantik umrundet hatte. Sie besuchten fremde Länder, begegneten wundervollen Menschen, unterrichteten die Kinder an Bord.
Zu dem Zeitpunkt haderte ich gerade sehr mit dem deutschen Schulsystem, und die Idee, die Schulbank der Jungs durch ein Segelabenteuer zu ersetzen und gleichzeitig als Patchworkfamilie mehr zusammenzuwachsen, fiel bei mir auf fruchtbaren Boden. Auf der letzten Seite angekommen, war für mich klar: Das machen wir auch, Seekrankheit hin oder her – Challenge accepted!
Ich setzte meinen Freund über meine neue Idee in Kenntnis. Falls er – was ich ihm bis heute scherzhaft unterstelle – das Buch absichtlich hatte herumliegen lassen, um mich zu einem Urlaub an Bord zu gewinnen, war seine Strategie voll aufgegangen. Allerdings hatte er wohl nicht damit gerechnet, dass ich sofort ein gebrauchtes Boot kaufen, renovieren, darauf leben und um die Welt segeln wollte.
Wir hatten zunächst keine Ahnung, wie wir unsere Idee finanzieren sollten, ob das angesichts der Schulpflicht überhaupt machbar wäre, ob wir unsere Jobs damit vereinbaren könnten und so weiter. Aber plötzlich war der Alltag nicht mehr alltäglich. Wir hatten ein gemeinsames Abenteuer, einen Traum, auf den wir hinarbeiteten. Wir planten, recherchierten, besichtigten Boote, entwarfen Routen, zogen zusammen, um Geld zu sparen, und lasen einander abends aus Törnberichten vor. Ich machte den Sportbootführerschein, lernte theoretisch alles übers Segeln und über Bootsmotoren und ging meinem Freund mit meinem angelesenen Halbwissen ordentlich auf die Nerven.
Unser Freundes- und Familienkreis fand unsere neueste Idee verständlicherweise etwas befremdlich. Schließlich ist Segeln im süddeutschen Teil der Republik nicht dasselbe wie an Nord- und Ostsee, wo viele Kinder ganz selbstverständlich mit Booten aufwachsen. Hier in München denkt man dabei eher an Schickeria und Schampus auf dem Starnberger See. Weniger Abenteuer, dafür mehr Elite. Zumindest war das bei mir so, bevor ich meinen Freund kennenlernte; Segeln stand auf meiner Schnöselskala gleichauf mit Golf und Tennis.
Von allen Seiten kamen Fragen. Fragen zur Sicherheit, zur Schule, zum Geld, zu den Jobs, Fragen zum Danach. Einige konnten wir beantworten, über andere machten wir uns zum damaligen Zeitpunkt noch keine großen Gedanken. Wir fanden es zum Beispiel nicht beunruhigend, dass wir uns aus Deutschland abmelden mussten, um der Schulpflicht zu entgehen. Auch die Tatsache, dass wir keine Ahnung hatten, wo wir nach dem Segelabenteuer landen würden, fanden wir eher aufregend (dass es am Ende wegen der Jungs doch wieder München werden würde, lag damals noch außerhalb unserer Vorstellung).
In dieser Situation wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass es hinsichtlich des Umgangs mit Ungewissheit etwas zu erforschen gab. Ich fing an, mich damit zu beschäftigen. Ich lernte, dass die Eigenschaft, die einem hilft, ungewisse Situationen nicht nur gut auszuhalten, sondern sogar bewusst zu suchen, Ungewissheitstoleranz oder Ambiguitätstoleranz genannt wird, wobei Ambiguität Mehrdeutigkeit bedeutet. Diese Eigenschaft kannte ich schon (wenn auch noch nicht unter ihrer genauen Bezeichnung) von meinen Auslandsaufenthalten, die mich in Kontakt mit anderen und fremden Kulturen gebracht hatten. Da hilft es nämlich auch, Uneindeutigkeiten auszuhalten und sich von ihnen nicht aus dem Konzept bringen zu lassen.
Ungewissheitstoleranz also. Ich war angefixt, denn es musste doch Strategien geben, wie man diese Toleranz lernt! Und anscheinend hatte ich, ohne es zu wissen, schon ein paar davon entdeckt. Ich musste also bloß herausfinden, welche das waren und sie dann anderen Menschen vermitteln – war doch ganz einfach! Dachte ich zumindest. Und so warf ich mich in die Erforschung der Ungewissheitstoleranz. Ich suchte und erprobte Konzepte, sprach mit Menschen, die Ungewissheit lieben, und mit anderen, die sie am liebsten loswerden wollen. Die Themenfelder wurden immer mehr und immer umfassender. Sie reichten von Komplexitätsforschung über Risikoabschätzung, Zukunftswissenschaften und Quantenphysik bis hin zum Daoismus, um nur ein paar zu nennen. Auf all das werde ich in den folgenden Kapiteln noch mehr oder weniger ausführlich zurückkommen.
Bei all dem war das Segeln mein zugleich gnadenlosester, aber auch geduldigster Lehrmeister, der mir schon bald nach Beginn unserer Reise zeigen sollte, dass es im Umgang mit Ungewissheit doch nicht mit ein paar Strategien getan war, aber auch davon später mehr.
Segeln als Lehrmeister
Segeln als Analogie zu verwenden ist natürlich ganz schön abgegriffen, fast schon platt. Es gibt eine ganze Reihe Management- und Selbst-Coaching-Bücher, die vor Segelmetaphern nur so strotzen: Ein gutes Team brauche einen stabilen Rumpf, sonst sinkt es, ein Kompass ist nötig, damit man auf dem Ozean (des Lebens) nicht verloren geht, man muss die Leinen losmachen, um voranzukommen, und so weiter und so fort. Ich bin keine Freundin solcher Postkartensprüche, aber auch ich musste feststellen: Nach einer gewissen Zeit auf dem Wasser wird man entweder bekloppt oder philosophisch (oder beides), und gute Steilvorlagen für Lebensweisheiten bietet das Segeln reichlich. Für den Philosophen Michel Foucault stellten Schiffe und die mit ihnen verbundenen Abenteuer die Idealvorstellung sogar eine »Heterotopie« dar, eine auf einen bestimmten Raum begrenzte Utopie. Ohne Schiffe, so meinte er, würden die Träume einer Zivilisation austrocknen.2
Dass wir Menschen mit Segelanalogien so viel anfangen können bzw. unsere Träume mit ihnen verbunden sind, hat sicher auch damit zu tun, dass diese Art der Fortbewegung Jahrtausende lang die menschliche Geschichte beeinflusste. Die Ägypter waren wohl vor 5.000 Jahren die Ersten, die Windkraft nutzten, um auf dem Wasser voranzukommen. Es folgten die Phönizier und dann die Griechen und schließlich die Römer, die mit ihren Schiffen die Mittelmeerküste entlangsegelten, Gebiete eroberten und lebhaft Handel trieben. Segelschiffe spielten über Jahrhunderte eine Schlüsselrolle für Kriegsführung, Fischfang und Handel. Es entstanden Hafenstädte, die zu regen Umschlagplätzen für Waren und Ideen sowie zu Begegnungsstätten für Menschen verschiedenster Herkunft wurden.
Man war Wellen, Wind und Wetter ausgeliefert, die Navigation erfolgte über die Beobachtung der Sterne und der Umgebung (der Wolken, Strömungen, Tiere), bis irgendwann Werkzeuge wie der Kompass und der Sextant dazukamen. Über Monate hinweg befand man sich auf offener See, ohne Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Festland, ohne Vorstellung davon, wie es am Ziel aussehen und wie lange man dahin brauchen würde. Auf alten Seekarten stand dort, wo die vermessene Welt endete: »Hic sunt Dracones« – ab hier gibt es Drachen und andere Monster!
Auch als die Küsten und Gewässer schon besser erforscht und kartiert waren und die Zeit der größten Segelexpeditionen vorbei war, blieben die Überfahrten auf dem Segelschiff noch lange ein Wagnis. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die kommerzielle Segelschifffahrt mit dem Aufkommen der Dampfschifffahrt obsolet, dennoch gab es immer wieder vereinzelte Abenteurer, die sich (manchmal sogar auf selbst gebauten Schiffen oder im Falle Thor Heyerdahls auf einem Floß!) auf die Ozeane wagten.
Segeln hat heute natürlich nicht mehr viel mit früheren Segelreisen zu tun. Zum Beispiel haben gerade die neuen Technologien in den letzten Jahren große Veränderungen mit sich gebracht. Während Ende des 19. Jahrhunderts das selbst gezimmerte Boot des berühmten Einhandseglers3 Joshua Slocum selbstverständlich noch nicht über Elektrizität verfügte4 und das bekannte Seglerpaar Larry und Lin Pardey in den 1970er-Jahren des letzten Jahrhunderts noch mit Sextant und Seekarten auf ihrer ebenfalls selbst gebauten und motorlosen Seraffyn um die Welt segelten,5 gehören heute GPS, Satellitentelefon, Autopilot, Radar, Automatische Identifikationssysteme, Rettungssender und einiges mehr zur Grundausstattung. Auch kommen die heute immer größer werdenden Segelyachten meist gar nicht mehr ohne Motor aus. Zum einen werden zwar die Boote größer, nicht aber die Häfen, in denen sie anlegen wollen, zum anderen braucht es für einige mittlerweile als unentbehrlich geltende Annehmlichkeiten Strom, der zu einem guten Teil über den Motor generiert werden muss. Wenige Segler haben noch die Seekarten aller angesteuerten Reviere an Bord – zu teuer, zu sperrig. Die meisten verlassen sich ganz auf die Technik. Zugegebenermaßen sind wir ebenfalls auf unserer Segelreise immer nachlässiger geworden, gerade mit Blick auf die immer leerer werdende Bordkasse verzichteten wir zunehmend auf die Karten und navigierten nur noch elektronisch.
Selbst die meisten angesteuerten Orte haben viel von ihrem Geheimnis verloren. Wo es noch vor zwanzig Jahren ein kleines Abenteuer war, sich per Augapfelnavigation durch den schmalen Durchgang in ein Atoll vorzutasten, kann man heute zu sehr vielen vormals schwer zugänglichen Ankerplätzen Blogartikel, Fotos, Videos und sogar Drohnenaufnahmen finden. Zudem ist in den letzten Jahren die Zahl der Segelkanäle explodiert: Familien, Paare, Einhandsegler – alle dokumentieren ihre Reise über selbst produzierte Videos, was wieder viele weitere dazu inspiriert, ebenfalls ein Boot zu kaufen und loszusegeln.6 Und darüber wieder Videos zu produzieren, die wieder andere inspirierten. Und so weiter.
In der Folge steigt die Zahl der Menschen, die den Atlantik auf einem Segelboot überqueren oder gleich die Welt umrunden, mit jedem Jahr.7 Man könnte sagen, über den Atlantik zu segeln gehört inzwischen zu den beliebten Zutaten eines interessanten Lebenslaufs und liefert sich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Besteigung des Mount Everest. Das sogenannte Blauwassersegeln, also das mobile Leben auf dem Segelboot, liegt im Trend.8
Doch auch wenn in den Industrieländern das Segeln eher zu einem Hobby geworden ist und bei Weitem nicht mehr so viel mit neuen Ufern, unbekannten Gewässern und gefährlichen Unwägbarkeiten zu tun hat wie früher, steht es doch nach wie vor für Abenteuer und den Aufbruch ins Unbekannte. Auch für mich war die Zeit auf dem Boot voller Entdeckungen und Erkenntnisse in Bezug auf den Umgang mit der Ungewissheit.
Auf dem Boot gab und gibt es für mich immer wieder Momente, in denen Gefühle des Ausgeliefertseins, des Respekts und der Demut deutlich ausgeprägter spürbar waren und sind als jemals zuvor an Land. Da wirken zum einen die Unberechenbarkeit der Naturgewalten, die riesigen Entfernungen und die gewaltige Ausdehnung der Ozeane, die man wohl nur auf einem langsamen Gefährt wie einem Segelboot wahrnimmt. Zum anderen ist der Eindruck von Abgeschnittenheit wohl nirgends größer als auf dem offenen Ozean. Schließlich macht einem das unmittelbare Erleben noch einmal klar, wie wenig wir immer noch über diese Welt wissen, vor allem über den Teil unterhalb der Wasseroberfläche.
Auf unserem Weg über den Atlantik lagen unter uns streckenweise 4.000 Meter Wasser, was im Vergleich mit anderen Stellen auf der Erde noch nicht einmal besonders tief reicht. Im Marianengraben bei den Philippinen, weltweit die vermutlich tiefste Stelle, wurden 11.000 Meter gemessen. Ich aber fand schon »unsere« 4.000 Meter beeindruckend und manchmal beklemmend. Stellen Sie sich vor, am oberen Rand dieser Buchseite läge ein Zuckerkörnchen, das wäre unser Boot. Die ganze restliche Seite darunter entspräche dann in etwa proportional der Wassersäule, die uns vom Meeresgrund trennt. Der oberste Zentimeter davon wäre die sogenannte euphotische Zone, die noch lichtdurchflutet ist, die vier Zentimeter darunter spiegelten die nur schwach durchleuchtete sogenannte dysphotische Zone oder auch Dämmerzone wider,9 und dann, den größten Teil der Seite einnehmend: ewige und undurchdringliche Schwärze in der aphotischen Zone, die sich außerdem durch große Kälte und einen extrem hohen Druck auszeichnet.
Die Tiefsee ist das größte Ökosystem der Erde, aber wir haben nur sehr eingeschränkte Kenntnisse davon, was sich da unten abspielt. Tatsächlich wissen wir mehr über die Rückseite des Mondes als über diesen Teil unseres eigenen Planeten. Gerade mal fünf Prozent des Meeresgrunds sind bisher erforscht, und von den rund 300 Millionen Quadratkilometern, die er umfasst, sind die Karten ziemlich ungenau.
Aber nicht nur die Tiefsee gibt uns Rätsel auf, auch über die anderen Zonen unserer Meere wissen wir noch wenig. Ab und an werden Riesenkalmare, Angler- oder Bandfische nach oben gespült oder ein Kragenhai geht Fischern als Beifang ins Netz.10 Über diese in der Tiefsee beheimateten Lebewesen ist kaum etwas bekannt, genauso wenig über deren Lebensräume.
Auch auf unserem Segeltörn ist uns immer wieder Unerwartetes, Erstaunliches, Rätselhaftes, aber auch Beunruhigendes begegnet (wenn auch nicht so spektakulär und filmreif wie ein zehn Meter langer Kraken). Zum Beispiel kamen wir auf unserer zweiten Atlantiküberquerung von New York zu den Azoren in die durch das Azorenhoch gelieferte Flaute, der Atlantik war spiegelglatt und lockte mich, eine Runde baden zu gehen. Mein Freund bekam das glücklicherweise rechtzeitig mit und meinte trocken, ins Wasser deutend: »Das würde ich mir noch mal überlegen.« Da sah ich sie erst, die portugiesischen Galeeren – Hunderte der violett-bläulichen Schwimmblasen schwebten im Wasser, so weit das Auge reichte. Die fremdartigen und gruselig schönen Quallen haben bis zu fünfzig Meter lange Tentakel, deren Kontakt für Menschen sehr schmerzhaft sein kann. Wir hatten bis dahin immer nur welche vereinzelt im Wasser oder gestrandet an Land gesehen.
Gleichzeitig hatten wir in den vorangegangenen zehn Tagen gerade mal einen einzigen Fisch geangelt. Auch andere Segler, die wir später auf den Azoren trafen, berichteten das Gleiche: ein Meer voller Quallen, dafür aber kaum Fische. Möglicherweise besteht hier ein Zusammenhang. Wir sind wohl unmittelbar Zeugen gleich mehrerer Auswirkungen des gestörten Gleichgewichts auf unserem Planeten geworden, denn nicht nur die Überfischung, sondern auch der Temperaturanstieg der Meere durch die globale Erwärmung und das vermehrte Algenwachstum durch Überdüngung tragen wahrscheinlich zu der beobachteten Quallenblüte bei. So bot das Meer während unserer Reise immer wieder Rätsel und Überraschendes und erinnerte uns gleichzeitig an die Unberechenbarkeit und an die Komplexität lebendiger Systeme.
Neben der Ungewissheit unterhalb der Wasseroberfläche, die uns vor allem faszinierte, hatten wir mit anderen Ungewissheiten eher zu kämpfen: mit unklaren Wetterlagen, unerwarteten Bootsproblemen, nicht einzuhaltenden Zeitplänen und natürlich mit der ständig leeren Bordkasse, die uns vor immer neue Fragen stellten: Wie würde es weitergehen? Wovon würden wir die nächste Reparatur, das nächste Ersatzteil bezahlen, wenn wieder was kaputtging? Immer und immer wieder mussten wir Pläne loslassen, Ziele anpassen, improvisieren statt resignieren.
Als wir es schließlich mit Unterbrechungen nach drei Jahren »endlich« geschafft hatten, auf dem Boot den Nordatlantik zu umrunden,11 und ich mit all meinen Erkenntnissen über Ungewissheit und Ungewissheitstoleranz zurückkehrte, interessierte das die allermeisten zunächst herzlich wenig. Fast immer wurde abgewunken: Ein recht spannendes Thema, so exotisch! Aber man habe derzeit ja alles ganz gut im Griff, also danke, nein danke. So oder so ähnlich waren die Reaktionen, die ich erntete, wenn ich versuchte, meine Mitmenschen von meinen spannenden Erkenntnissen zu begeistern bzw. ihnen begreiflich zu machen, wie sehr sie von ihnen profitieren könnten. Ich hätte dann gern gerufen: »Aber das ist doch genau der Punkt! In dem Moment, in dem du denkst, du hättest alles unter Kontrolle, hast du schon ein Problem!«, jedoch habe ich mir das nicht getraut. Nach dem zwanzigsten Gespräch war ich ziemlich frustriert. Einige meinten es gut und rieten mir, mein Thema umzubenennen, Ungewissheit klinge einfach nicht sexy, das wolle doch keiner hören.
Und dann kam die Pandemie. Ein kleines Virus hebelte schlagartig unsere Selbstverständlichkeiten und gewohnten Abläufe aus. Das Frühjahr 2020 war ein einziger Crashkurs in Epidemiologie, Komplexität und exponentiellem Wachstum, gleichzeitig wirkte Covid-19 als Kontrastmittel für die Schwachstellen unserer Systeme. Ungerechtigkeiten wurden sichtbar gemacht, Ungereimtheiten aufgedeckt und vieles mehr.
Plötzlich stand Ungewissheit auf jeder Tagesordnung, ich erhielt Interviewanfragen, Einladungen zu Vorträgen und Gesprächsrunden. Die Fragen wurden erst leise, hinter verschlossenen Türen gestellt, dann nicht nur mir immer lauter und offensiver: Warum haben wir das nicht kommen sehen? Warum waren wir so schlecht vorbereitet? Und wie können wir verhindern, dass uns so etwas noch einmal dermaßen unvorbereitet trifft?
Ich freue mich über diese Fragen, auch wenn ich mir bestimmt nicht anmaße, die Antworten zu kennen. Mein Gefühl sagt mir allerdings, dass sie viel mit Ungewissheitstoleranz und unserem Umgang mit dem Unberechenbaren zu tun haben. Mit diesem Buch möchte ich Sie also mitnehmen auf meine Reise in dieses weite Themenfeld. Wir werfen darin einen näheren Blick auf die Welt, in der wir leben, und erkunden unsere Annahmen bezüglich dessen, was uns vermeintlich Sicherheit verleiht. Wir sehen uns unseren eigenen Umgang mit Ungewissheit genauer an und experimentieren mit Strategien, die uns dabei helfen können. Und vielleicht entdecken Sie am Ende dieser Reise sogar die Schönheit des Nicht-Wissens. Denn wenn nichts gewiss ist, dann ist zugleich alles möglich.12
»Haftungsausschluss«
Bevor ich Sie aber auf diese Reise nehme, möchte ich Ihnen gerne noch ein paar Dinge mitgeben, die mir wichtig sind: Meine Perspektive ist von Natur aus begrenzt. Als westlich geprägte, weiße Frau mitteleuropäischer Herkunft, bei der das Leben bislang kaum Narben hinterließ und die oft wohl mehr Glück als Verstand hatte, ist mein Blick auf die Welt und das Leben entsprechend gefärbt und beschränkt. Auch bin ich keine »echte« Seglerin. Zwar liebe ich das Bootsleben, habe mit meiner Familie das Mittelmeer segelnd durchquert und den Nordatlantik umrundet, aber ich bin bestenfalls leidenschaftliche Mitseglerin (manchmal mit mehr Leiden als mir lieb ist). Weder bin ich mit oder auf Booten aufgewachsen, noch sind meine Segelfähigkeiten selbst nach zwei Atlantiküberquerungen besonders ausgereift. Dafür werde ich seekrank und scheue mich bis heute davor, das Boot alleine anzulegen.
Zudem bin ich keine Wissenschaftlerin und habe weder Quantenphysik, Evolutionsbiologie noch Netzwerkforschung studiert. Ich habe mich durch Lektüre, Seminare, Vorträge und interessante Gespräch an diese Themen angenähert, weil ich von Natur aus neugierig bin, aber um mich ganz in sie zu vertiefen, ist meine Aufmerksamkeitsspanne – gefühlt mein Leben – viel zu kurz. Zu jedem der diesem Buch zugrundeliegenden Fachgebiete gibt es allein Dutzende von Büchern, und ich bin mir sicher, dass es zu so ziemlich allem, was in den folgenden Kapiteln angerissen wird, Experten gibt, die jeden einzelnen Punkt auseinandernehmen könnten.
Und das ist für mich total in Ordnung. Ich habe mich durch das Studium einschlägiger Quellen bemüht, weitestgehend wissenschaftlichen Konsens abzubilden und Sachverhalte richtig wiederzugeben, aber vergleichbar des schönen englischen Ausspruchs »Jack of all trades, master of none«, gilt für mich, dass ich von vielemein bisschen verstehe, aber bei Weitem nicht alles von einer Sache. Daher freue ich mich über Hinweise, sollten beispielsweise mein begrenztes Wissen und meine eingeschränkte Perspektive mich zu falschen Schlüssen verleitet haben. Wenn ich übergehe und übersehe, was eigentlich sichtbar gemacht werden sollte. Verdrehe, was sich vielleicht anders verhält.
Tatsächlich passt es meiner Meinung nach nicht zum Thema der Ungewissheit, auf die eigene Deutungshoheit zu bestehen. Vielleicht ist etwas so, vielleicht ist es auch ganz anders.
Ich wünsche mir, dass Sie das Buch genauso lesen: mit einem weiten Blick und einem offenen Herzen. Ich höre mir gerne an, wenn Sie mir mitteilen, was nicht funktioniert, solange Sie offen für das sind, was funktioniert. Wir sind so daran gewöhnt, anderer Leute Fehler aufzudecken und deren Ideen kritisch zu beleuchten, dass es uns schwerfällt, uns einfach mal einzulassen. Ich weiß das schon deshalb, weil ich mich selbst immer wieder dabei erwische, bei anderen den Rotstift auszupacken, wenn ich meine, etwas besser zu wissen. Ungewissheit zu feiern ist eine Sache, sie wirklich durchgängig zu leben und sich nicht immer wieder in eigene vermeintliche Gewissheiten zu verlieben, eine ganz andere.
Dieses Buch bietet keinen Zehn-Punkte-Plan für einen »erfolgreicheren Umgang mit Ungewissheit«, weil das Attribut »erfolgreich« und Ungewissheit für mich nicht zusammengehören. Das Buch ist auch keine Anleitung dafür, Ungewissheit zu »managen« oder gar zu minimieren, weil für mich Ersteres ein Widerspruch und Letzteres unmöglich ist. Zugleich möchte ich Ihnen Sichtweisen eröffnen und Erfahrungen an die Hand geben, die mir und anderen, mit denen ich bisher zusammenarbeiten durfte, geholfen haben.
Im Kern ist dieses Buch eine Liebeserklärung an die Offenheit, und es ist eine Einladung zu einer Entdeckungsreise zu Ungewissheit, Chaos, Komplexität und Zukunftsgestaltung.
Nun aber genug der einleitenden Worte – ich würde sagen, klar zum Ablegen!
Von Unbekannten in der Gleichung
Ich bin auf einer Party und erzähle, dass ich mich leidenschaftlich mit dem Thema Ungewissheit beschäftige. Der Gesichtsausdruck meines Gegenübers spiegelt ein Gefühl irgendwo zwischen verkniffener Abwehr und gruseliger Faszination. Ich könnte auch sagen, ich sei als Ärztin auf eingewachsene Zehennägel spezialisiert, die Reaktion wäre vermutlich die gleiche. Aber das bin ich inzwischen gewohnt, denn zwar nicht alle, aber ein Großteil der Menschen, mit denen ich darüber spreche, gibt an, Ungewissheit furchtbar zu finden. Auch meine Gesprächspartnerin ist nicht begeistert. Ob mich das nicht stressen würde, mich ständig mit so etwas Unangenehmem zu beschäftigen?
Lange Zeit haben mich diese Reaktionen irritiert. Wie konnte es sein, dass ich in Ungewissheit so viel Positives sehe und andere dabei vor allem an Negatives denken? Irgendwann dämmerte mir, dass andere Menschen Ungewissheit deshalb schrecklich finden, weil sie damit etwas ganz anderes verbinden als ich. Während Ungewissheit für mich vor allem Offenheit und Möglichkeit bedeutet, assoziieren viele damit Unsicherheit. Ja, sie setzen die beiden Begriffe gleich. Das ist natürlich nicht völlig falsch, weil Ungewissheit – sich einer Sache nicht gewiss zu sein – zu einem Gefühl von Verunsicherung führen kann. Aber bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass es hier ein paar spannende Entdeckungen zu machen gibt.
Ungewiss und komplex
Worin genau der Unterschied zwischen Unsicherheit und Ungewissheit liegt, konnte ich trotz Wälzen einiger Nachschlagewerke nicht abschließend klären, da sind die Linguisten unterschiedlicher Meinung. Also liegen schon bei der Begriffsdefinition eine Ungewissheit und fehlende Trennschärfe vor. Wie passend. Klar ist aber, dass Ungewissheit und Unsicherheit keine Synonyme sind. Und eigentlich ist es auch egal, was Herr Duden und Kollegen sagen. Denn hilfreich ist es auf jeden Fall, wenn man Ungewissheit und Unsicherheit in Kopf und Herzen voneinander getrennt hält. Dann ist Ungewissheit zunächst einmal nur der Zustand der Nicht-Gewissheit. Des Nicht-Wissens. Da steckt noch kein Gefühl drin, keine emotionale Wirkung. Man sagt nicht: »Ich fühle mich ungewiss.« Anders liegt der Fall bei der Unsicherheit. Unsicherheit beschreibt, wie man sich fühlt – nämlich nicht sicher. Ich kann sagen: »Ich fühle mich unsicher.« Sich nicht sicher zu fühlen, ist für niemanden schön, auch ich will mich nicht unsicher fühlen.
Da Ungewissheit und Unsicherheit nicht dasselbe sind, ist Sicherheit auch nicht das Gegenteil von Ungewissheit. Falls Sie ob dieser Formulierung einen Knoten im Gehirn bekommen, keine Sorge. Einfach ausgedrückt heißt das nur, dass es möglich ist, Sicherheit in der Ungewissheit herzustellen. Halt zu finden, auch ohne festen Boden. Wonach wir alle suchen und uns sehnen, ist das Gefühl von Sicherheit. Dieses Gefühl von Sicherheit kommt aber nicht durch äußere Gewissheit (die gibt es nicht und kann es gar nicht geben, wie ich später noch genauer erklären werde), sondern es kann nur von innen kommen. Um allerdings mit Ungewissheit gut umgehen zu können, ist es wichtig, das, was außerhalb unserer Kontrolle und unseres Verständnisses liegt, anzuerkennen und als geschätzte Unbekannte in unsere Gleichung mit aufzunehmen.
Gewissheit ist eine Illusion, und das ist gut so! Das Leben wäre nicht lebenswert, wüssten wir immer schon genau im Voraus, was passiert. Fehlende Gewissheit wird erst dann zum Problem, wenn wir uns dadurch verunsichern lassen.
Mit diesem leidenschaftlichen Plädoyer versuche ich meinen jeweiligen Partybekanntschaften das Thema Ungewissheit schmackhaft zu machen, und tatsächlich wird damit die Neugier geweckt: »Warum gibt es denn keine Gewissheit?«, ist dann die Frage. »Klar, immer wissen, was passiert, das wäre ja langweilig. Aber so ein bisschen Kontrolle?« Ich wackele dann mit dem Kopf. »Planbarkeit?« Mein Kopfwackeln geht in ein Schütteln über. »Echt nicht?« Jetzt schwingt doch ein bisschen Verzweiflung mit. Fast schon entschuldigend erkläre ich dann: Das Leben ist halt komplex und damit nicht vorhersehbar.
Doch was heißt das eigentlich? Bedeutet das nicht einfach, dass das Leben schwer zu verstehen, also kompliziert ist? Ist komplex nicht dasselbe wie kompliziert? Nein, auch zwischen diesen beiden Begriffen gibt es einen wesentlichen Unterschied. Und ihn zu verstehen, ist tatsächlich eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, in unserer immer unübersichtlicheren Welt die Orientierung zu behalten. Um zu begreifen, warum sich die Zukunft unmöglich vorhersagen und berechnen lässt und zu verstehen, wie wir trotzdem damit zurechtkommen.
Der Unterschied zwischen den beiden Begriffen verläuft an der Grenze zwischen linearen und nichtlinearen Systemen.
Ein lineares System ist beispielsweise eine Maschine wie Ihre Spülmaschine, der Motor Ihres Autos oder auch das Uhrwerk Ihrer mechanischen Armbanduhr. In einer solchen Maschine besteht ein ganz klares Ursache-Wirkungs-Verhältnis, auf A folgt B, C folgt B. Maschinen und Geräte können kompliziert sein, wenn man ohne Spezialwissen nicht erkennen kann, wie sie funktionieren oder warum nicht. Wer sich nicht auf Uhren spezialisiert hat, sollte das Uhrwerk einer Schweizer Armbanduhr besser nicht auseinandernehmen. Die Chancen stehen gut, dass er es nie wieder zusammengesetzt bekommt. Auch wenn Ihre Waschmaschine plötzlich den Geist aufgibt, muss wahrscheinlich ein Experte ran. Die meisten Geräte und Maschinen sind jedoch trotzdem »nur« lineare Systeme.13 Sie bestehen aus einer bekannten Anzahl unterschiedlicher Faktoren, die sich immer auf vorhersagbare Art und Weise verhalten.
Komplexe Systeme sind dagegen nichtlinear. In ihnen lässt sich keine klare Ursache-Wirkung-Beziehung erkennen, Dinge ereignen sich synchron, ohne klaren Zusammenhang, und stehen miteinander in ständiger Wechselwirkung. Komplexe Systeme sind wie Gleichungen mit lauter Unbekannten. So kann man ein Fußballspiel nicht vorausberechnen. Sein Ausgang lässt sich nicht zuverlässig vorhersagen,14 denn der hängt von einer Reihe bekannter und unbekannter Faktoren ab, die sich gegenseitig auf nicht prognostizierbare Art und Weise beeinflussen. Wetter. Laune der Spieler. Laune der Spielerfrauen. Mondphase. Qualität des Rasens. Qualität des Torwartschlafs in der Nacht vor dem Spiel. Stimmung im Publikum. Schiedsrichterverdauung.
Das macht ein Fußballspiel überhaupt erst interessant (für diejenigen, die sich für Fußball interessieren). Diejenigen, die sich weniger für die wichtigste Nebensache der Welt erwärmen können, interessieren sich vielleicht für folgendes Beispiel: Das Klima ist ebenfalls ein komplexes System. Deshalb lässt sich sehr schwer sagen, wie sich welche Faktoren genau worauf auswirken. Das wird von Klimawandelskeptikern schnell als Beweis für die Fehlerhaftigkeit der Klimawissenschaft ausgelegt, dabei haben sie schlicht nicht verstanden, was Komplexität bedeutet: Sie lässt sich schon per Definition nicht vorausberechnen. In einem komplexen System wirkt eine unbekannte Zahl verschiedener Faktoren auf nicht vorhersagbare Art und Weise aufeinander ein.
In der Komplexitätsforschung gibt es dafür den Begriff des Mehrkörperproblems. Der geht zurück auf den Mathematiker und Philosophen Henri Poincaré, der schon 1892 zeigte, dass es, wenn drei Körper, etwa Planeten, aufeinander einwirken, zu chaotisch instabilen Verläufen kommen kann.15 Das Ergebnis wiederum nennt sich nichtlineare Dynamik und bedeutet einfach, dass wir zwar wissen, dass etwas passieren wird, aber nicht genau, was.
Nichtlineare Systeme und nichtlineare Dynamik also. Als ob Linearität in der Welt der Normalfall wäre und Nichtlinearität lediglich die Abweichung, der Sonderfall. Das Gegenteil ist der Fall: Alles Lebendige ist nichtlinear, komplex und unberechenbar.
Da die Systeme sehr unterschiedlich sind, unterscheiden sich auch die Lösungsansätze für Probleme in komplizierten und komplexen Systemen entsprechend.
Für ein kompliziertes Problem gibt es einen richtigen beziehungsweise mehrere richtige Lösungswege, es gibt Anleitungen, Handbücher und Gebrauchsanweisungen. Es gibt Spezialisten, die genau wissen, was zu tun ist. Das Problem wird entdeckt, analysiert und behoben. Je besser sich die Spezialisten auskennen, je tiefer sie in die Materie eingearbeitet sind, desto schneller werden sie ein kompliziertes Problem lösen können.
Bei komplexen Problemen gibt es dagegen nicht die eine richtige Lösung oder Antwort, je nach Situation und Gegebenheiten ändern sich die Lösungswege. Es müssen verschiedene Dinge versucht, deren Wirkung beobachtet und Lösungsmöglichkeiten aus den Beobachtungen abgeleitet werden.16
Wenn wir versuchen, mit den uns bekannten mechanischen Methoden Komplexität in den Griff zu bekommen, stoßen wir uns schnell die Nase blutig. Wie bei einem Knoten, den wir im verzweifelten Versuch, ihn zu lösen, durch Ziehen an beiden Enden nur noch unlösbarer machen, braucht es für die Bewältigung von Komplexität eine andere Herangehensweise. Ein neues Denken. Eine Vielheit unterschiedlicher Perspektiven.
Komplexität ist – vereinfacht ausgedrückt – die Tochter von Kompliziertheit und Chaos. Oder mit den Worten der Philosophin Natalie Knapp ausgedrückt: »Komplex ist kompliziert in dynamisch.«17 Direkt am Rand des Chaos können sich die komplexesten Systeme bilden, die einerseits einen so hohen Ordnungsgrad aufweisen, dass sie stabil sind, andererseits aber ein hohes Maß an Flexibilität und Überraschung innehaben.18
Leben und alles Lebendige ist komplex und bewegt sich unentwegt am Rand des Chaos. Und manchmal schwappt das Chaos über, so wie wir es zum Beispiel durch die Corona-Pandemie erlebt haben und in der Folge immer noch erleben. Dann gerät das, was wir für Ordnung gehalten haben, plötzlich durcheinander und alles steht Kopf. Dann zeigt das, was wir für Berechenbarkeit und Stabilität gehalten haben, seine wahre Natur.
Denn diese Berechenbarkeit und Vorhersagbarkeit sind eben bloß Geschichten, die wir uns vor allem in der westlichen Gesellschaft erzählen, um nachts ruhig schlafen zu können. Die uns die Illusion von Kontrolle geben. Wir meinen, wir haben unser Leben in der Hand, wir müssten nur gut genug planen und alles im Griff haben.
Was wir nicht kontrollieren können, ängstigt uns, was wir nicht wissen und kennen, verunsichert uns. Unsere Standardantwort darauf ist noch mehr Kontrolle und Perfektion. Wenn aber die Angst vor dem Unbekannten einen zu großen Raum in uns selbst und in unserer Gesellschaft einnimmt, dann bleibt kein Platz mehr für Kreativität. Die brauchen wir aber – dringend –, um mit den wachsenden Herausforderungen umgehen zu können, die uns und den Folgegenerationen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bevorstehen.
Wenn der Boden schwankt
Haben Sie schon mal ein Erdbeben miterlebt? Ich selbst habe nur ein paar schwächere Beben während unserer Zeit in Taiwan mitbekommen, aber bereits die fand ich überhaupt nicht lustig. Ich dachte damals, wenn ich mich schon bei diesem bisschen Bodenwackeln so fühle, wie muss es dann Menschen gehen, die viel stärkeren Beben ausgesetzt sind? Wenn plötzlich der Boden unter den Füßen richtig stark in Bewegung gerät? Wenn das, was wir für sicher und stabil halten, das plötzlich nicht mehr ist?
Ich fand das schon im Kleinen ein ganz grauenvolles Gefühl, zumal es kein Entkommen gibt, der Boden wackelt drinnen genauso wie draußen. Bei meinem ersten Beben wurde mir schwindelig und sogar etwas schlecht, mein Körper und meine Psyche haben sich vehement dagegen gewehrt. Das kann einfach nicht sein, das darf nicht sein.
Als im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie weltweit ihre volle Wucht entfaltete, hat bildlich gesprochen für uns alle der Boden geschwankt. Vieles, von dem wir ausgegangen sind, dass es so weitergeht, brach mit einem Mal weg. Geschäfte waren geschlossen, man durfte sich nicht mit haushaltsfremden Personen treffen, Verreisen ging auch nicht mehr. Wir konnten plötzlich nicht mehr selbstbestimmt handeln, sondern mussten uns ganz neuen Umständen anpassen. Vor allem war noch nicht klar, womit wir es überhaupt zu tun hatten: Wie ansteckend war dieses neue Virus? Wie gefährlich? Ich kann mich an das Gefühl von Bedrohlichkeit erinnern, das über allem lag. Hinzu kam für die einen die Vereinsamung und für viele andere die Enge während des Lockdowns – wochenlang gemeinsam in der Wohnung eingepfercht zu sein. Die Überforderung, die Kinder zu Hause zu unterrichten und ihnen immer wieder erklären zu müssen, dass sie leider weder ihre Freunde noch Opa und Oma sehen durften. Die Sorge um die Lieben, die erkrankt waren oder zu einer Risikogruppe gehören oder vielleicht sogar beides zugleich. Die wirtschaftliche Not vieler, die aufgrund der Pandemie ihrem Beruf nicht mehr nachgehen konnten, die ihre Firma zumachen mussten. Die plötzlich nicht mehr wussten, wovon sie die nächsten Monate leben sollten. Über all dem schwebte die große Ungewissheit, wie lange das dauern würde. Wie es weitergehen würde.
Und genau wie bei einem Erdbeben war auch in der Pandemie der erste Impuls, sich an irgendetwas festzuhalten, ob das nun Zahlen, Statistiken, Expertenmeinungen oder Verschwörungstheorien waren. Diese Dinge geben uns Halt, wir fühlen uns dadurch bestärkt und einer Gruppe zugehörig. Verschwörungstheorien liefern uns sogar einen Schuldigen, auf den oder die wir unsere ganze Wut und Verzweiflung richten können.
Und nicht nur die Pandemie wirft uns aus der Bahn: Einst klar abgegrenzte Kategorien wie Herkunft und Geschlecht verschwimmen. Vormals an den Rand gedrängte Menschengruppen nehmen zunehmend am öffentlichen Diskurs teil und verschaffen sich Gehör. Auch wenn das eine sehr begrüßenswerte Entwicklung ist, verwirren diese neuen Themen sowie die mit ihnen einhergehende, zunehmende Uneindeutigkeit viele Menschen und lassen sie nach klaren Mustern suchen.
Nun haben wir in Mitteleuropa ja das große Glück, dass starke Erdbeben hier kaum eine Bedrohung darstellen. Deshalb fehlt uns möglicherweise die Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn sich das, was wir für fest und sicher gehalten haben, mit einem Mal bewegt. Das Schwindelgefühl und die Übelkeit, die ich bei meinem ersten Beben erlebte, waren beim zweiten Mal schon um einiges schwächer. Die Situation war zwar nicht weniger beängstigend, aber sie war nicht mehr neu. Abgesehen von der Kriegsgeneration kennen wir hierzulande diese Art von Verunsicherung nicht, deshalb treffen uns solche Erfahrungen vielleicht besonders hart. Und so wie mein Körper und meine Psyche sich gegen den Verlust festen Bodens aufgelehnt haben, lehnt sich in Pandemiezeiten alles in uns gegen den Verlust unseres festen Lebensgerüsts auf. Es ist ungeheuerlich und inakzeptabel und soll aufhören, sofort.
Warum aber fällt es uns so schwer, Ungewissheit auszuhalten?
Wenn wir uns auskennen und meinen, alles unter Kontrolle zu haben, sind wir in unserer sogenannten Komfortzone. Wird uns das genommen und wir wissen plötzlich nicht mehr, wie es weitergeht, werden wir aus dieser Komfortzone herausgerissen.
Die schwer auszuhaltende Verunsicherung, die das mit sich bringt, hat nicht zuletzt physiologische Gründe. Wenn wir uns an eine Situation gewöhnen, wenn sich etwas vertraut anfühlt, hängt das damit zusammen, dass unser Gehirn auf eingespielte Transfermechanismen zurückgreifen kann: Auf schönen, breiten neuronalen Autobahnen werden die elektrischen Signale von A nach B übermittelt. Haben wir es hingegen mit einer fremden Situation zu tun, muss unser Gehirn neue Nervenverbindungen schaffen. Oder wenig genutzte Nervenverbindungen ausbauen, und das kostet ganz schön viel Energie.
Nun ist unser Gehirn supereffizient und versucht, wo es geht, Energie zu sparen. Wir erleben diese Energiesparversuche als Widerstände, als Unwohlgefühl. Typischerweise besinnen wir uns in solchen Situationen auf das, was uns vertraut ist, und fallen in gewohnte Verhaltensweisen zurück. Ein geübter Skifahrer, der sonst durch seinen eleganten Parallelschwung auf jeder Piste glänzt, wendet unter hohem Stress die ursprünglich gelernte Pflug-Technik an. Auch Heimweh und Kulturschock sind nichts anderes als Sehnsucht nach dem, womit wir uns auskennen und was wir für normal halten. Gleichzeitig sind auch sie ein Energiesparversuch unseres Gehirns, da es sonst auf Hochtouren an der Anpassung an die neue Situation arbeiten müsste. Wenn nun das Heimweh oder der Kulturschock ganz besonders schlimm werden, können wir das Unwohlsein auflösen, indem wir nach Hause fahren. Das ist unser Zufluchtsort, dort sind wir zurück in der Komfortzone.