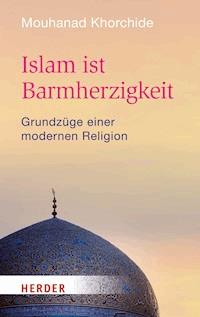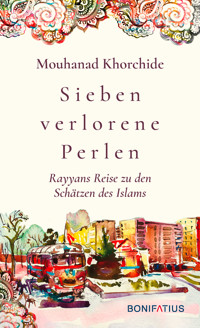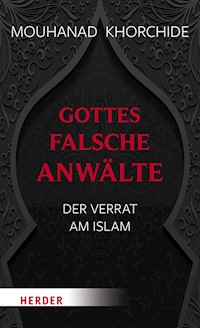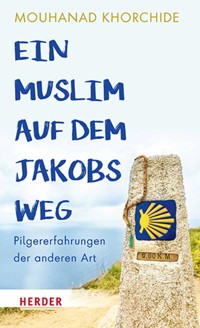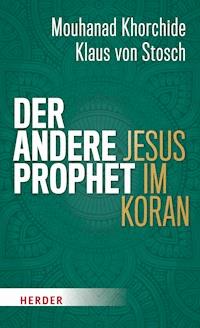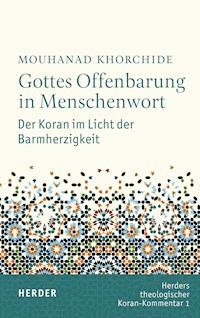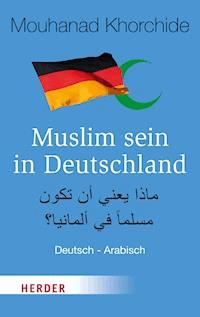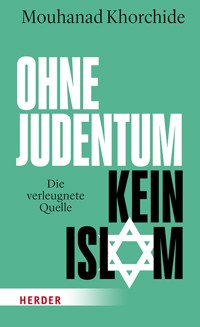
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Spätestens mit dem 7. Oktober wurde deutlich, wie verbreitet der Antisemitismus unter Muslimen weltweit, aber auch in Deutschland ist. Der muslimische Theologe Mouhanad Khorchide geht in seinem neuen Buch u.a. den Fragen nach, warum der Antisemitismus unter Muslimen so viel Anklang findet, welche koranischen und theologischen Quellen als Grundlage des muslimischen Antisemitismus dienen, welche Allianzen ein radikalisierter islamischer Antisemitismus eingeht. Doch Khorchide bleibt nicht bei dieser Bestandsaufnahme stehen. Er versteht das Judentum als Grundlage des Islams und legt dar, wie das Judentum von Beginn an dem Propheten Mohammed als Grundlage und Legitimation für seine Verkündigung diente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mouhanad Khorchide
Ohne Judentum kein Islam
Die verleugnete Quelle
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Hermann-Herder-Straße 4, 79104 Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an
Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft, Timișoara
ISBN Print 978-3-451-03606-4
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83864-4
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83863-7
Inhalt
I. Das Anliegen dieses Buches
II. Muslime und das antisemitische Problem – ein empirischer Befund
III. Antisemitismus und Antijudaismus: Begriffsbestimmung
Wiedererwachen des Antijudaismus
IV. Muslimischer Antisemitismus oder nur islamisierter Antisemitismus?
Position 1: Kein genuin muslimischer, sondern islamisierter Antisemitismus
Position 2: Ein spezifisch muslimischer Antisemitismus
Gegenüberstellung: Stärken und Schwächen beider Positionen
V. Antisemitismus und Antijudaismus als etablierte Großerzählung im Islam
Eine muslimische Großerzählung über Juden
Antijüdische Großerzählungen im Islam und ihre innerislamischen Gegennarrative
VI. Für eine neue Erzählung: Das Judentum als Grundlage für die Verkündigung Mohammeds – ohne Judentum kein Islam
Juden im Koran – ein ambivalentes Verhältnis
Der Koran und die Einheit in der Vielfalt
Abschließende Großerzählung: Ohne Judentum kein Islam
VII. Die Abraham-Abkommen – Eine neue Erzählung für den islamisch-jüdischen Frieden
Religiöse Dimension und Narrative der Akteure
Interreligiöser Dialog in der Praxis: Beispiele und Initiativen
VIII. Vom Feindbild zur Zukunftsvision: Die palästinensische Identität im Spiegel neuer Erzählungen
Danksagung
Anmerkungen
Über den Autor
Über das Buch
I. Das Anliegen dieses Buches
In diesem Buch geht es mir nicht darum, ein weiteres Mal zu betonen, dass Antisemitismus und Judenhass unter Muslimen weit verbreitet sind. Vielmehr verfolge ich zwei zentrale Anliegen: Erstens möchte ich darlegen, welche historischen, theologischen, politischen und psychologischen Faktoren dazu beitragen, dass sich antisemitische Einstellungen unter vielen heutigen Muslimen und Musliminnen so hartnäckig halten. Zweitens stelle ich die Frage, welche Wege und Ansätze es braucht, um dieser Herausforderung wirksam, nachhaltig und glaubwürdig zu begegnen.
Meine zentrale These lautet: Es sind nicht primär Fakten – seien sie religiöser, sozialer oder politischer Natur –, die die Einstellungen von Menschen prägen. Auch unmittelbare Erfahrungen spielen dabei nicht immer die entscheidende Rolle. Vielmehr ist es die Art und Weise, wie über diese Fakten und Erfahrungen erzählt wird – es sind die Erzählungen, die unser Bewusstsein formen. Ich spreche in diesem Zusammenhang von „Großerzählungen“, womit ich übergreifende, kulturell verankerte Deutungsmuster meine, die unsere Wahrnehmung und unser Denken prägen.
Unter vielen heutigen Muslimen hat sich eine negative Großerzählung über Jüdinnen und Juden etabliert. Woher stammt diese Erzählung? Wie konnte sie sich durchsetzen? Und vor allem: Wie lässt sie sich irritieren – und durch eine alternative, projüdische Großerzählung ersetzen?
Das ist das Hauptanliegen des vorliegenden Buchs: Es geht um antijüdische Erzählungen und um das Potenzial alternativer, projüdischer Narrative. Muslimischem Antisemitismus kann nicht allein durch Wissensvermittlung begegnet werden. Entscheidend ist, ob es gelingt, eine wirkungsvolle Gegenerzählung zu etablieren – eine Erzählung, die für Empathie, Respekt und Solidarität gegenüber dem Judentum steht.
Die Frage nach dem Verhältnis des Islams zum Judentum ist gegenwärtig von brennender Aktualität – nicht zuletzt durch die Ereignisse rund um den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Antisemitismus zeigt sich dabei nicht nur als politisch instrumentalisierbares Phänomen, sondern zunehmend auch als tief verankertes Narrativ in bestimmten muslimischen Kontexten. Doch nicht nur dieser Umstand ist besorgniserregend – ebenso alarmierend ist der Umgang mit dem Thema Antisemitismus seit dem 7. Oktober.
In nahezu jeder Diskussionsrunde, zu der ich eingeladen wurde, um über Antisemitismus und seine Prävention zu sprechen, drehte sich die Debatte fast ausschließlich um den Nahostkonflikt. Meist dauerte es nicht lange, bis sich die am Gespräch Beteiligten in zwei Lager aufteilten: ein proisraelisches und ein propalästinensisches. Dabei ging es oft weniger um eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema Antisemitismus als vielmehr um den Streit um politische Deutungshoheit. Wer hat recht – die Israelis oder die Palästinenser? Wem gehört das Land? Wer ist Täter, wer Opfer? Nicht selten mischten sich zudem antiwestliche und antikapitalistische Ideologien – auch von nichtmuslimischer Seite – sowie postkoloniale Agenden in die Debatte ein und führten zu noch größerer emotionaler Verwirrung und Polarisierung.
Bevor ich fortfahre, möchte ich meine Haltung unmissverständlich darlegen: Die Hamas ist eine Terrororganisation. Sie trägt nicht nur die Verantwortung für das Blutvergießen seit dem 7. Oktober 2023, sondern auch für zahlreiche Gewalttaten in den Jahren davor. In ihrer überarbeiteten Charta von 2017 (insbesondere in den Paragraphen 24 bis 26) beschreibt die Hamas den Kampf zur Befreiung Palästinas als eine gesamtislamische und gesamtarabische Pflicht und zugleich als eine menschliche Verantwortung. Sie betont, dass der Widerstand gegen die „israelische Besatzung“ mit allen Mitteln ein legitimes Recht sei – gestützt sowohl durch göttliche Offenbarungen wie durch das Völkerrecht und internationale Normen. Dabei versteht sie den bewaffneten Widerstand nicht nur als strategische Option, sondern als zentrale Methode zur Rückgewinnung der Rechte des palästinensischen Volkes. In den Paragraphen 25 und 26 heißt es wörtlich, dass die Hamas auf dem „bewaffneten Widerstand“ beharrt, diesen weiterentwickeln will und ihn als legitim betrachtet – sowohl in Phasen der Eskalation als auch in Phasen des Waffenstillstands:
„Der Widerstand gegen die Besatzung mit allen Mitteln und Methoden ist ein legitimes Recht, das durch die göttlichen Gesetze und durch internationale Normen und Gesetze garantiert wird. Im Mittelpunkt steht der bewaffnete Widerstand, der als die strategische Wahl zum Schutz der Grundsätze und Rechte des palästinensischen Volkes angesehen wird. Die Hamas lehnt jeden Versuch ab, den Widerstand und seine Waffen zu untergraben …“1
Diese Selbstdarstellung der Hamas legitimiert eindeutig Gewalt gegen Israel und gegen das israelische Volk – und genau das macht sie unzweifelhaft zu einer Terrororganisation.
Die Verurteilung der Hamas als Terrororganisation darf keinesfalls bedeuten, dass alle Palästinenser als Terroristen abgestempelt werden. Ebenso wenig aber darf eine Kritik an der Politik Netanjahus oder der israelischen Regierung zur Infragestellung des Existenzrechts Israels führen.
Nach dieser notwendigen Klarstellung zurück zu meinem eigentlichen Anliegen: Wir sind längst in eine argumentative Falle geraten. Sobald wir versuchen, über Antisemitismus im Islam zu sprechen, verlagert sich der Diskurs fast automatisch auf den Nahostkonflikt. Doch diese Debatten sind selten lösungsorientiert – vielmehr führen sie uns in ideologische Sackgassen. Das darf jedoch nicht heißen, dass wir nicht über den Nahostkonflikt sprechen sollten. Im Gegenteil: Es ist von großer Bedeutung, diesen politischen Konflikt differenziert zu thematisieren. Aber wenn wir über das Verhältnis des Islams zum Judentum und über die Haltung von Muslimen zu Juden sprechen wollen, müssen wir zunächst eine andere Ebene in den Blick nehmen: die religiöse.2
Ich argumentiere, dass antisemitische Narrative in muslimischen Milieus häufig religiös überformt und emotional aufgeladen sind – und damit ideologisch wirksam. Anhand theologischer, historischer und empirischer Perspektiven wird in diesem Buch gezeigt, dass die islamische Tradition sowohl Ressourcen für die Feindschaft als auch für eine interreligiöse Verständigung bereithält. Mein Ziel ist die Entwicklung einer islamischen Theologie, die jüdisches Leben als göttlich gewollt versteht und antisemitische Narrative aktiv dekonstruieren hilft. Denn auch wenn der Konflikt im Nahen Osten kein rein religiöser ist, birgt gerade die religiöse Dimension – im Gegensatz zur politischen – ein bislang wenig genutztes Potenzial zur Lösung. Während politische Narrative allzu oft Teil des Problems waren und sind, kann die theologische Auseinandersetzung Wege zur Verständigung eröffnen.
Natürlich ist mir bewusst, dass die religiöse Interpretation innerhalb des Islams äußerst vielfältig ist – sie reicht von liberal-progressiven bis hin zu extremistisch-fundamentalistischen Auslegungen. Diese Bandbreite ist unbestritten, sie darf jedoch nicht als Entschuldigung dafür dienen, problematische Deutungen zu verharmlosen, indem man sie lediglich als „eine Meinung unter vielen“ darstellt. Wer Gewalt, Intoleranz oder Menschenverachtung religiös legitimiert, kann sich nicht auf die Pluralität islamischer Traditionen berufen, um sich der Verantwortung zu entziehen.
Dieses Buch setzt sich mit jenen Auslegungen des Islams auseinander, die ideologisch als Grundlage für muslimischen Antisemitismus dienen. Es analysiert diese Deutungen differenziert, versucht sie sowohl theologisch als auch historisch zu dekonstruieren, um neue Denkansätze für eine islamische Theologie zu entwickeln, die jüdisches Leben nicht nur toleriert, sondern es bejaht, schützt und aktiv fördert.
Ich vertrete eine These, die für viele provokant klingen mag – und doch muss sie ausgesprochen werden: Der Islam, so wie er heute von vielen Musliminnen und Muslimen verstanden und gelebt wird, hat ein antijüdisches Problem. Und zwar ein religiös-strukturelles, das sich nicht auf politische Konflikte – etwa den israelisch-palästinensischen – reduzieren lässt. Vielmehr wurzelt dieses Problem tiefer: erstens in einem innerhalb der islamischen Lehre weit verbreiteten Absolutheitsanspruch, der Andersgläubige nicht nur vom Heil ausschließt, sondern sie auch im Diesseits als Menschen minderen Rangs betrachtet. Und zweitens in tradierten Auslegungen des Korans, der Sunna – also der prophetischen Überlieferung – sowie in den historisch geprägten Darstellungen der Biografie des Propheten Mohammed, insbesondere seiner Haltung gegenüber den jüdischen Stämmen in Medina.
Im Laufe der Jahrhunderte hat sich daraus eine antijüdische Großerzählung herausgebildet. Sie prägt bis heute das Bewusstsein vieler Musliminnen und Muslime – oft unausgesprochen, nicht reflektiert, aber tief verankert. Diese Erzählung stellt das Judentum nicht als Partner, sondern als ein Gegenüber dar, das durch seinen vermeintlichen Ungehorsam und seine Ablehnung des Propheten Mohammed moralisch und theologisch abgewertet wird. Die islamische Erinnerungskultur gegenüber dem Judentum ist vielerorts nicht von Respekt oder gar Solidarität geprägt, sondern von Misstrauen und Abgrenzung.
Doch jede Großerzählung lässt sich hinterfragen. Und jede Großerzählung kann neu erzählt werden.
Dieses Buch schlägt daher einen anderen Weg ein. Es will nicht nur kritisieren und dekonstruieren, sondern konstruktiv theologische und hermeneutische Alternativen aufzeigen. Ich plädiere für einen Islam, der jüdisches Leben nicht nur toleriert, sondern als integralen Bestandteil göttlicher Geschichte anerkennt. Ein Islam, der nicht in religiöser Ab- und Ausgrenzung sein Selbstverständnis sucht, sondern in der Beziehung – zu anderen Gläubigen, zu anderen Erzählungen, zu anderen Erfahrungen mit dem Göttlichen.
Ich bin mir bewusst, dass manche Leserinnen und Leser dieses Buch als antimuslimisch empfinden könnten – als ein Werk, das einmal mehr den Islam in ein negatives Licht rückt. Diesem Verdacht möchte ich klar und entschieden entgegentreten. Mein Anliegen ist kein pauschales Urteil über Muslime, sondern ein innerislamischer Beitrag zur Selbstkritik und zur Erneuerung. Denn der muslimische Antisemitismus ist real – und er ist gefährlich. Ihn zu benennen, heißt nicht, sich gegen den Islam zu wenden, sondern im Gegenteil: Es heißt, ihn ernst zu nehmen. Es heißt, ihm das Potenzial zuzutrauen, sich selbst zu reflektieren und weiterzuentwickeln.
Die zentrale Frage, die dieses Buch leitet, lautet daher nicht nur: Was können wir gegen muslimischen Antisemitismus tun? Sondern vielmehr: Wie können wir innerhalb des Islams eine projüdische Haltung begründen und fördern? Denn es genügt nicht, gegen etwas zu sein. Entscheidend ist, wofür man steht. Nur eine Haltung, die jüdisches Leben als schützenswert und gottgewollt anerkennt, kann langfristig antisemitische Tendenzen überwinden.
Der muslimische Antisemitismus basiert allerdings weniger auf theologischem Detailwissen oder persönlichen Erfahrungen mit Jüdinnen und Juden, sondern auf einer tief verinnerlichten, religiös überformten Großerzählung – einem Antijudaismus, der aus bestimmten historischen Deutungen des Islams hervorgegangen ist. Die Lösung liegt deshalb nicht allein in politischen oder pädagogischen Maßnahmen, sondern in der theologisch-narrativen Arbeit: erstens durch die bewusste Irritation und Dekonstruktion der antijüdischen Erzählung und zweitens durch die Etablierung einer neuen, alternativen Erzählung. Einer Erzählung, in der Juden nicht länger Gegner sind, sondern Verbündete im Glauben an den einen Gott.
Um solch eine Lösung etablieren zu können, wird dringend Bildungsarbeit benötigt. Denn sowohl Bildung als auch interreligiöser Kontakt und reflektierte theologische Auseinandersetzungen ermöglichen eine deutliche Reduktion antisemitischer und antijüdischer Haltungen unter Musliminnen und Muslimen. Es ist also keineswegs eine unveränderliche oder monolithische Haltung, sondern eine veränderbare Einstellung, die kontextabhängig und bildungssensitiv ist.
Um die Ursachen solcher Phänomene differenziert zu analysieren, bedarf es eines interdisziplinären Ansatzes, der sozialpsychologische, religionswissenschaftliche, historisch-politische und pädagogische Perspektiven integriert. Insofern sollte die Feststellung, dass es unter Musliminnen und Muslimen antisemitische Einstellungen gibt, nicht als abschließendes Urteil, sondern als Ausgangspunkt für eine tiefergehende Analyse verstanden werden. Besonders relevant ist dabei die Frage, welche Rolle spezifische Narrative etwa im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt im kollektiven Gedächtnis vieler Musliminnen und Muslime spielen, wie sie sich auf die Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden auswirken und in welchen Kontexten sich diese Einstellungen reproduzieren.
Nicht zu unterschätzen ist hierbei der Einfluss religiöser Bildungsinstitutionen, Moscheegemeinden sowie populärer Medieninhalte aus Herkunftsländern, die häufig nicht der pluralitätsorientierten Aufklärungstradition westlicher Demokratien verpflichtet sind. Hinzu kommt die wachsende Bedeutung sozialer Medien, die als Beschleuniger solcher Deutungen wirken können. Antisemitische Narrative, Verschwörungsmythen und religiös aufgeladene Feindbilder verbreiten sich dort oft in emotional aufgeladenen Kurzformaten, entziehen sich kritischer Reflexion und erreichen insbesondere junge Menschen mit hoher Wirkmacht. Doch gerade weil soziale Medien prägend sind, bieten sie auch Chancen für Gegenentwürfe: Sie können zu Plattformen werden, auf denen alternative, differenzierte und dialogorientierte Erzählungen gestärkt und sichtbar gemacht werden.
Problematische Koranexegesen, antisemitisch aufgeladene Hadithinterpretationen, also Interpretationen der überlieferten Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed, oder einseitige politische Deutungsmuster können – wenn sie unhinterfragt tradiert werden – zur Verstetigung von Feindbildern beitragen. Umso wichtiger ist es, innerhalb der islamischen Theologie wie auch der islamischen Religionspädagogik eine klare Abgrenzung gegenüber solchen Interpretationen zu entwickeln und alternative Deutungsmuster zu stärken, die mit den Grundwerten der Menschenwürde, des Respekts und des interreligiösen Dialogs vereinbar sind.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Verantwortung allein bei den muslimischen Gemeinden oder bei einzelnen Akteuren der islamischen Theologie liegt. Vielmehr bedarf es einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung, antisemitischen Einstellungen – gleich welcher Herkunft – entgegenzuwirken. Die Anerkennung der Tatsache, dass es auch unter Muslimen antisemitische Tendenzen gibt, darf nicht zum Ausgangspunkt stigmatisierender Diskurse werden, sondern sollte zur Entwicklung von gezielten Bildungs-, Dialog- und Aufklärungsangeboten führen. Wichtig ist hier die Zusammenarbeit zwischen jüdischen, muslimischen und christlichen Akteuren, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Bildungseinrichtungen und staatlichen Institutionen.
Besondere Bedeutung kommt auch der politischen Bildung und der Schulbildung zu. Unterrichtsmaterialien, die sensibel mit der Geschichte des Antisemitismus umgehen und gleichzeitig Raum für eine kritische Reflexion islamischer Traditionen bieten, können dazu beitragen, ein differenziertes Verständnis zu fördern. Religiöse Vielfalt, kritische Hermeneutik und der gemeinsame Einsatz gegen jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sollten zentrale Leitlinien schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit sein.
Abschließend ist hervorzuheben, dass es sowohl in muslimischen Gemeinschaften Europas als auch in mehrheitlich islamisch geprägten Ländern bereits zahlreiche Initiativen gibt, die sich explizit gegen Antisemitismus positionieren. Diese engagieren sich auf vielfältige Weise – durch politische Bildungsarbeit, interreligiöse Projekte, theologische Stellungnahmen oder persönliche Einsprüche gegen judenfeindliche Narrative. Besonders wertvoll ist dabei ihre Arbeit aus einer Binnenperspektive heraus: Gerade weil sie aus dem Inneren der muslimischen Gemeinschaften sprechen, besitzen sie ein hohes Maß an Authentizität und damit das Potenzial, eine verändernde und umgestaltende Wirkung innerhalb ihrer jeweiligen Kontexte zu entfalten.
Solche Initiativen verdienen gezielte Unterstützung und Sichtbarkeit. Es reicht nicht aus, das Problem des Antisemitismus zu benennen; ebenso notwendig ist es, die positiven Gegenbewegungen hervorzuheben und nachhaltig zu stärken. Als ein konkretes Beispiel soll daher am Ende dieses Buches auch die internationale Initiative der sogenannten Abraham Accords oder Abraham-Abkommen kurz vorgestellt werden – nicht als politische Blaupause, sondern als ein Impuls, über neue Formen jüdisch-muslimischer Verständigung im globalen Rahmen nachzudenken.
Nur durch gemeinsame Anstrengungen, gegenseitige Lernbereitschaft und ein wachsendes Vertrauen zwischen den Religionsgemeinschaften kann langfristig eine Kultur der Anerkennung, des Respekts und des solidarischen Miteinanders entstehen – nicht trotz, sondern gerade aufgrund religiöser Überzeugungen.
Der Fokus dieses Buches liegt auf der religiösen Dimension des muslimischen Antisemitismus, weil sie – so meine These – eine latente Grundlage für die ideologische und emotionale Legitimation judenfeindlicher Einstellungen innerhalb muslimischer Milieus bildet. Häufig bleibt sie unreflektiert bestehen, wirkt in religiösen Symbolsystemen und tradierten Deutungsmustern fort und wird dadurch anschlussfähig für politische oder kulturelle Narrative. Genau hier setzt mein Ansatz an: Die Lösung liegt in einer theologischen Wende – einer Neubesinnung innerhalb islamischer Denktraditionen, die den Dialog mit dem Judentum nicht als Option, sondern als konstitutiven Bestandteil des eigenen Glaubensverständnisses begreift.
Diese Wende bedeutet nicht weniger als eine Neudefinition des muslimisch-jüdischen Verhältnisses: nicht im Zeichen der Abgrenzung, sondern im Geist der Verbundenheit – als Bündnispartner im globalen Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Menschenwürde. Es geht darum, dass sich Gläubige beider Religionen als natürliche Verbündete einer gemeinsamen ethischen Berufung verstehen – und dies als Selbstverständlichkeit ihrer jeweiligen Tradition.
In diesem Sinne versteht sich das vorliegende Buch als Beitrag zu dieser notwendigen Wende. Es ist der Versuch, den Islam mit sich selbst ins kritische Gespräch zu bringen – in Treue zur eigenen Offenbarung und in Hoffnung auf eine Transformation. Es ist ein Plädoyer für einen Islam, der sich seiner eigenen Ressourcen für Frieden und Gerechtigkeit bewusst wird und sie im Dialog mit dem Judentum neu entfaltet. Nur so kann ein konstruktiver Beitrag zur Überwindung des muslimischen Antisemitismus gelingen – von innen heraus und mit Blick auf ein gemeinsames Morgen.
II. Muslime und das antisemitische Problem – ein empirischer Befund
Einer aktuellen Erhebung der Jewish Agency for Israel zufolge beläuft sich die Zahl der weltweit lebenden Angehörigen des jüdischen Glaubens auf 15,2 Millionen. Etwa 27 000 von ihnen leben in mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern, wobei mehr als die Hälfte davon – rund 14 500 – in der Türkei ansässig ist.3 Zugleich zeigt ein Vergleich der Anti-Defamation-League-Studien von 2014 und 2024 eine dramatische weltweite Zunahme antisemitischer Einstellungen. Die Anti-Defamation League (ADL), eine international tätige Organisation zur Bekämpfung von Antisemitismus und Hass, führt seit 2014 unter dem Titel Global 100 umfassende und repräsentative Umfragen durch. Dabei werden in über 100 Ländern zehntausende Erwachsene befragt – 2014 waren es über 53 000 Personen in 102 Ländern, die zusammen rund 88 Prozent der Weltbevölkerung abbilden. Ziel ist es, das Ausmaß antisemitischer Vorurteile weltweit vergleichbar zu machen.
Die Ergebnisse sind alarmierend: 2014 gaben 26 Prozent der Befragten an, antisemitische Einstellungen zu teilen – das entsprach etwa 1,09 Milliarden Menschen. In der aktuellen Erhebung von 2024 stieg dieser Anteil auf 46 Prozent an, was bedeutet, dass sich die Zahl der Menschen mit judenfeindlichen Ansichten in nur zehn Jahren nahezu verdoppelt hat. Diese Entwicklung macht deutlich, dass Antisemitismus nicht nur fortbesteht, sondern weltweit auf dem Vormarsch ist – quer durch Gesellschaften, Kulturen und politische Systeme.4
Die empirischen Befunde lassen keinen Zweifel daran, dass antisemitische Einstellungen auch unter Musliminnen und Muslimen – in Deutschland wie international – in signifikantem Maße verbreitet sind. Diese Tatsache darf jedoch nicht isoliert oder monokausal interpretiert werden. Vielmehr ist sie in die komplexen Verflechtungen gesellschaftlicher, religiöser und politischer Dynamiken einzuordnen. Die fehlende klare Trennlinie zwischen Antisemitismus und Antizionismus, die Eskalation des Nahostkonflikts infolge der Zweiten Intifada im Jahr 2001 sowie die zunehmend polarisierende Debatte um die Politik des Staates Israel – insbesondere seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 und den darauf folgenden militärischen Reaktionen Israels – begünstigen die Verbreitung judenfeindlicher Einstellungen. Diese Entwicklungen markieren zugleich prägende Zäsuren innerhalb des globalen antisemitischen Diskurses.5 Ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser Problematik erfordert daher eine sensible Balance: zwischen kritischer Analyse, theologischer Reflexion, pädagogischer Aufklärung und einem ernst gemeinten interreligiösen Dialog.
Auch wenn die empirischen Untersuchungen deutliche Hinweise darauf liefern, dass antisemitische Einstellungen in vielen mehrheitlich muslimischen Ländern weit verbreitet sind, variieren Ausmaß, Ursachen und Ausdrucksformen in Abhängigkeit vom jeweiligen regionalen, politischen und historischen Kontext jedoch erheblich. Besonders aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die Erhebungen des Pew Research Center sowie die internationalen Studien der Anti-Defamation League, die repräsentative Daten zu antisemitischen Haltungen in unterschiedlichen Ländern bereitstellen.
Die vom Pew Research Center durchgeführte Umfrage zu Einstellungen gegenüber verschiedenen Bevölkerungsgruppen hat ergeben, dass die Bevölkerung nahezu aller mehrheitlich muslimischen Länder eine negative Haltung gegenüber Juden einnimmt. Diese Studie, die Mitte 2009 in 25 Ländern stattfand, ergab, dass 98 Prozent der Libanesen, 97 Prozent der Jordanier und Palästinenser sowie 95 Prozent der Ägypter eine ungünstige Meinung über Jüdinnen und Juden haben. Dagegen äußerten sich nur 35 Prozent der arabischen Israelis in diesem Sinne. In der Türkei stieg der Anteil negativer Einstellungen gegenüber Juden von 32 Prozent im Jahr 2004 auf 73 Prozent im Jahr 2009. Auch in den überwiegend muslimischen Ländern Asiens waren antisemitische Einstellungen weit verbreitet. In Pakistan äußerten 78 Prozent der Befragten eine negative Meinung, in Indonesien – dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt – 74 Prozent. In Nigeria war das Meinungsbild insgesamt gemischt, jedoch stark entlang religiöser Linien gespalten: 60 Prozent der nigerianischen Muslime hatten eine ungünstige Haltung gegenüber Jüdinnen und Juden, verglichen mit nur 28 Prozent der Christen im Land. Insgesamt erhielten Christen etwas positivere Bewertungen als Juden, obwohl auch gegenüber Christen in vielen mehrheitlich muslimischen Ländern beträchtliche Vorbehalte geäußert wurden. Besonders deutlich war dies in der Türkei, wo über zwei Drittel der Befragten eine negative Meinung über Christen äußerten.6
Bei der oben erwähnten weltweiten Umfrage der Anti-Defamation League zu antisemitischen Einstellungen aus dem Jahr 2014 wurden, wie schon gesagt, mehr als 53 000 Menschen in 102 Ländern und Territorien befragt.7 Rund 70 Prozent der antisemitisch eingestuften Personen gaben an, nie einen Juden persönlich getroffen zu haben. Insgesamt sagten 74 Prozent aller Befragten, sie seien noch nie einem Juden begegnet.8 Die antisemitischsten Regionen der Welt sind der Nahe Osten und Nordafrika mit 74 Prozent antisemitischen Einstellungen. An zweiter Stelle liegt Osteuropa mit 34 Prozent. Am wenigsten antisemitisch ist Ozeanien (Australien und Neuseeland) mit 14 Prozent. Die drei Länder außerhalb des Nahen Ostens mit den höchsten antisemitischen Werten sind: Griechenland (69 Prozent), Malaysia (61 Prozent) und Armenien (58 Prozent). Etwa 49 Prozent der Muslime weltweit vertreten antisemitische Ansichten – im Vergleich zu 24 Prozent der Christen. Das Westjordanland und der Gazastreifen waren mit 93 Prozent antisemitischer Einstellungen die antisemitischsten Gebiete der Erhebung. Das arabische Land mit dem niedrigsten Wert war Marokko (80 Prozent), das am wenigsten antisemitische Land im Nahen Osten war Iran mit 56 Prozent. 34 Prozent aller Befragten über 65 Jahre wurden als antisemitisch eingestuft, verglichen mit 25 Prozent der unter 65-Jährigen. Männer zeigten sich etwas antisemitischer als Frauen.9
Diese Studie bewertete antisemitische Einstellungen anhand von elf Aussagen, mit denen klassische antijüdische Vorurteile getestet wurden. Die Aussagen lauteten u. a.:
Juden reden zu viel über den Holocaust.
Juden sind gegenüber Israel loyaler als gegenüber ihren eigenen Ländern.
Juden halten sich für etwas Besseres.
Juden haben zu viel Macht auf den internationalen Finanzmärkten.
Juden kontrollieren zu stark die globale Politik, die Medien oder die US-Regierung.
Juden sind für die meisten Kriege verantwortlich.
Juden kümmern sich nur um sich selbst.
Personen, die der Mehrheit dieser Aussagen mit „wahrscheinlich wahr“ zustimmten, wurden als antisemitisch eingestuft.
Außerhalb des Nahen Ostens lag die positive Bewertung Israels bei 37 Prozent, die negative bei 26 Prozent. Im Nahen Osten lag die negative Bewertung bei 84 Prozent. Die einzige andere Region mit mehr negativer als positiver Bewertung war Asien: 30 Prozent negativ, 26 Prozent positiv. Nach den Palästinensergebieten waren die antisemitischsten Länder: Irak (92 Prozent); Jemen (88 Prozent); Algerien und Libyen (je 87 Prozent); Tunesien (86 Prozent); Kuwait (82 Prozent); Bahrain und Jordanien (je 81 Prozent).10
Bis 2015 Nationaldirektor der Anti-Defamation League und Hauptverantwortlicher für die Studie Abraham Foxman, selbst Holocaust-Überlebender, merkte an:
„Unsere Ergebnisse sind ernüchternd, aber leider nicht überraschend. Die Daten zeigen deutlich, dass klassische antisemitische Klischees nationale, kulturelle, religiöse und wirtschaftliche Grenzen überschreiten. Es ist sehr offensichtlich, dass der Nahostkonflikt in Bezug auf Antisemitismus eine Rolle spielt. Aber es ist nicht klar, ob er Ursache oder Vorwand für Antisemitismus ist – es gibt derzeit keine statistischen Daten, die eine Kausalität belegen.“11
Im Jahr 2024, zum zehnjährigen Jubiläum der ursprünglichen Studie, führte die Anti-Defamation League in Zusammenarbeit mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos eine aktualisierte Version der Umfrage durch. Die Datenerhebung fand zwischen dem 23. Juli und dem 13. November 2024 statt. Die Ergebnisse dieser aktualisierten Studie wurden im Januar 2025 veröffentlicht. Dabei wurden über 58 000 Erwachsene in 103 Ländern und Territorien befragt.12
Diese aktualisierte Studie von 2024 zeigt deutlich, dass antisemitische Einstellungen in arabischen und mehrheitlich muslimischen Ländern nach wie vor besonders stark verbreitet sind. Die palästinensisch kontrollierten Gebiete in Judäa und Samaria sowie im Gazastreifen liegen mit einem Indexwert von 97 Prozent an der Spitze – gemeinsam mit Kuwait (97 Prozent) und Indonesien (96 Prozent) zählen sie zu den antisemitischsten Bevölkerungen weltweit. Die niedrigsten Indexwerte wurden in Schweden (5 Prozent), Norwegen (8 Prozent), Kanada (8 Prozent) und den Niederlanden (8 Prozent) gemessen. Das mag überraschen, da Norwegen im vergangenen Jahr die Anerkennung eines palästinensischen Staates beschlossen hat, in Kanada antisemitische Vorfälle zugenommen haben und Amsterdam im November von Ereignissen erschüttert wurde, die viele als ein Pogrom moderner Art deuteten.13 Der Nahe Osten und Nordafrika (76 Prozent) wiesen besonders hohe Indexwerte auf; dicht gefolgt von Asien (51 Prozent), Osteuropa (49 Prozent) und Subsahara-Afrika (45 Prozent). Die Amerikas (24 Prozent), Ozeanien (20 Prozent) und Westeuropa (17 Prozent) zeigten niedrigere Werte antisemitischer Einstellungen – obwohl die Anti-Defamation League betont, dass selbst diese Rohdaten besorgniserregend seien.14
In Deutschland wie auch in vielen anderen Ländern weltweit zeigen sich antisemitische Ressentiments in verschiedenen sozialen, religiösen und politischen Milieus. Besonders gut dokumentiert ist die Tatsache, dass solche Vorurteile auch unter Menschen existieren, die sich selbst dem Islam zugehörig fühlen. Dies ist unter anderem durch die Forschungsarbeiten des American Jewish Committee (2022), der Anti-Defamation League (2014), durch die Studien von Arnold und König (2019)15 sowie durch die sozialwissenschaftlichen Analysen von Jikeli (2018)16 und Jikeli (2013)17, Kaplan und Small (2006)18, Mansel und Spaiser (2013)19, Koopmans (2015)20, Öztürk, Pickel und Pickel (2024)21 sowie Fischer und Wetzels (2023)22 gut belegt. Diese Untersuchungen zeigen, dass Teile der muslimischen Bevölkerungen – sowohl in westlichen Gesellschaften als auch in mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern – antisemitische Stereotype je nach Kontext, Sozialisierung und Bildungsstand unterschiedlich übernehmen oder ablehnen. Nahezu alle empirischen Studien zum Antisemitismus unter Musliminnen und Muslimen kommen übereinstimmend zu dem Befund, dass insbesondere traditionelle sowie israelbezogene Formen antisemitischer Einstellungen in dieser Gruppe besonders deutlich hervortreten. Der Antisemitismus in muslimischen Submilieus stellt – neben dem ethnonational motivierten Rechtsextremismus – eine ernstzunehmende Bedrohung für jüdisches Leben in Deutschland dar. Er speist sich sowohl aus religiösen Deutungsmustern als auch aus politischen Narrativen, die aus den jeweiligen Herkunftsgesellschaften übernommen werden. Dennoch ist das Ausmaß antisemitischer Einstellungen unter Musliminnen und Muslimen in Deutschland insgesamt geringer als in vielen Ländern der islamischen Welt.
Dabei ist es wichtig, analytisch präzise zu differenzieren und vorschnelle Generalisierungen zu vermeiden. Der Hinweis darauf, dass sich auch unter Muslimen antisemitische Haltungen finden lassen, bedeutet keineswegs, dass der Islam als Religion per se antisemitisch sei oder dass Muslime als Kollektiv pauschal antisemitischer wären als andere Bevölkerungsgruppen. Vielmehr weisen die Studien darauf hin, dass es unter bestimmten Bedingungen – etwa durch politische Konflikte wie den israelisch-palästinensischen Konflikt, durch ideologische Einflussnahmen oder durch Defizite im Bildungsbereich – zur Ausbildung oder Verfestigung antisemitischer Einstellungen kommen kann. Diese sind oft weniger theologisch als vielmehr politisch, historisch oder kulturell bedingt. Dennoch bedienen sie sich in der Regel einer religiös konnotierten antijüdischen Großerzählung. Das Ausmaß und die Qualität solcher Einstellungen variieren zudem erheblich – sowohl zwischen verschiedenen Regionen der Welt als auch innerhalb muslimischer Gemeinschaften in westlichen Ländern wie Deutschland. Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass unter Jugendlichen mit muslimischem Hintergrund in deutschen Großstädten antisemitische Ressentiments häufiger vorkommen als im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung.
Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung untersucht in seiner Ausgabe Religionsmonitor 2023 empirisch zwei Erscheinungsformen des Antisemitismus: den „klassischen Antisemitismus“, der Verschwörungsnarrative vertritt, nach denen Jüdinnen und Juden besonders einflussreich und mächtig seien, und zum anderen den „israelbezogenen Antisemitismus“, der Formen der Kritik an der Politik Israels umfasst, sofern diese Kritik antisemitische Züge annimmt oder „antijüdisch“ verallgemeinert und diffamiert.23 Die Ergebnisse machen deutlich, dass antisemitische Einstellungen kein ausschließlich deutsches Phänomen sind, sondern in großen Teilen Europas verbreitet auftreten.
In mehreren europäischen Ländern befürwortet zwischen einem Drittel und der Hälfte der Bevölkerung die Aussage: „Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Grunde vergleichbar mit dem, was die Nationalsozialisten den Juden im Dritten Reich angetan haben.“ In Deutschland stimmen 43 Prozent dieser Gleichsetzung zu – ein Anteil, der fünf Prozentpunkte über dem Durchschnittswert der sieben untersuchten Länder (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Spanien, Polen, USA) liegt.24 Die traditionelle antisemitische Vorstellung, dass Juden übermäßig viel Macht oder Einfluss hätten, stößt in den analysierten Ländern auf unterschiedliche Zustimmung – sie reicht von 15 Prozent in den Niederlanden bis zu 29 Prozent in Polen. In Deutschland teilt rund jede fünfte befragte Person diese Ansicht (21 Prozent).25
Wenn es um die muslimische Bevölkerung geht, dann zeigt der Religionsmonitor, dass hier antisemitische Einstellungen häufiger anzutreffen sind als in der deutschen Gesamtbevölkerung. So stimmen 68 Prozent der muslimischen Befragten der Aussage zu, dass die israelische Politik gegenüber den Palästinensern mit den Verbrechen der Nationalsozialisten vergleichbar sei – im Vergleich zu 43 Prozent in der Gesamtbevölkerung. Zudem sind 37 Prozent der Musliminnen und Muslime der Ansicht, das Judentum verfüge über zu großen Einfluss in Deutschland; unter allen Befragten liegt dieser Anteil bei 21 Prozent.26 Ähnlich hohe Zustimmungsraten zeigen sich auch bei buddhistischen und hinduistischen Befragten. Diese drei Religionsgemeinschaften haben sich im Kontext von Migration in Deutschland etabliert. Daher liegt die Vermutung nahe, dass sowohl die gesellschaftliche Minderheitenposition als auch die Migrationsgeschichte einen Einfluss auf solche Einstellungen haben könnten – insbesondere bei Menschen, die ihre religiöse Zugehörigkeit sichtbar praktizieren, etwa durch als religiös erkennbare Kleidung wie Kopfbedeckungen.27
Die Studie der Bertelsmann Stiftung nennt mehrere Gründe dafür, warum antisemitische Einstellungen unter Musliminnen und Muslimen in Deutschland vergleichsweise häufiger auftreten. Sie verweist dabei auf den Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus aus dem Jahr 2017, der hervorhebt, dass die Erfahrung, als Minderheit in Deutschland zu leben, zu einer Art „Konkurrenz um Opferstatus“ führen kann. Dabei wird das Leid der jeweils anderen Gruppe relativiert, um dem eigenen Opferstatus größere Bedeutung beizumessen. Dieses Phänomen wird als möglicher sozialpsychologischer Mechanismus verstanden, der – neben religiösen und politischen Einflüssen – antisemitische Haltungen innerhalb der muslimischen Bevölkerung begünstigen kann.28
Eine ähnliche Perspektive vertritt eine pädagogische Handreichung, die von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben wurde.29 Darin wird berichtet, dass viele Muslime beklagen, dass muslimfeindliche Einstellungen in der deutschen Gesellschaft kaum beachtet würden, während Antisemitismus mit großer Aufmerksamkeit begegnet werde. Der Wunsch nach Anerkennung der eigenen Diskriminierungserfahrungen und die Enttäuschung darüber, wenn diese nicht wahrgenommen werden, könnten antisemitische Ressentiments begünstigen – ein Muster, das sich auch bei anderen Minderheiten zeigen kann. Bemerkenswert ist allerdings folgendes Ergebnis der Studie der Bertelsmann Stiftung: Bei Musliminnen und Muslimen, die sich als wenig oder gar nichtreligiös verstehen, nähern sich die antisemitischen Einstellungen stark dem Niveau der Gesamtbevölkerung an. Dagegen sind antisemitische Sichtweisen unter mittelstark oder stark religiösen Muslimen deutlich verbreiteter, was auf einen religiösen Einfluss hinweist.30
Laut den Ergebnissen dieser Studie zeigt sich ein umgekehrtes Muster im Vergleich zum Islam: Unter stark religiösen Christen sind antisemitische Einstellungen deutlich seltener als bei weniger religiösen Angehörigen dieser Konfession. Die Studie erklärt diesen Befund unter anderem damit, dass sich die christlichen Kirchen in Deutschland nach dem Holocaust kritisch mit ihrer langen Tradition des Antijudaismus und ihrer Mitverantwortung an der Judenverfolgung auseinandergesetzt haben. Diese Aufarbeitung prägt offenbar das Selbstverständnis vieler engagierter Kirchenmitglieder. Anders stellt sich die Lage bei Christen dar, die aus dem Ausland zugewandert und nicht im Kontext der deutschen Kirchen aufgewachsen sind: In dieser Gruppe zeigt sich ein Zusammenhang zwischen höherer Religiosität und stärker ausgeprägten antisemitischen Überzeugungen. Ein vergleichbares Muster lässt sich auch bei Muslimen beobachten, insbesondere wenn sie in Deutschland wenig religiöse Heimat finden. In solchen Fällen gewinnt oft der Bezug zum Herkunftsland an Bedeutung – einschließlich der dort vorherrschenden religiösen Deutungsmuster, die mitunter antisemitisch geprägt sind. Dies kann zur Verstärkung bestehender Vorurteile beitragen und einen sich selbst verstärkenden Kreislauf in Gang setzen. Diesen zu durchbrechen, ist aus Sicht der Studie eine zentrale Herausforderung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer pluralen Einwanderungsgesellschaft wie Deutschland.31