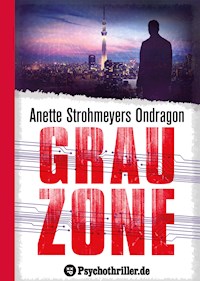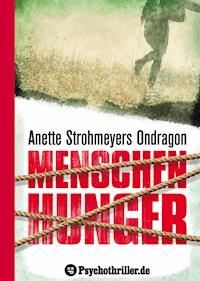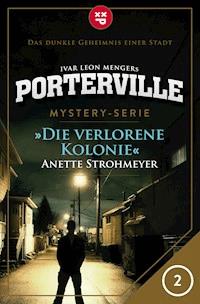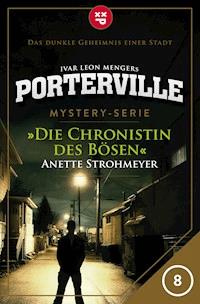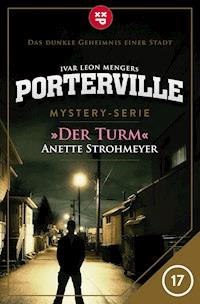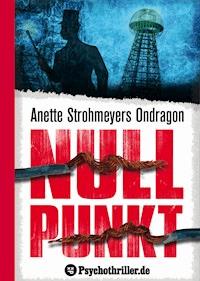Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychothriller GmbH E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ondragon
- Sprache: Deutsch
Paul Ondragon löst Probleme aller Art. Aber ist er auch bereit, an Voodoo-Magie zu glauben? Sein zweiter mysteriöser Fall führt ihn von L.A. über New Orleans nach Haiti, das gerade von einem schweren Jahrhundertbeben getroffen wurde. Dort stößt er mit seinem kleinen Team auf ein erschütterndes Geheimnis, das weit größere Kreise zieht, als er zuvor angenommen hatte … Der zweite Fall von Paul Ondragon: "Totenernte" erscheint als eBook-Originalausgabe. Ein spannender Mystery-Thriller von Anette Strohmeyer (Porterville).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ondragon: Totenernte
Anette Strohmeyer
Originalausgabe
»Band 2«
III. Auflage © 2012-2014
ISBN 978-3-942261-38-8
Lektorat: Hendrik Buchna
Cover-Gestaltung: bürosüd, München
© 2012 Psychothriller GmbH
www.psychothriller.de
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung, der Vertonung als Hörbuch oder -spiel, oder der Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen, Video oder Internet, auch einzelner Text- und Bildteile, sowie der Übersetzung in andere Sprachen.
Ein Buch zu schreiben, dauert Monate. Es zu kopieren, nur Sekunden. Bleiben Sie deshalb fair und verteilen Sie Ihre persönliche Ausgabe bitte nicht im Internet. Vielen Dank und natürlich viel Spaß beim Lesen! Ivar Leon Menger
Danksagung
Was wäre ein Autor ohne seine Helfer? Mein erster Dank gilt meinen fleißigen Testlesern. Eure Kritiken und Anregungen machen aus einem Entwurf erst einen richtigen Roman. Genauso wichtig ist die moralische wie auch die schlichte praktische Unterstützung, für die ich meinem Mann und meiner Familie danke. Eine große Hilfe waren mir auch diesmal wieder meine beiden „Sommers“, mit denen ich viele inspirierende Gespräche führen durfte. Ein besonderer Dank gilt Hendrik Buchna, der dem Manuskript durch seine tolle Arbeit erst den letzten Schliff gegeben hat. Ich glaube, Mr. Ondragon muss Rocky Beach demnächst mal einen Besuch abstatten.
Und natürlich will ich auch meinen Verleger Ivar Leon Menger nicht vergessen, der das wunderbare Talent hat, andere mit seinen Ideen und seiner Begeisterung anzustecken. Es macht viel Spaß, mit ihm und allen anderen zusammenzuarbeiten.
Prolog
12. Januar 2010
Süd-Haiti, auf der Route 208 in Richtung Nan Margot
16.25 Uhr
Der Himmel drohte mit Regen. Die Wolken hingen in den Bergen, als wollten sie diese verschlingen. Grau fraß der Dunst sich die steilen Hänge hinab und löschte die Sicht auf Felsen und Bäume.
Christine Dadou beeilte sich. Sie wollte nicht nass werden. Wollte nicht, dass ihre schöne neue Schuluniform, ein rosa Kleid, für das ihre Mutter eisern gespart hatte, mit dem Schmutz der unbefestigten Straße besudelt wurde. Denn bei Regen verwandelte sie sich innerhalb von Sekunden in einen schlammigen Fluss.
Mit eingezogenem Kopf eilte Christine weiter und dachte an ihren Vater. Seit seinem Verschwinden vor drei Monaten war das Leben ihrer kleinen Familie noch beschwerlicher geworden. Sein mageres Einkommen als Blechschmied fehlte hinten und vorne, oft mussten Christine und ihr kleiner Bruder nach der Schule der Mutter bei der Arbeit auf dem Feld helfen. Christine war neun und ihr Bruder sieben. Sie besaßen nicht viel, lebten in einer kleinen Hütte aus Brettern und Wellblech auf einem winzigen Stück Land, auf dem sie Mais, Bananen und Kürbis anbauten. Zum Glück verlief hinter dem Grundstück ein kleiner Bach, so mussten sie das Wasser für den Haushalt wenigstens nicht von weit her schleppen wie einige ihrer Klassenkameradinnen. Das war der einzige Luxus, den sie hatten.
Christine bog auf den schmalen, steilen Pfad ein, der die Serpentinen der Passstraße abkürzte. Er führte durch einen Wald aus Kapok- und Gummibäumen. Christine kannte jeden Stein und jede Biegung, doch heute im Nebel der tiefhängenden Wolken wirkte der Pfad unheimlich und fremd. Wie ein Weg in die Geisterwelt.
In die Welt der Loas.
Dem Mädchen fröstelte, obwohl tropische Schwüle herrschte. Normalerweise wäre Christine jetzt mit den anderen Schulkindern aus dem Dorf unterwegs gewesen. Sie alle hatten denselben Schulweg und gingen immer gemeinsam, doch heute war ihr nicht wohl und die Lehrerin hatte sie früher aus dem Unterricht entlassen. Christine fühlte sich in letzter Zeit immer trauriger und weinte häufig, weil ihr der Vater fehlte.
Unbewusst hob sie die Hand an die Brust und umklammerte das Gris-Gris, das sie um ihren Hals trug. Ihre Mutter hatte das Amulett von der Mambo im Dorf gekauft. Es war ein Abwehrzauber. Auch ihre Mutter und ihr Bruder trugen eins.
Der Dunst wurde dichter und kroch zwischen den Stämmen der Bäume hindurch den Berg hinab. Ängstlich hob Christine den Blick hinauf ins Geäst. Sie fürchtete, dass Marinette-bois-chèche auf der Jagd war. Ein bösartiger Loa, der gern Menschenfleisch fraß. Marinette flog als Schleiereule verwandelt durch die Wälder und stürzte sich lautlos auf ihre Opfer, um sie zu verschlingen.
Christines Schritte wurden schneller. Der Wald war voller Geister. Sie wohnten in den Bäumen, in den Tümpeln und unter der Erde. Auch Werwölfe trieben sich hier herum. Eindringlich hatte ihre Mutter sie davor gewarnt, mit fremden Frauen mitzugehen, auch wenn sie noch so nett erschienen und ihr Hilfe anbieten würden. Dahinter verbarg sich meistens ein Loup-Garou, der es auf kleine Kinder abgesehen hatte.
Christine spürte, wie ihr Herz immer härter gegen die Rippen schlug. Ihr schmaler Brustkorb hob und senkte sich mit jedem ängstlichen Atemzug. Ihre Mutter sagte auch, dass ein Bokor in der Gegend sein Unwesen trieb, ein böser Zauberer. Desgleichen erzählten die Leute im Dorf davon. Sie behaupteten, dass die blancs, die sich vor drei Jahren oben in der verlassenen Mine in den Bergen niedergelassen hätten, mit dem Bokor zusammenarbeiteten. Denn seit die Fremden da waren, verschwanden immer wieder Menschen aus den umliegenden Dörfern. So auch Christines Vater, Etienne Dadou. Eines Tages war er nicht mehr aus Jacmel zurückgekehrt, wo er auf dem Markt regelmäßig seine selbstgemachten Blechsachen verkaufte. Für die Dorfleute war sofort klar, dass der Bokor der blancs damit zu tun hatte. Aber keiner unternahm etwas. Alle fürchteten sich. Auch Christines Mutter blieb tatenlos. Gegen einen Schwarzmagier könne man nichts machen, außer sich mit Gegenzauber schützen, sagte sie. Aus diesem Grund hatte sie drei ihrer besten Hühner im Tempel gegen die Gris-Gris-Anhänger getauscht.
Christine wusste nicht, was die blancs dort oben in den Bergen trieben, und es war auch verboten, in die Nähe der Gebäude zu kommen, die sie gebaut hatten. Aber natürlich war sie neugierig gewesen. Sie hatte noch nie einen Menschen mit weißer Haut gesehen und sich deshalb über das Verbot hinweggesetzt. Heimlich war sie in die Berge hinaufgestiegen, um einen blanc zu sehen.
Christine horchte auf. Irgendwo vor ihr im Wald hatte es geknackt. Im Nebel erschienen ihr die Silhouetten der Büsche und Felsen wie unheimliche Wesen, doch sie wusste, dass ihre Fantasie ihr nur einen Streich spielte. Dort war niemand.
Ihre Gedanken schweiften wieder zu den Fremden in den Bergen. Ihnen zu begegnen, war zunächst beängstigend gewesen, doch dann hatte sich ihre Furcht schnell in Enttäuschung gewandelt. Sie war ganz nah an das Lager der blancs herangeschlichen, bis zum beißenden Zaun, der dort gespannt war. Unter einem Busch liegend hatte sie so lange gewartet, bis etwas geschah. Nach einer ganzen Weile waren zwei Gestalten aus einem der Gebäude herausgekommen. Sie hatten sich Zigaretten angezündet und sich in einer fremden Sprache unterhalten. Beängstigend war gewesen, dass sie von Kopf bis Fuß weiß waren. Sie trugen weiße Hosen und Hemden und komische Hauben, und ihre Haut war so blass wie die Knochen, welche die Mambo in ihrem Tempel zum Beschwören der Geister benutzte. Die Gestalten sahen aus wie die beiden leibhaftigen Todesgeister: der Kreuzsammler Ramassent-de-croix und General Fouillé, von dem es hieß, er durchwühle nachts die Gräber auf Friedhöfen.
Am liebsten wäre Christine sofort weggelaufen, doch ihre Neugier war stärker gewesen. Und je länger sie den beiden weißhäutigen Wesen dabei zugesehen hatte, wie sie sich unterhielten und miteinander scherzten, desto klarer wurde ihr, dass dies keine Gèdè-Geister waren. Sie sahen zwar aus wie lebendig gewordene Skelette, entpuppten sich aber lediglich als Menschen. Männer aus Fleisch und Sehnen. Enttäuscht hatte Christine den Ort verlassen.
Ein erneutes Geräusch holte sie zurück in die Wirklichkeit.
War da ein Stöhnen zu hören?
Nervös schaute Christine sich um. Der Nebel war inzwischen so dicht geworden, dass sie ihn schmecken konnte. Mit jedem Atemzug floss er über ihre Lippen in ihre Lungen; feucht und mit erdigem Aroma. Wie der Atem des Grabes, dachte sie und erschauerte. Schnell setzte sie sich in Bewegung.
Als der Weg endlich bergab führte, begann sie zu laufen. Das Klatschen der abgetragenen Sohlen ihrer Sandalen auf dem harten Boden vereinte sich mit ihrem hämmernden Herzschlag. Es war nicht mehr weit bis zu der Stelle, an welcher der Pfad wieder auf die Straße führte. Von dort aus konnte man das Dorf schon sehen. Nur noch durch die schmale Schlucht und über den kahlen Buckel und dann …
Plötzlich stand eine Gestalt vor ihr, ragte wie ein Grabstein aus der Erde.
Erschrocken bremste Christine ihren Lauf, um nicht mit ihr zusammenzuprallen. Dabei verlor sie das Gleichgewicht und fiel hintenüber. Sie wollte ihren Sturz abfangen, doch ihre schmalen Handgelenke knickten einfach weg. Ein stechender Schmerz schoss ihre Arme hinauf, und das neue Kleid landete im Schmutz. Tränen traten Christine in die Augen. Mit bebenden Lippen sah sie auf. Sie musste blinzeln, um durch den Tränenschleier etwas erkennen zu können.
Vor ihr stand ein Mann. Ein schwarzer Mann, doch seine Haut wirkte auf merkwürdige Weise weniger schwarz, sondern eher grau. Eine totengleiche Blässe überzog seine Arme und Hände, fast wie bei einem blanc. Er war bis auf die Knochen abgemagert und trug zerschlissene Kleidung, die von seinen Gliedmaßen hing wie zerfetzte Mullbinden. Seine Haltung war gebeugt, sein Gesicht mit Beulen übersät und entstellt.
Leicht schwankend, als hätte er zu viel Clairin getrunken, kam er auf Christine zu. Ein Arm hob sich ihr mechanisch entgegen und ein undefinierbarer Laut drang aus seiner Kehle. Verwesungsgeruch stieg ihr in die Nase.
Hastig rappelte Christine sich auf und wischte sich über die Augen, um besser sehen zu können.
Ihr Atem stockte.
Noch mehr Tränen quollen aus ihren Augen.
„Papa?“, hauchte sie ungläubig, als der feuchte Nebel ihr wieder Luft zum Atmen gab.
Der Mann, in dem sie ihren Vater erkannte, sagte nichts. Seine Augen waren milchig trüb wie bei einem kranken Hund und starrten an ihr vorbei. Aus seinem Mund troff gelblicher Speichel. Er machte einen weiteren schwankenden Schritt auf sie zu. Seine Finger mit den zersplitterten Nägeln bogen sich zu Krallen.
„Papa?”
Plötzlich schoss eine Hand vor und legte sich um Christines Hals.
„Papa! Was machst du?“, brachte sie mit Mühe hervor. Entsetzt starrte sie in das entstellte Gesicht. Brutal presste die Hand ihr die Luft ab. Schwarze Punkte tanzten vor ihren Augen.
„Papa, ich bin es!“ Es war ein tonloses Krächzen. Verzweiflung packte Christine. Da fiel ihr das Gris-Gris ein und sie tastete mit einer Hand danach. Sie fühlte ihre Kräfte schwinden. Warum tat ihr Vater das?
Aber sie wusste es längst.
Er war nicht mehr ihr Vater.
Er war ein Zombie Cadavre - ein wiedererweckter Toter!
Mit letzter Kraft riss Christine sich das Schutzamulett vom Hals und stopfte es dem Zombie in den Mund, der ihr so nah gekommen war, dass sein fauliger Gestank sie einhüllte.
Mit einem schrillen Schrei ließ der Zombie von ihr ab und versuchte, sich das Gris-Gris aus dem Mund zu holen. In wilder Raserei drehte er sich um sich selbst und schrie dabei mit seltsam verzerrter Stimme. Beißender Qualm drang aus seinem Mund. Es roch nach verkohltem Fleisch.
Nach Atem ringend sah Christine zu, wie der Zombie sich mit Gewalt den Unterkiefer herunterriss. Knochen knackten und das Gelenk gab nach. Aber der Zombie wütete weiter, ohne Schmerz zu verspüren, bis er schließlich das Gris-Gris in der blassen Hand hielt.
In diesem Moment gelang es Christine, ihren Blick von dem Schreckensbild loszureißen. Ohne auf den kleinen Beutel mit den Schulutensilien zu achten, den sie hatte fallen lassen, rannte sie los. In waghalsig großen Sätzen stolperte sie den Weg hinab, bog hastig auf die Straße ein und lief in Richtung Dorf. Hinter ihr herrschte Stille. Dennoch traute sie sich nicht, sich umzuschauen. Sie rannte, bis ihr die Lunge zu zerspringen drohte. Ihre Muskeln brannten wie Feuer. Bald würden ihre Beine sie nicht mehr tragen können.
Die ersten Regentropfen trafen auf ihre Stirn, als sie mit letzter Kraft die Ansammlung von ärmlichen Hütten erreichte. Sie schrie, doch niemand kam ihr zu Hilfe. Das Dorf war wie ausgestorben. Wo waren alle?
In Panik lief sie zu ihrem Haus. „Mama? Mama!“ Doch auch das war leer. Christine warf die Tür zu und verriegelte sie. Schnell verkroch sie sich unter dem Bett. Gegen die Trommelschläge ihres rasenden Herzens anlauschend blickte sie zur Tür.
Stille.
Dann ein Scharren. War das ihre Mutter? Sie wollte gerade nach ihr rufen, da hörte sie das Stöhnen. Der Schweiß gefror ihr auf der Haut. Er war da vor der Tür. Das schreckliche Bild von der aschfahlen Fratze mit dem ausgerenkten Kiefer ließ sie am ganzen Köper zittern. Christine wusste, dass sie nun nichts mehr tun konnte, falls der Zombie zu ihr in die Hütte käme. Ihr Gris-Gris war weg. Sie hatte keinen Schutz mehr.
An der Tür erklang ein Schaben. Zersplitterte Fingernägel auf rauem Holz.
Der Zombie versuchte, sie zu öffnen, schaffte es aber nicht. Er stieß ein frustriertes Röcheln aus. Gurgelnd, unartikuliert.
Dann erneute Stille.
Ein Scharren an der Seitenwand der Hütte.
Christine wagte es kaum zu atmen. Von der wilden Flucht rauschte ihr noch immer das Blut in den Ohren. Ihre Augen suchten im Dunkel der Hütte nach einer Waffe. Regen begann laut auf das Wellblechdach zu trommeln.
Ein weiteres Scharren.
Plötzlich flog die Tür auf. Ein schwarzer Schatten stand im hellen Viereck. Ein Schatten mit verrenktem Kiefer. Christine schrie auf und versuchte, noch weiter unter das Bett zu kriechen. Sie hörte die schweren Schritte des Zombies. Sie näherten sich dem Bett.
Bondieu, dachte sie, bitte beschütze mich. Dann hörte sie nur noch ein ohrenbetäubendes Donnern. Etwas Schweres stürzte auf das Bett über ihr, und Staub drang ihr in Mund und Nase.
Die Welt wankte. Der Boden bäumte sich auf, als versuchte er, die Menschheit abzuwerfen. Sämtliche Geister der Erde waren erzürnt aus ihrem Schlaf erwacht.
16.53 Uhr.
In der Hauptstadt Port-au-Prince fiel der Regierungspalast in sich zusammen, mit ihm unzählige weitere Gebäude. Zehntausende von Menschen wurden lebendig unter den Trümmern begraben.
16.54 Uhr.
Stille.
1. Kapitel
04. Februar 2010
Los Angeles, Kalifornien
7.25 Uhr
Der Morgen war dunstig und die Sicht über L.A. mies. Trotzdem schaute Paul Ondragon durch das armdicke Teleskop. Das lichtstarke Okular erfasste das schattenhafte 28-stöckige Hochhaus am Sunset Boulevard zu Füßen der westlichen Hollywood Hills, und Ondragon stellte es scharf. Die einzelnen Fenster an der Nordfassade des Gebäudes der Golden State Credit Bank waren gut zu erkennen. Hinter einigen davon konnte er schon Menschen bei der Arbeit sehen. Bläulich leuchteten ihre Computermonitore. Das waren die frühen Vögel. Ihnen würde er sich gleich anschließen. Doch vorher sameprocedure as every morning.
Ondragon schwenkte das Teleskop auf das oberste Stockwerk, auf das letzte Bürofester ganz links. Er blickte auf die Uhr. Kurz vor halb acht. Er ließ eine Minute verstreichen. Dann sah er, wie das Licht in dem Büro angeschaltet wurde, und ein Lächeln legte sich auf seine Lippen. Kurz darauf erschien Charlize Tanaka am Fenster des Büros und goss die Yuccapalme auf der Fensterbank mit einer roten Gießkanne. Das war das verabredete Zeichen. Alles in Ordnung. Keine Unregelmäßigkeiten.
Einen Moment lang schaute seine Assistentin aus dem Fester und setzte sich dann an ihren Schreibtisch.
Es war kein Zufall, dass Paul Eckbert Ondragon im obersten Stockwerk jenes Bankgebäudes sein Büro hatte. Das gesamte Hochhaus war so sicher wie Fort Knox gegen Einbrüche geschützt (naja, fast wie Fort Knox) und, was viel wichtiger war, von seiner Villa am Doheny Drive aus gut zu beobachten. Das Gebäude bot ihm den optimalen Arbeitsort – obwohl es sich dabei ironischerweise um eine Bank handelte und seine Prinzipien es ihm verboten, jemals für Banken zu arbeiten. Dennoch sprach nichts dagegen, in einer Bank zu arbeiten. Schließlich wurden Banken durch modernste Überwachungstechnik geschützt, und dieses spezielle Kreditinstitut verfügte gleich über mehrere ausgeklügelte Fluchtwege für ihn und Charlize – falls es mal brenzlig werden sollte. Aber wer brach schon bei einer Bank im obersten Stockwerk ein, wenn sich der Tresor im Keller befand?
Zufrieden wandte sich Ondragon vom Teleskop ab, das vor dem großen Panoramafenster im Wohnzimmer aufgebaut war, und ging zum Tresen der offenen Küche, wo der dreifache Espresso auf ihn wartete, den er morgens stets zu sich zu nehmen pflegte. Mit einem großen Schluck leerte er die Tasse, griff nach seinem Jackett, das auf der Stuhllehne am Esstisch hing, und fühlte routinemäßig in seiner Hosentasche nach dem Autoschlüssel. Dabei fuhren seine Finger über den Talisman, der an dem Schlüssel hing, ein kitschiger Berliner Bär, der ihm vor einigen Jahren das Leben gerettet hatte.
Alles war an seinem Platz, er konnte sich also beruhigt auf den kurzen Weg zur Arbeit machen. Als er gerade die Haustür öffnen wollte, klingelte sein Handy. Mit gerunzelter Stirn fischte er das iPhone aus dem Jackett, sah auf das Display, und die Falten auf seiner Stirn wurden noch tiefer. Die Vorwahl der Nummer war die der Vereinten Arabischen Emirate, jedoch hatte er dort im Moment keinen Auftrag laufen.
Nach einem weiteren Klingeln beschloss er dranzugehen. „Ondragon!“
„Hi, Ecks! Bis du gerade bei einem Job, oder können wir sprechen?“
Ecks – das war eine etwas eigenwillige Abkürzung für Eckbert. Und nur ein Mensch auf der ganzen Welt nannte ihn so. Ondragons Züge erhellten sich. „Rod! Na so was! Schön, von dir zu hören. Nein, ich bin frei, du kannst sprechen. Was gibt es denn? Und warum hast du eine Nummer aus den UAE?“
„Ach, weißt du, ich habe das Mainoffice von DeForce Deliveries vor zwei Monaten von Mombasa nach Dubai verlegt. Hier hat man mir einfach bessere Konditionen angeboten. Und, wo treibst du dich rum?“
„Du wirst es nicht glauben, Rod, aber ich bin zu Hause.“
„Nicht zu fassen. Das ist aber ein seltener Zustand.“
„Kannst du wohl sagen, die Geschäfte laufen nicht schlecht in letzter Zeit. Die Mädels von American Airlines sehe ich öfter als meine Assistentin im Büro. Und wie steht‘s bei DeForce?“
„Ich kann nicht klagen. Die Krisenherde der Welt werden nicht weniger, und überall benötigt man unsere Spezialtransporte. Aber das ist nicht der Grund, warum ich dich anrufe, Ecks. Ich meine, um mit dir über das Business zu plaudern.“
Vielleicht hatte Ondragon sich das eingebildet, aber sein alter Freund klang beim letzten Satz auf einmal nicht mehr ganz so fröhlich. „Sondern?“, hakte er nach.
„Nun, Ecks, es ist so … ich brauche deine Hilfe!“
Ondragon legte das Jackett beiseite und setzte sich auf den Stuhl am großen Esstisch. Wenn Roderick DeForce seine Hilfe benötigte, dann musste er wirklich tief in der Scheiße stecken. „Schieß los“, sagte er.
„Einer meiner Mailmen ist verschwunden. Du kennst ihn nicht, er ist erst seit vier Jahren bei uns. Aber er ist ein sehr guter Mann. Zuverlässig. Tyler Ellys heißt er und wohnt in Tucson. Er bearbeitet zusammen mit ein paar anderen Kollegen Mittel- und Südamerika.“
„Ich wusste gar nicht, dass du auch auf unseren Kontinent expandiert hast.“
Der Boss von DeForce Deliveries lachte. „Tja, man geht mit der Zeit, obwohl das meiste immer noch in der arabischen Welt und in Afrika zu holen ist. Daran hat sich nichts geändert, seit du uns verlassen hast, Ecks. Was ich im Übrigen immer noch bedauere. Aber du warst schon immer auf einem ganz anderen Zug unterwegs. Einem Expresszug mit defekten Bremsen.“
„Sehr charmant, Rod.“
„Du weißt, wie sehr ich dich schätze, Ecks.“
In der Tat, das wusste Ondragon. Der fünfzehn Jahre ältere Roderick DeForce hatte ihn unter seine Fittiche genommen, als er in der wirren Zeit nach seinem Studium nicht so recht gewusst hatte, wohin mit sich und seinem beinahe krankhaften Zwang, jedes Problem lösen zu wollen, das sich ihm darbot. Der gebürtige Brite hatte Ondragons ungewöhnliches Talent erkannt und ihn zu DeForce geholt. Dabei hatte Rod seinem Schützling nicht nur uneingeschränktes Vertrauen in seine Fähigkeiten geschenkt, er war auch so etwas wie eine Vaterfigur für ihn gewesen.
Mehr Vater, als der Mann, der mich aufgezogen hat, dachte Ondragon bitter. Die Zeit bei DeForce Deliveries war eine verdammt gute gewesen. Dort hatte er viele „nützliche“ Dinge gelernt, die ihm jetzt zugute kamen.
„Und was hat es jetzt mit diesem Tyler Ellys auf sich?“, fragte er seinen ehemaligen Boss.
„Nun, wie ich schon sagte, er ist verschwunden. Den genauen Zeitpunkt kenne ich nicht, aber er ist gestern nicht bei seinem Job aufgetaucht. Er hatte seine Order via Bulletinboard im Internet bekommen wie üblich, aber die anderen Jungs haben vergeblich am Flughafen von Buenos Aires auf ihn gewartet. Ellys war immer zuverlässig. Dass er nicht erschienen ist, sieht ihm nicht ähnlich. Ich habe einen Springer zu ihm nach Tucson geschickt, um nachzusehen, wo er steckt. Sein Haus ist leer, sein Auto steht in der Garage. Keine Spur von Ellys.“
„Und was sagt die Polizei dazu? Du hast sie doch sicher eingeschaltet.“
„Das ließ sich nicht vermeiden. Die Cops haben Ellys‘ Haus oberflächlich untersucht, aber nichts gefunden. Auch die Nachbarn haben nichts gesehen, absolute Fehlanzeige.“
„Und was gedenkt die Polizei zu unternehmen?“
„Ach, du weißt doch, wie die Truppe ist“, schnaubte Rod wütend. „Wenn es keinerlei Hinweise auf eine Gefährdung der Person gibt, kommt der Fall auf den Ablagestapel. Und da liegt er dann zusammen mit sämtlichen Vermisstenfällen, die es in den USA seit Beginn des vorigen Jahrhunderts gegeben hat.“
„Vielleicht ist Tyler Ellys ausgestiegen“, gab Ondragon zu bedenken. „So etwas kommt doch immer mal wieder vor. Die Jungs verkraften nicht, was sie bei den Jobs zu sehen bekommen, und quittieren den Dienst.“
„Nicht Ellys. Der ist ein Ex-Navy-Seal. Ein ganz harter Bursche. Für den lege ich meine Hand ins Feuer. Der hat auch die schmutzigen Sachen erledigt, ohne mit der Wimper zu zucken.“
„Wo war er denn als letztes?“
„In Mexiko, Leichentransport von Monterrey nach Nuevo Laredo an der Grenze.“
Leichentransport. Was das hieß, wusste Ondragon noch zu gut. Eine kritische Ware wurde in einem Sarg und mit einer echten Leiche getarnt durch ungesichertes Gebiet an den Zielort überführt. Schwieriges Terrain, feindliche Kräfte, gefährliche Fracht – kein Problem. Für so etwas gab es DeForce Deliveries. Ein privater Lieferdienst sozusagen. Die Kundenliste war lang und erlaucht. Nicht nur Firmen buchten die Mailmen von DeForce, auch staatliche Behörden, wenn diese mit ihren herkömmlichen Mitteln nicht mehr weiterkamen. Ondragon hatte selbst solche Transporte in Somalia und Afghanistan durchgeführt, als er Anfang der Neunziger bei DeForce unter Vertrag gestanden hatte. Riskante Missionen, die nicht wenige Männer das Leben gekostet hatten. Aber er war damals stolz darauf gewesen, einer dieser knallharten Mailmen zu sein – denn Rod beschäftigte nur die besten und abgebrühtesten Männer.
Gegen alle Vermutungen war DeForce ein legales Unternehmen. Ein Dienstleister wie Fed Ex, nur eben von der extremen Sorte. Und Roderick DeForce war Gründer und Haupteigner der Firma, die er 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer ins Leben gerufen hatte, zunächst mit Sitz in Kairo. Aber auch wenn Rod selbst nicht rausging, hielt er doch wie eine Spinne im Netz alle Fäden in der Hand und überwachte sämtliche Aktionen von seinem Büro aus. Daher lautete sein Deckname innerhalb der Firma auch „Spider“.
Spider hörte alles und sah alles, denn er besaß Zugang zu mehreren privaten wie staatlichen Satelliten. Er wusste immer, welche Aktion wo stattfand und mit welcher Crew. Ondragon hegte den Verdacht, dass das Verschwinden von Tyler Ellys seinen Freund gerade aus diesem Grund wurmte. Rod hatte einen Mitarbeiter aus den Augen verloren und das bedeutete, er hatte keine Kontrolle mehr über ihn. Ondragon wusste, wie sehr Rod es hasste, wenn sich jemand oder etwas seinem Einfluss entzog.
„Und was genau willst du jetzt von mir?“, fragte er seinen alten Tutor.
Roderick DeForce zögerte, als fiele es ihm schwer, seinen ehemaligen Mitarbeiter um einen Gefallen zu bitten. Ondragon fragte sich, was seinen Freund bewogen hatte, ausgerechnet ihn zu kontaktieren. Hatte Rod doch jede Menge fähiger Leute in seinen eigenen Reihen.
Vielleicht ist es etwas Internes, dachte er. Etwas, das nur ein Außenstehender erledigen kann. Jemand, der sein absolutes Vertrauen genießt.
„Ecks, das klingt jetzt womöglich etwas banal, aber ich möchte dich damit beauftragen, Tyler Ellys zu finden“, sagte Rod schließlich. „Meine Leute sind dafür nicht ausgebildet. Das sind keine Detektive.“
„Das bin ich auch nicht.“
„Ich weiß, Ecks, Vermisstenfälle sind viel zu trivial für dich, du brauchst anspruchsvollere Nüsse zum Knacken.“
„Rod, bei aller Liebe, ich …“
„Ich bitte dich als Freund. Und selbstverständlich erhältst du ein Honorar zu deinen üblichen Konditionen. Außerdem sollte der Fall trotz allem eine gewisse Herausforderung für dich darstellen, wenn ich dir erzähle, was mein Springer im Haus von Ellys gefunden hat, bevor die Polizei es finden konnte.“
Ondragon seufzte. Konnte er seinem alten Freund diesen Gefallen abschlagen? Natürlich nicht. Außerdem siegte wie immer seine Neugier. „Einverstanden, Rod. Dann mal los. Was hat er gefunden?“
„Vielen Dank, Ecks. Ich stehe tief in deiner Schuld.“
„Schon gut, lad‘ mich einfach mal in dein neues Büro nach Dubai ein.“
„Das Ticket ist schon gebucht!“ Rod lachte kurz auf. Er schien erleichtert zu sein. Dann wurde er wieder ernst. „Also, mein Springer verschaffte sich Zutritt zum Haus. Die Räume sahen aus, als hätte Ellys sie eben erst verlassen. Im Wohnzimmer lief der Fernseher und drei leere Bierdosen standen neben einem Dutzend vollen. Sonst war nichts Ungewöhnliches zu entdecken, trotzdem durchsuchte der Springer sorgfältig das Haus, wie ich es ihm aufgetragen habe. In der Mülltonne fand er schließlich einen zerknüllten Brief. Es war ein weißer Umschlag mit nur einem Bogen Papier darin. Darauf stand – und das ist seltsam – auf Französisch: Tyler Ellys, dein Körper soll eine leere Flasche sein. Darunter war ein Sarg gemalt.“
„Und was soll das bedeuten? Ist das eine Morddrohung?“ Ondragon war nicht sonderlich beeindruckt von dieser Enthüllung. Seine Motivation für diesen Fall wollte nicht so richtig in Gang kommen.
„Ich weiß es nicht. Der Springer hat den Brief. Du solltest dich mit ihm in Tucson in Verbindung setzen, ich schicke dir seine Nummer per SMS. Er kann dir alles erzählen, was er weiß.“
Ondragon überlegte. Ein verschwundener Mailman, ein Brief auf Französisch, keine Spuren. Das klang nicht gerade spannend. Jedoch bat Roderick DeForce persönlich um seine Mithilfe und das allein machte den Fall interessant. „Nun gut“, lenkte Ondragon ein, „mein Mustang müsste sowieso mal wieder bewegt werden. Ich mache mich so bald als möglich auf den Weg. Ich melde mich, wenn ich in Tucson bin.“
Am anderen Ende erklang ein erleichtertes Seufzen. „Vielen Dank, Ecks.“
„Nichts zu danken.“
„Und pass auf dich auf!“
Nachdem er aufgelegt hatte, starrte Ondragon das Telefon an. In all der Zeit, die er für Roderick DeForce gearbeitet hatte, hatte dieser niemals Pass auf dich auf! gesagt. Merkwürdig, dass er es ausgerechnet jetzt tat. Aber vielleicht war sein Freund auch einfach alt geworden. Und das Alter brachte bekanntlich nicht nur körperliche Gebrechen mit sich, sondern auch das Gespenst der Angst. Und war es erst einmal erschienen, haftete es an einem wie eine Krankheit.
Je länger Ondragon darüber nachsann, desto stärker überkam ihn das Gefühl, dass mehr hinter dem Verschwinden von Tyler Ellys stecken könnte, als er zunächst angenommen hatte. Und auch mehr, als Rod am Telefon hatte zugeben wollen.
Er drückte auf die Wahltaste und rief Charlize an. Heute würde er nicht ins Büro kommen.
2. Kapitel
04. Februar 2010
irgendwo auf dem Interstate Highway 10 nach Osten
15.40 Uhr
Nach Tucson waren es genau 501 Meilen. Acht Stunden Fahrt durch die trockensten Wüsten des Kontinents – die Mojave und Sonora Desert, eine lebensfeindlicher als die andere. Doch sein betagter 69er Mustang ignorierte tapfer die Tatsache, dass sein schwarzes Äußeres die Sonnenstrahlen förmlich ansaugte, während die Hitze flirrende Fata Morganas auf die schnurgerade Straße zauberte. Drinnen im kühlen Hauch der Klimaanlage saß Ondragon am Steuer, kaute Kaugummi und hörte laut I’m easy von Faith No More. Sein rechter Cowboystiefel lag locker auf dem Gaspedal und auf seinem Gesicht ein entspannter Ausdruck.
Der Grund, warum er die Wüste mochte, war, dass es leere Natur war. Hier gab es nichts, was einem auf die Nerven gehen konnte. Keine Mücken, keine größeren Tiere wie Bären oder Wölfe, die einen mit einem Lachshäppchen verwechselten, und kein tückisches Unkraut, das danach trachtete, einen zu Fall zu bringen. Und das Beste: Man hatte freie Sicht in alle Richtungen! Ein Feind hatte es also schwer, sich unbemerkt an ihn heranzuschleichen. Kein Wasser bedeutete auch: kein Leben. Kein Leben: keine bösen Überraschungen. Die Wüste war ein sehr klarer, einfacher Ort. Nicht wie der Wald, wo alles zugewuchert und unwegsam war.
Nur ungern erinnerte sich Ondragon an seinen Aufenthalt in Minnesota vergangenen Sommer. Dort hatte ihm der Wald sein bösartiges Wesen offenbart. Er war ein grünes Biest, das Menschen verschlang und nicht wieder ausspuckte. Und dann das Viehzeugs dort … Nein, wenn schon draußen im Freien, dann in der Wüste! Obwohl die Arktis bestimmt auch so ihre Vorteile besaß. Ein kaltes weißes Nichts. Herrlich!
Dergestalt in Gedanken versunken glitt Ondragon in seinem Mustang dahin und näherte sich Meile um Meile seinem Ziel. Im Rückspiegel sank die Sonne am Horizont immer tiefer und die karge, kakteenbewachsene Landschaft um ihn herum verwandelte sich in das legendäre Farbenspiel einer Achtzigerjahre-Fototapete, bevor die Finsternis sich mit undurchdringlicher Schwärze herabsenkte.
Die Stadt Tucson tauchte aus der Wüstennacht auf wie ein rettender Hafen im dunklen Meer. Eine strahlende Oase im Nichts. Einladend glommen die Lichter und verhießen kühle Getränke und Gesellschaft. Alles, was ein einsamer Wüstenreiter sich wünschen konnte nach einem staubigen Tag auf der Piste.
Ondragon checkte im Hotel Congress in Downtown ein. Es galt zwar als etwas laut und unkomfortabel, aber die Bar und das Essen hatten den Ruf, von allerbester Güte zu sein. Viel essentieller aber war, dass in dem hip zurechtgestylten Backsteingebäude von anno 1920 immer reger Betrieb herrschte, man also ein- und ausgehen konnte, ohne bemerkt zu werden. Auch zu später Stunde. Dafür nahm Ondragon die Unannehmlichkeiten des kleinen, nicht allzu luxuriösen Zimmers in Kauf. Normalerweise gönnte er sich nur die besten Hotels. Wenn man wie er ständig unterwegs war, dann waren ein sauberes, bequemes Bett und guter Service unverzichtbar.
Nachdem er seine Reisetasche aufs Zimmer gebracht und die Etage nach etwaigen Fluchtwegen untersucht hatte, ging er hinunter in die Lobby, bestellte sich etwas zu essen und genehmigte sich einen Whiskey Sour an der Bar. Für heute war es genug. Die eintönige Fahrt hatte ihn geschlaucht. Er würde sich morgen früh mit dem Springer in Verbindung setzen und danach das Haus von Tyler Ellys selbst in Augenschein nehmen. Ein kleiner Vorabcheck aus gebührender Entfernung, bevor er zur näheren Durchsuchung schritt.
„Ja?“, fragte eine brüchige Männerstimme am andern Ende des Telefons, nachdem Ondragon am Morgen auf seinem Zimmer die Nummer des Springers gewählt hatte.
„Kaplan Bolič?“
„Ja.“
„Hier spricht Mr. O, Spider hat mich beauftragt, mit Ihnen in Verbindung zu treten im Fall des verschwundenen Mailman.“ Er benutzte vorsichtshalber die DeForce-Decknamen.
„Ich weiß Bescheid. Ich bin im Hotel Arizona, Zimmer 506. Kommen Sie einfach zu mir, Mr. O.“
Das ist nicht weit entfernt, dachte Ondragon. Nur ein paar Blocks. „Gut, ich komme gegen Mittag“, sagte er.
„Ich bin da. Es geht mir sowieso beschissen. Habe mir wohl ‘ne Grippe oder so was eingefangen. Kopf- und Gliederschmerzen. Bleibe deshalb auf dem Zimmer.“
„Ich wollte mir zuerst das Ellys-Haus ansehen. Gibt es vorab schon etwas, das ich wissen sollte?“
Bolič hustete lautstark. „Ich habe alles gründlich durchsucht. Bis auf den Brief habe ich nichts gefunden. Das Einzige, das mir aufgefallen ist, war, dass die Vorhänge zugezogen waren und der Fernseher lief, als ich ankam. Ach ja, und das offene Bier.“
„Könnte bedeuten, dass Ellys am Abend oder in der Nacht verschwunden ist.“
„Das vermute ich auch.“
„Und die Polizei?“, fragte Ondragon weiter.
„Die glaubt, er sei abgehauen. Weiß der Geier, warum. Sie sagen, das kommt öfter vor, als man denkt. Schulden, Stress mit ‘ner Frau oder einfach nur Wüstenkoller.“
„Wüstenkoller?“
„Ja, es soll Menschen geben, die halten die ewige Sonne und die öde Landschaft hier auf Dauer nicht aus.“
„Hat das Haus Tyler Ellys gehört?“
„Ja, er hat es vor drei Jahren gekauft, kurz nachdem er bei DeForce angefangen hat.“
„Wo ist er geboren?“
Der Mann am anderen Ende hustete erneut. „In Denver. Oh Mann, mir ist ganz schön schwindelig.“
Ondragon schürzte die Lippen. Das Ganze kam ihm merkwürdig vor. Niemand ließ einfach so sein Haus zurück, Wüstenkoller hin oder her. Da schien die Polizei wie so oft auf dem Holzweg zu sein. „Und der Brief?“, wollte er wissen.
„Nichts Besonderes, außer dem Text.“
„Ich hole ihn mir nachher bei Ihnen ab.“
„Sie können jederzeit vorbeikommen, Mr. O. Ach, und wären Sie vielleicht so freundlich, mir ein paar Paracetamol mitzubringen?“
„Geht klar.“ Ondragon steckte das Handy weg und überprüfte seine Pistole. Die leichte, in Europa als Polizeiwaffe eingesetzte Sig Sauer trug er immer in einem Holster unter seinem Jackett. Heute hatte er den feinen Zwirn allerdings gegen eine beigefarbene Windjacke und Jeans getauscht. Es empfahl sich nicht, in einer schlichten Wohngegend wie der von Tyler Ellys in maßgeschneidertem Anzug herumzulaufen, auch wenn das seine bevorzugte Arbeitskleidung war. Ondragon legte viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres, aber er wusste auch, wann welche Kleidung angemessen war. Das hatte er von seinem Vater, einem deutschen Diplomaten mit beinahe militärischen Manieren, unauslöschlich eingebläut bekommen. Diplomatie und gewandtes Auftreten waren alles – wenn es nach seinem Alten ging. Doch eines hatte Ondragon im Laufe seines Lebens dazugelernt: unauffällig zu sein war noch viel mehr! Für manche Unternehmungen war es unabdingbar, mit seiner Umgebung eins zu werden. Ondragon verglich sich selbst gern mit einem Tiger. Außerhalb des Bambuswaldes fiel er auf wie ein bunter Hund, doch bewegte er sich innerhalb seines Reviers, verschmolzen seine Streifen mit dem Geflecht des Dschungels und er wurde unsichtbar.
Er ignorierte das Gesetz Arizonas, seine Waffe immer offen zu tragen, und steckte die Waffe ins Holster. Dann erhob er sich von der Bettkante und ging in das winzige Bad, um im Spiegel zu kontrollieren, ob sein dunkles Haar die gewünschte Verwegenheit eines Wüstenbewohners aufwies. Danach löschte er das Licht und verließ das Zimmer.
Mit dem Taxi fuhr er zur nächstgelegenen Autovermietung, bei der Charlize tags zuvor einen Wagen für ihn hatte reservieren lassen, und übernahm einen langweilig silbernen Chevrolet Impala mit hiesigem Nummernschild und getönten Scheiben. Damit fuhr er auf den Highway in Richtung Osten, wo er die Abfahrt zum Pima Airfield nahm, dem größten Flugzeugfriedhof der Welt, und das nahezu mitten in Tucson. Meile um Meile folgte er der Straße, die zu beiden Seiten von ausgedienten Militärmaschinen hinter langen Stahlzäunen gesäumt wurde, bis er schließlich links in die Escalante Road einbog. Tylers Ellys‘ Haus lag in der East Barrow Street, die parallel dazu verlief. Langsam lenkte Ondragon den Wagen durch das auf dem Reißbrett angelegte Wohnviertel. Aufmerksam beobachtete er jedes Haus. Als er bei Ellys‘ Adresse anlangte, prägte er sich die Begebenheiten rund um das Gebäude sorgfältig ein und fuhr im gleichen Tempo weiter um nicht aufzufallen.
Wieder draußen auf der Escalante Road parkte er den Impala am Straßenrand neben ein paar Touristen, die raunend die stillgelegten Herrscher der Lüfte durch den Maschendraht fotografierten, und tat so, als interessiere er sich ebenfalls für die verschwenderische Menge an Leichtmetallschrott. Durch die Gläser seiner Sonnenbrille sah er sich dabei unauffällig um. Gegenüber auf der anderen Straßenseite lag das Wohnviertel, in dem sich Ellys‘ Haus befand. Die Nachbarschaft sah nicht gerade einladend aus mit der von der Wüstensonne zu gelblichen Skeletten verdorrten Vegetation in den Vorgärten.
Nach einer Weile löste Ondragon sich von der Gruppe und überquerte die Straße. Zwischen zwei Häusern, vor deren Garagen keine Autos standen, schlug er sich auf einem kleinen Weg zur hinteren Grenze zu Ellys‘ Grundstück durch und zwängte sich in eine buschbewachsene Lücke zwischen den hohen Lattenzäunen, welche die Grundstücke umschlossen. Durch ein Astloch beobachtete er den Garten und die Rückseite des Ellys-Hauses. Der Rasen war tot, und das schon seit längerem, obwohl mit Sicherheit eine unterirdische Sprinkleranlage vorhanden war. Tyler Ellys legte wohl nicht viel Wert auf einen grünen Garten. Auch das Haus machte keinen allzu frischen Eindruck. Obwohl es nicht älter als zehn Jahre sein konnte, hatte es einen neuen Anstrich dringend nötig, denn das Holz bleckte unter der aufgeplatzten hellbraunen Farbe hervor wie bleiche Knochen unter verwelkter Haut. Ondragon stellte fest, dass es keinen Zaun zwischen den Grundstücken Ellys und Diego gab. Offensichtlich verstand sich Ellys recht gut mit seinem Nachbarn. Nur bei der Rasenpflege war Mr. Diego augenscheinlich etwas gewissenhafter. Knallgrün und frisch beregnet leuchtete das Bahamasgras auf dessen Gartenhälfte im Licht des Vormittages. Auch die Fassade des Diego-Hauses war in jüngster Zeit gestrichen worden.
Ondragon begutachtete erneut das Eigenheim des Vermissten. Die Fenster waren noch immer mit Vorhängen verschlossen. Die Polizei hatte anscheinend nichts verändert.
Plötzlich huschte ein Schatten vor Ondragons Augen am Astloch vorbei. Schnell nahm er etwas Abstand vom Zaun. War da noch jemand, der das Haus beobachtete?
Leise Schritte waren auf der anderen Seite zu hören. Die Person schien direkt am Zaun zu stehen. Ondragon hielt den Atem an, weil er fürchtete, der andere könnte ihn hören. Es kratzte ein paar Mal am Holz der Latten, dann erklangen weitere Schritte. Was zum Teufel tat der Kerl da?
Erst als es hinter dem Zaun leise zu singen begann, wusste Ondragon, wer das auf der anderen Seite war. Er entspannte sich. Das dort war kein unsichtbarer Gegner, das konnte nur Mr. Diegos Tochter sein. Kaplan Bolič hatte ihn zuvor über die unmittelbaren Nachbarn von Ellys aufgeklärt. Mr. Diego war Witwer und lebte mit seinen beiden Kindern, der fünf Jahre alten Maria und dem dreijährigen Xavier, zusammen.
Ondragon näherte sich dem Astloch und konnte das kleine Mädchen nun auch sehen. Fröhlich hopste es vom verdorrten Ellys-Rasen hinüber zum frischen Diego-Grün. Wie die Vision von einer kleinen Weltenwanderin, die vom Reich der Toten hinüber in das der Lebenden schritt.
Maria lief barfuß und trug ein blaues Kleid. Ihr dunkles Haar war zu zwei lustigen Zöpfen gebunden und um ihren Hals baumelten verschiedene selbstgebastelte Ketten aus Nüssen und Samenhülsen. Ondragon beobachtete, wie sie durch eine Hintertür im Diego-Haus verschwand.
Noch eine halbe Stunde verharrte er hinter dem Zaun, aber nichts Nennenswertes geschah. Kurz nach elf verließ er sein Versteck und ging unauffällig zum Auto zurück, auf dem sich schon der Staub der Wüste niedergelassen hatte. Mit laufender Klimaanlage notierte er sich die neuesten Erkenntnisse auf seinem kleinen Notizblock und fuhr anschließend zurück ins Zentrum. An der Tucson Mall parkte er und ging in den riesigen Gebäudekomplex. Er brauchte ein paar Utensilien für seinen nächtlichen Ausflug.
Nachdem er alles eingekauft hatte, kehrte er zum Hotel zurück und nahm in dem dazugehörigen Restaurant ein ausgezeichnetes Mittagessen zu sich.
Zu Fuß machte er sich wenig später auf den Weg zum Arizona Hotel. Er betrat die Lobby durch den Haupteingang, ließ die Rezeption mit einem Nicken links liegen und begab sich zu den Fahrstühlen, wo er seine frisch gekaufte Baseballkappe zurechtrückte, um sein Gesicht vor den überall installierten Sicherheitskameras zu verbergen. Dann drückte er auf den Knopf für den siebten Stock. Dort angekommen schlüpfte er in das angrenzende Treppenhaus und stieg wieder zwei Stockwerke tiefer ins fünfte. Manche würden jetzt sagen, er wäre paranoid, aber Ondragon hatte die Erfahrung gemacht, dass man niemals vorsichtig genug sein konnte. Deshalb klopfte er auch erst an die Tür mit der Nummer 506, nachdem er sich vergewissert hatte, dass niemand auf dem Flur war.
Zunächst antwortete ihm bloß Stille, schließlich ein gedämpftes Stöhnen und darauf ein „Wer ist da?“
„Mr. O“, flüsterte Ondragon.
Auf der anderen Seite ertönte das Klappern der Kette des Sicherheitsschlosses und die Tür öffnete sich. Ondragon trat an der großen, aber gebeugten Gestalt vorbei ins Zimmer, in dem er sich sofort umsah, aber nichts Besonderes entdeckte.
Der Springer schloss die Tür, legte die Sicherheitskette wieder davor und schlurfte zum Bett, auf das er sich kraftlos fallen ließ. Er war nur mit einem Bademantel bekleidet und sah grauenhaft aus. Sein unrasiertes Gesicht hatte die graue Färbung von Leberwurst, die zu lange an der Luft gelegen hatte, und ein dünner Schweißfilm schimmerte auf den slawisch hohen Wangenknochen. Die dunklen Augen lagen gerötet in den Höhlen und offenbarten einen fiebrigen Glanz. Kaplan Bolič schien wirklich krank zu sein.
Ondragon zog die kleine Papiertüte aus der Jackentasche und warf sie ihm zu. „Die Paracetamol.“
„Danke.“ Bolič fing sie auf und holte mit zittrigen Fingern die Schachtel mit den Pillen heraus. Er nahm gleich zwei und spülte sie mit einem Glas Wasser runter. Danach legte er sich stöhnend zurück auf sein Kopfkissen und blickte Ondragon aufmerksam an. „Sie sind also der berühmt berüchtigte Mr. O! Bei DeForce gelten Sie noch immer als eine Art Held. Auch Spider spricht nur in höchsten Tönen von Ihnen.“
Ondragon schwieg. Es war ihm unangenehm, dass die DeForce-Leute von ihm sprachen, als sei er eine verdammte Legende. Stattdessen versuchte er den Mann vor sich einzuschätzen. Gemäß Rods Angaben war Bolič gebürtiger Bosnier und hatte das Kriegshandwerk bereits mit zwölf Jahren erlernt, nachdem er 1995 dem Massaker von Srebrenica entkommen war. Danach kamen die Fremdenlegion und privater Personenschutz. Seit vier Jahren arbeitete er als sogenannter Springer für DeForce mit der Homebase Moskau. Springer waren jene Leute, die nicht zu der Stammbesetzung einer Crew gehörten. Sie waren freie Mitarbeiter, welche die Lücken füllten, die Stammleute hinterließen, wenn sie aus welchen Gründen auch immer ausfielen, oder ein Waffenarm mehr benötigt wurde. Springer arbeiteten weltweit, sie waren nicht auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert. Sie waren die Söldner bei DeForce, die Männer fürs Grobe. Echte Mercenarios. Bolič war zwar von einer Krankheit geschwächt, machte aber ansonsten nicht den Eindruck, besonders zimperlich zu sein. Unter seinem Bademantel verbarg sich ein bulliger, durchtrainierter Körper, der bestimmt die eine oder andere Narbe als Erinnerung trug.
Genauso sehe ich unter meiner Kleidung auch aus, dachte Ondragon. Niemand ahnt, dass wir vom Kampf gezeichnete Männer sind, die bis zum Äußersten gehen würden, um ihr Ziel zu erreichen. Und er wusste, dass das Töten für jeden, der bei DeForce arbeitete, reiner Selbsterhaltungstrieb war. Bei einem Einsatz musste man zusehen, am Leben zu bleiben und die Fracht abzuliefern. Nichts anderes zählte. In diesem Grundsatz waren er und Bolič einander gleich.
„Also gut, Kaplan …“
„Captain!“
Ondragon sah ihn stirnrunzelnd an.
„Nennen Sie mich Captain. Der Name gefällt mir besser.“ Er winkte mit der Hand, dass Ondragon fortfahren sollte.
Dieser war bereits ziemlich genervt von den Allüren des Bosniers, setzte aber den angefangen Satz fort: „Captain … am besten, Sie zeigen mir jetzt den Brief, den Sie in Tylers Ellys‘ Müll gefunden haben.“ Er zog sich einen Stuhl heran, während Bolič sich ächzend vorbeugte und in der Nachttischschublade herumkramte. Dabei versuchte Ondragon, nicht auf die obligatorische Bibel in der Schublade zu blicken. Seine tiefe Abneigung war nicht prinzipiell gegen das Religiöse gerichtet, vielmehr missfiel ihm das Buch als solches. Obwohl seine Phobie vor Büchern genau an dem Tag begonnen hatte, an dem er auch seinen Glauben an Gott verloren hatte, war die Abscheu gegen alles Gedruckte und zwischen zwei Buchdeckel Gebundene stärker als sein Zorn gegen Gott. Schließlich waren es die Tonnen von Büchern gewesen, die seinen Zwillingsbruder Per Gustav damals im Alter von zehn Jahren erschlagen hatten und nicht Gott.
„Ovdje molim, hier bitte, der Brief.“ Bolič hielt ihm eine durchsichtige Zipbag unter die Nase. Darin steckten ein zerknüllter und wieder geglätteter Briefbogen und ein Umschlag ohne Beschriftung.
Ondragon, der sich gern aus seinen deprimierenden Gedanken um seinen toten Bruder reißen ließ, nahm die Plastiktüte entgegen und wendete sie vor dem Licht der Nachttischlampe hin und her.
„Lag unter einer Schicht Reisig und einem toten Vogel in der Tonne hinterm Haus.“
Ondragon las die Zeile laut vor: „Tyler Ellys, son corps doit être comme une bouteille vide – dein Körper soll eine Flasche sein. Seltsam. Sprechen Sie Französisch, Kaplan? Äh, Captain?“
„Bien sûr.“ Sein Akzent war fürchterlich.
Ondragon hingegen beherrschte Französisch als eine von vielen Sprachen akzentfrei, aber er wollte wissen, was Bolič davon hielt. Schließlich arbeitete dieser für Rod und hatte vielleicht eine Ahnung, ob der Brief etwas mit einem DeForce-Job zu tun haben könnte. Er betrachtete die ungelenke Zeichnung unter den Druckbuchstaben. Es war ein längliches, sechseckiges Gebilde mit einem Kreuz darauf. Sollte wohl einen Sarg darstellen. „Was, denken Sie, könnte das bedeuten?“
„Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Wahrscheinlich ist das ein Drohbrief und Ellys hat das Nervenflattern bekommen und sich abgesetzt, oder er ist bereits in der Hölle.“
„Sie glauben, er ist tot?“
„Ja, Geierfutter.“
„Kannten Sie Tyler Ellys?“
„Nein. Aber das ist meine Meinung, Mr. O. Er ist tot.“ Bolič verschränkte die massigen Unterarme vor der Brust. „Tyler Ellys liegt irgendwo da draußen in der Wüste mit ‘ner Kugel im Kopf und wir vergeuden hier nur unsere Zeit!“
„Aber wer hätte einen Grund, ihn umzulegen?“ Ondragon ließ nicht locker, was den Bosnier sichtlich nervte.
„Woher soll ich das wissen, ich bin kein Privatschnüffler, sondern Soldat! Vielleicht ist der verdammte Yankee jemandem zu sehr auf die Füße getreten mit seiner charmanten Art. Oder einer hatte ‘ne Rechnung mit ihm offen, kann ja schon mal passieren bei dem Job. Ist mir jedenfalls egal, ab jetzt übernehmen Sie den Fall! Dann können Sie sich damit herumschlagen. Ich bin jedenfalls raus aus der Sache!“ Er rieb sich die Stirn. „Wenn diese Scheißkopfschmerzen nicht wären! Seit ich bei Ellys war, geht es mir beschissen. Man könnte meinen, ein Fluch läge auf dem Haus. Ich kann kaum noch geradeaus gucken.“ Er hängte noch eine wüste Verwünschung in bosnischer Sprache dran und ließ seine Faust in ein Kissen krachen, dabei bemerkte Ondragon die Tätowierung auf der Innenseite seines Unterarms, die sich alle DeForce-Mitglieder früher oder später stechen ließen: Bugs Bunny als Postbote mit einem Paket in der Hand. Er selbst besaß dieses „Kunstwerk“ zum Glück nicht, denn es hätte sich mit dem japanischen Drachen, den er seit seinem achtzehnten Lebensjahr auf der Brust trug, im wahrsten Sinne des Wortes „gebissen“.
„Hat Ellys irgendwelche Freunde?“, fragte er den blassen Springer.
„Hab‘ ich alles schon abgecheckt. Sind Typen aus seiner Crew, aber die wissen auch nichts. Sie können ja gerne auch nochmal mit denen telefonieren. Hier sind die Nummern.“ Bolič warf ihm einen Notizblock zu. „Darin steht alles, was ich zusammengetragen habe. Nehmen Sie es, ich brauche es nicht mehr.“
Ondragon blätterte durch die Seiten. Es war nicht viel an Informationen. Er steckte den Block in seine Jackentasche. „Sollte ich sonst noch irgendetwas wissen?“
„Nicht, dass ich wüsste. Nehmen Sie bloß auch diesen Brief mit!“
„Ist er auf Fingerabdrücke untersucht worden?“
„Nee, das müssen Sie machen, dafür bin ich nicht ausgerüstet. Aber Rod sagte mir, dass Sie es sind.“
Na, da weiß der gute Rod aber mehr als ich, dachte Ondragon und steckte auch den Brief in seine Tasche.
„Und nun verschwinden Sie, Mr. O! Ich brauche meine Ruhe.“
„Wie kann ich Sie erreichen?“
„Am liebsten gar nicht, aber ich werde hier wohl noch eine Weile rumliegen, bis ich in der Lage bin, ein Flugzeug zu besteigen.“
Wohl eher, bis Rod es dir erlaubt, mein Bester! Ondragon tippte sich zum Abschied an die Stirn und ging.
„Viel Glück, Kollege!“, schallte es mit bosnischem Akzent hinter ihm her, als er die Zimmertür hinter sich schloss.
3. Kapitel
06. Februar 2010
Tucson, Arizona
1.05 Uhr
Eine Weile wartete Ondragon und blickte durch die Frontscheibe des Wagens hinaus in die Dunkelheit, die in der Wüste eine beinahe stoffliche Qualität besaß. Trotz der Straßenbeleuchtung erkannte er kaum mehr als die geisterhaften Fassaden der Häuser des Neighborhood. Nirgendwo brannte ein Licht hinter den Fenstern. Alle braven Bürger schliefen um diese Uhrzeit.
Leise öffnete er die Wagentür, stieg aus und lief geduckt zwischen den Häusern hindurch. Im Schatten des kleinen Weges, der zu den Rückseiten der Grundstücke führte, zog er sich die Softshell-Gesichtsmaske über Mund und Nase, mit der er zwar aussah wie der kleine Bruder von Dr. Lecter, aber dafür erkannte man ihn nicht so schnell. Gekleidet war er in eine schwarze Hose und eine gleichfarbige Bomberjacke, die er in der Mall gekauft hatte. Dazu noch Tesafilm und ein großes Bowiemesser, das er an seinem Gürtel trug. Seine Hände steckten in dünnen dunklen Lederhandschuhen.
Darum bemüht, keine Geräusche zu verursachen, kletterte Ondragon über den Lattenzaun in Tyler Ellys‘ Garten und huschte zur hinteren Veranda, wo er sich mit einem Dietrich an der Tür zu schaffen machte. Das Schloss klickte und Ondragon schob die Tür auf, doch weiter als einen armdicken Spalt konnte er sie nicht öffnen. Mindestens vier Sicherheitsketten, die von innen angebracht waren, verhinderten sein weiteres Eindringen.
Damn it! Einen Bolzenschneider hatte er natürlich nicht dabei. Warum hatte der Springer ihm nichts von den Schlössern erzählt? Jetzt musste er notgedrungen durch die Vordertür rein.
Vorsichtig schlich Ondragon ums Haus, spähte auf die leere Straße und versenkte seinen Dietrich schließlich im Schloss, das schon nach wenigen Sekunden nachgab. Die Tür schwang auf und Ondragon schlüpfte in die noch schwärzere Finsternis des Hauses. Nachdem er die Tür wieder geschlossen hatte, knipste er eine winzige Diodenlampe mit einer kleinen Gummischlaufe an, die er sich über seinen Zeigefinger streifte.
Im bläulich matten Schimmer der Lampe kontrollierte er zuerst, ob die Vorhänge tatsächlich alle geschlossen waren und begann anschließend, sich im Wohnzimmer umzusehen. Beinahe zaghaft ließ er den Lichtschein über die Möbel und Gegenstände gleiten, die sich darin befanden. Eine durchgesessene braune Couch, ein niedriger Tisch davor mit einer Vielzahl dunkler Ringe auf der Holzplatte, die wohl von gut gekühlten Flaschen oder Dosen herrührten. Gegenüber der Couch stand ein teurer Sony-Flachbildfernseher mit Blu-ray-Player. Hier hatte Tyler Ellys sich was gegönnt.
Der Lichtschein huschte weiter. Über dem Fernseher hingen drei gerahmte Fotos. Eines zeigte Ellys mit GI-Bürstenhaarschnitt, roten Wangen und blauen Augen. Sein muskulöser Körper steckte in einem Hawaiihemd. Im Hintergrund war ein Strand mit Palmen zu erkennen. Ellys hielt grinsend einen Cocktail in der Hand und hatte den anderen Arm um einen blonden Mann gelegt. Das nächste Bild war ein weiterer Klassiker der amerikanischen Hobbyfotografie und durfte in keinem Wohnzimmer fehlen: Ellys mit einer Angel und einem Mörderbrocken von Fisch am Haken, Sonnenbrille auf der Nase und Zigarre im Mundwinkel. Ondragon fragte sich, wo man hier in der Wüste wohl den nächsten Fisch fing. Auf dem dritten Foto waren wieder Ellys und der blonde Typ abgebildet. Mit orangefarbenen, überdimensionalen Cowboyhüten auf dem Kopf und so vielen glitzernden Mardi-Gras-Ketten um den Hals, dass sie den Massaifrauen in Afrika Konkurrenz machten, grinsten sie ganz offensichtlich angetrunken in die Kamera. Na, das war ja ein richtiger Prachtbursche!
Ondragon leuchtete das Regal neben den Bildern ab und pfiff leise durch die Zähne, als er an die tausend DVDs entdeckte. Das war mal eine Bibliothek nach seinem Geschmack. Sonst gab es nicht viel in dem Zimmer, nur ein nagelneues Dolby-Surround System, wie Ondragon es selbst zu Hause hatte, rundete das Bild eines Filmliebhabers ab. Was für ein Glück für ihn, dass der Typ keine Bücher sammelte! Aber das hätte er bei einem Mailman auch nicht erwartet.
Eine Weile ließ Ondragon den Raum auf sich wirken. Eigentlich machte er nur sehr ungern Hausdurchsuchungen. Der Grund dafür war jedoch nicht nur seine Angst vor einer etwaigen Begegnung mit dem verhassten Papierprodukt, er fühlte sich auch jedes Mal wie ein Einbrecher, selbst wenn er dabei nichts entwendete. Die privaten Sachen eines Menschen zu durchwühlen hatte etwas Erniedrigendes. Nichtsdestotrotz musste Ondragon des Öfteren in den sauren Apfel beißen. Schließlich versprach das Motto seines kleinen Unternehmens, jedes, aber auch wirklich jedes Problem zu lösen. Folglich musste er sich auch daran halten. Außerdem wusste er, dass er neben vielen anderen Talenten auch eine besondere Gabe dafür besaß, Störungen in Mustern zu erkennen, und sei es auch nur das kleinste Pixel, das von seinem Platz verrückt worden war. Vereinfacht hieß das, er war in der Lage, den Fehler im Bild zu finden. Leider stimmte in dem Bild, das er im Augenblick vor sich hatte, alles. Nicht eine Unregelmäßigkeit war zu entdecken.
Ondragon ging zum Fernseher, schaltete den Blu-ray-Player ein und öffnete das DVD-Fach. Er nahm die Disc heraus und las den Titel. Der neueste „Star Trek“-Film. Mit einer Hand holte er den Tesafilm aus der Tasche, drückte einen kleinen Streifen davon auf die Disc und zog ihn langsam wieder ab. Mit der Diodenlampe beleuchtete er den gut erkennbaren Fingerabdruck. Ondragon brauchte ihn, damit er ihn später mit denen auf dem Brief vergleichen konnte.
Er legte die Disc zurück und nahm sich den nächsten Raum vor. Ein Esszimmer mit offener Küche. Das Mobiliar wirkte billig und heruntergekommen, die Küche schmuddelig. Offenbar investierte Ellys sein Geld im Wesentlichen in technische Highend-Geräte. In Gedanken machte Ondragon sich einen Vermerk, später unbedingt nach dem Computer zu suchen, über den Tyler Ellys den Kontakt zu DeForce hielt. Zunächst aber durchstöberte er systematisch sämtliche Schubladen und Schränke der Küche, klopfte alles nach verborgenen Fächern ab. Er entdeckte nichts, nur Brotkrümel. Er tastete sogar die Unterseite des Esstisches ab und Bingo … eine 9-mm-Beretta-92FS Semiautomatik kam zum Vorschein. Sie war mit Panzerband unter den Tisch geklebt worden. Da war Springer Bolič aber nicht besonders sorgfältig mit seiner Durchsuchung gewesen, dachte Ondragon, und steckte die Waffe in seine Jackentasche.
Als nächstes verfuhr er desgleichen mit Schlafzimmer, Flur, Bad, Abstellkammer und einem Arbeitszimmer, in dem es zwar ein nacktes Netzwerk-Kabel gab, das aus der Dose ragte, aber keinen PC oder Laptop. Den hatte Ellys oder jemand anderes mitsamt dem Router vom Kabel gezogen und mitgenommen. Leider verhielt es sich genauso mit dem Mobiltelefon. Keine Spur davon. Dabei musste Ellys eines haben, denn er besaß sonst keinen Festnetzanschluss. Ratlos schaute Ondragon hinauf zur Zimmerdecke. Ob es noch einen Dachboden in diesem Haus gab?
Er ging hinüber in den Flur und fand die Luke. Mit der dafür vorgesehenen Stange öffnete er sie, klappte die Leiter nach unten und stieg in das staubige Refugium der vergessenen Dinge hinauf. Leise knarrten die Dielen unter seinen Sohlen, während er die Kisten und Plastiksäcke auf dem niedrigen Dachboden durchsuchte. Aber auch hier kam ihm nichts Ungewöhnliches unter die Finger. Unzufrieden stieg Ondragon wieder hinab und stand eine Weile auf seiner Lippe kauend im Flur.
„Wo hast du’s versteckt?“ Er dachte nach. Ellys war ein Mailman. Und ein solcher besaß ein ganzes Arsenal an Waffen und einschlägiger Ausrüstung, die ein Cop als illegal bezeichnen würde. Die Polizei hatte aber keine Waffen gefunden, nicht einmal die Pistole unter dem Tisch, und der Springer hatte ihm gegenüber auch nichts von einem Versteck oder Tresor erwähnt, was immerhin ein gutes Licht auf Ellys warf, der sein Equipment gewissenhaft versteckt hatte. Denn üblicherweise sollte im normalen Leben der Personen, die für DeForce Deliveries arbeiteten, nichts darauf hindeuten, dass sie einen etwas „ungewöhnlicheren“ Job machten.
Bleibt nur noch die Garage, dachte Ondragon schlecht gelaunt. Sollte er womöglich hier rausgehen, ohne etwas Nennenswertes in Erfahrung gebracht zu haben? Hatte er umsonst im Müll eines anderen Menschen gewühlt?
„Verschwendete Zeit!“, schimpfte er gedämpft und überprüfte die Tür, von der aus man vom Flur in die Garage kam. Sie war mit ebenso vielen nagelneuen Sicherheitsschlössern versehen wie die Haus- und Verandatür. Wovor hatte ein unerschrockener Mailman wie Ellys solche Angst gehabt, dass er sich derartig verbarrikadierte? Ondragon öffnete ein Schloss nach dem anderen und spähte in die dunkle Garage, bereit, jederzeit seine Waffe zu ziehen.
Aber alles wirkte ruhig, und er schlüpfte hinein.
Tyler Ellys‘ dunkelblauer Pickup stand wie ein stummer, glänzender Riesenkäfer in dem geräumigen Anbau. Der Dodge war frisch gewaschen und offen. Ondragon stieg ein, sah im Handschuhfach und hinter den Sonnenblenden nach. Nada. Er durchwühlte die Seitenfächer. Viel Müll, ein Feuerzeug, ein Taschenmesser, eine schwere Maglite-Taschenlampe, sonst nichts.
Ondragon stieg aus und beugte sich mit dem Oberkörper wieder ins Wageninnere, um mit seiner Lampe unter die Sitze zu leuchten. Krümel, Sand, ein vertrockneter Kaugummi, Klettband. Aha. Zumindest hier hatte Ellys eine weitere Waffe versteckt gehabt. Plötzlich drang ein Geräusch an seine Ohren und er hielt inne. Es war von dem Rolltor der Garage gekommen. Ein leises Schaben. Sehr leise. Dennoch hatte er es gehört.
Das Geräusch wiederholte sich. Diesmal ein paar Meter weiter an einer anderen Stelle des Tores. Ein Schaben, als streife etwas ganz flüchtig über das Metall. Ondragon wartete. Als es jedoch still blieb, wandte er sich wieder dem Wagen zu. Wahrscheinlich war es nur eine Katze gewesen oder ein Kojote, der sich in den Vorort verirrt hatte, um im Müll zu stöbern.
Nachdem er die Rückbank des Pickup, die Ladefläche mit der festinstallierten Box und sogar den Unterboden untersucht hatte, richtete er sich auf und blickte mit in die Hüfte gestemmten Händen auf das Fahrzeug. Es war verdammt nochmal sauber!
Er sah sich in der Garage um. Werkzeug hing wohlgeordnet an der Rückwand, und Gartengeräte, die bestimmt noch nie benutzt worden waren, standen in der Ecke daneben – das Klischee einer amerikanischen Garage. Ondragons Blick glitt über die Werkbank und die Benzinkanister darunter und blieb an einem Fetzen Kaugummipapier hängen, das unter der Werkbank lag. Plötzlich spürte er ein Kribbeln in den Fingerspitzen; ein untrügliches Zeichen dafür, dass an diesem Bild etwas nicht stimmte.
Er trat an die Werkbank, ging in die Hocke und betrachtete das Silberpapier.
Es klemmte unter dem rechten vorderen Tischbein der Werkbank. Wie konnte das sein?
Ondragon zog daran. Es zerriss.
Er richtete sich auf und tastete das Holz des Tisches ab. Seine Finger fanden eine Vertiefung an der Kante der Platte und drückten hinein. Ein leises Klicken ertönte, und der Tisch schwang nach vorn, als sei er schwerelos. Ondragon trat zur Seite und richtete den Schein seiner kleinen Lampe in den Hohlraum, der hinter dem Tisch in der Wand zum Vorschein kam.
Hier war also das Versteck. Die Garage besaß eine doppelte Rückwand. Tricky.
Auf allen vieren kroch Ondragon in die Öffnung. Dahinter war ein schmaler Raum, der zu beiden Seiten von Stahlregalen gesäumt war und zwischen denen sich ein Mann gerade so hindurchzwängen konnte. Er besah sich die Regale. Sie waren gefüllt mit einer Vielzahl von nummerierten Alukoffern, Holzkisten mit dem Aufdruck „US Army“, in denen er Waffen und Munition vermutete, und … Ondragon vergaß zu atmen und starrte auf das Regal … Bücher!
Schlagartig brach ihm der Schweiß aus und seine Kopfhaut zog sich zusammen, als erfasse ihn eine eiskalte Böe. Er musste schlucken, spürte, wie seine Finger in den Handschuhen feucht wurden.
Verdammte Scheißbücher! Warum komme ich nicht endlich damit zurecht?, dachte er gereizt und versuchte, seinen überreagierenden Metabolismus unter Kontrolle zu bringen. Unwillkürlich musste er an seinen toten Bruder denken. Wie eine Fata Morgana stand dessen Bild vor seinem inneren Auge. Per Gustav Ondragon.
Es hatte 31 Jahre gedauert, sich wieder an ihn zu erinnern.
Das war letzten Sommer gewesen, in dieser gruseligen Psychoklinik in Minnesota, wo er in einen wirklich merkwürdigen, ja, geradezu mysteriösen Fall hineingeschlittert war. Und seitdem bekam er seinen verstorbenen Bruder nicht mehr aus dem Kopf. Per Gustav war zu einem stillen Begleiter geworden, der immer dann auftauchte, wenn er es nicht gebrauchen konnte. Wie ein mahnender Erzengel.
Dr. Arthur hatte ihn damals behandelt und den vergessenen Bruder aus den verwesten Tiefen seines Unterbewusstsein wieder ans Licht gezerrt … und mit ihm die unheilvollen Geister einer Vergangenheit, die Ondragon am liebsten wieder in jene Tiefen zurückverbannen würde, in denen sie gut aufgehoben gewesen waren.
Er biss sich auf die Unterlippe, bis er Blut schmeckte. Der Schmerz half ihm, wieder klar denken zu können. Er zwang seinen Blick auf die Bücher in der hinteren Ecke des Regals und las verdutzt die Titel: Mein Kampf auf Deutsch, sowie als englische Übersetzung, dazu diverse Biografien von NS-Verbrechern und jede Menge „White Power“-Pamphlete. An der Wand hinter den Büchern prangte eine Hakenkreuzflagge mit einem Runenwappen darunter.
Ondragon fragte sich, ob Roderick DeForce wusste, dass Tyler Ellys ein verkappter Neonazi war.
Mit seinem iPhone fotografierte er die Buchrücken samt Titel und wandte sich dann den Alukoffern zu. Am Griff zog er den Koffer mit der Nummer eins aus dem Regal. Aufgrund der stärkeren Abnutzungsspuren tippte Ondragon darauf, dass dies Ellys‘ erste Wahl war, wenn er für einen Job verreiste. Er ließ die Verschlüsse aufschnappen, hob den Deckel an und sah hinein. Ein merkwürdig unförmiges Gebilde lag oben auf dem schwarzen Schaumstoff, mit dem das Innere gepolstert war. Ondragon nahm es heraus und drehte es zwischen den behandschuhten Fingern hin und her. Ein kleiner Sack aus schmutzigem Leinen, oben zusammengebunden mit grobem, schwarzem Garn, das eine große Schlaufe bildete, als könne man sich das Ding um den Hals hängen. In dem Knoten an dem Säckchen steckten schwarze Vogelfedern und etwas, das Ondragon für einen getrockneten Hühnerfuß hielt. Demnach konnte es sich bei den braunen Flecken auf dem Stoff durchaus um Blut handeln. Ondragon hielt sich das Ding unter die Nase. Ein penetranter Geruch ging davon aus, dumpf und süßlich wie von Patchouli und Zersetzung von Fleisch. Ekelhaft. Wofür brauchte Ellys so etwas? War das ein Amulett? Ein Fetisch?