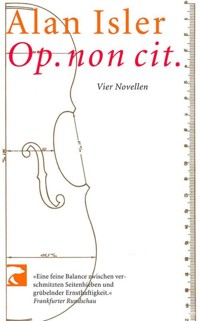
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alan Isler löst in seinen Novellen Literaten, literarische Figuren und Stoffe aus ihrem altbekannten Kontext und bringt sie in einen provokanten Zusammenhang. Sein Thema ist der Jude in der nichtjüdischen Welt heute wie gestern, im Osten wie im Westen - und er besticht durch seine Mischung aus Komödie und Tragödie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Alan Isler
Op. non cit.
Vier Novellen
Aus dem Englischen von Heidi Zerning
Berliner Taschenbuch Verlag
FÜR ADAM, ERIC, JOSHUA UND CLAUDIA,IN DER REIHENFOLGE IHRES ERSCHEINENS
DAS MONSTRUM
Einst wurde ein Monstrum, ein Wechselbalg, im Ghetto geboren – nun, vielleicht nicht hier geboren – wir sind dessen nicht sicher –, doch gewiß hier gefunden. Die Protokolle der Aussagen vor den Cattaveri sind noch erhalten. Es geschah folgendermaßen: Eines Nachmittags gegen zwei Uhr, das Cannaregio-Tor war schon geschlossen, kehrte Simcà, die Frau des Isacco Levi, eine Matrone in vorgerückten Jahren – inzwischen längst tot –, von einem Ausgang, Brot für ihren Tisch zu kaufen, heim. Unter dem Portikus der Scala Matta stolperte sie im Halbdunkel fast über einen Korb. »Sch’ma Jisroel«, entfuhr es ihr, »was denn jetzt?« Sie wurde von Salomon Penso gehört, inzwischen auch tot, der aus der Calle Sporca zurückkehrte, welche er aufgesucht hatte, um sich zu erleichtern, und der fast über Simcà stürzte, die sich über den Korb beugte. Ihre Stimme brachte ihn zwar zum Stehen, doch konnte er nicht mehr verhindern, daß sein Hosenbeutel mit ihrem Steiß in Berührung geriet. »Entschuldige«, sagte er höflich.
»Schau dir das an«, sagte Simcà.
»Ein Korb«, sagte Penso. »Was ist drin?«
»Ich habe Angst, nachzuschauen.«
»Wir schauen beide nach«, sagte Penso. »Aber wir wollen ihn erst mal ans Licht tragen.«
Und so wurden Simcà und Penso die ersten in unserer Gemeinde, soweit bekannt ist, die Mostrino zu Gesicht bekamen, den Beschützer der Juden. Gemeinsam zogen sie an der kleinen Zudecke. Simcà schrie auf. Später erzählte sie immer, daß sie, wäre sie Christin gewesen, was sie gottlob nicht war, sich gewiß bekreuzigt hätte. So aber mußte sie sich mit dem Ausruf bescheiden: »Sch’ma Jisroel, ein Monstrum!«
Was sie erblickten, war gewiß häßlich, ein Säugling, dessen riesiger Kopf zwischen runden Schultern stak, dessen Unterkiefer vorstand und gierig an der Oberlippe suckelte, dessen Nase Form und Farbe einer kleinen reifen Pflaume hatte, dessen Schädel und Stirn von dichtem, dunklem Haarwuchs bedeckt waren und dessen pummeliges rechtes Fäustchen emporwinkte und dem Himmel die einzigen drei Finger entgegenstreckte, die es besaß.
Simcàs erster Gedanke war Flucht, aber Penso hielt sie am Arm fest. »Es ist doch nur ein Kindchen. Es hat bestimmt Hunger, sieh doch, wie es an seiner Lippe nuckelt.« Gemeinsam trugen sie den Korb zu Ricca Benincasa, der Frau von Israel Coen Tedesco, die gegenüber der Levantinischen Akademie wohnte und reichlich Milch hatte. Die beiden fragten sie, ob sie das Monstrum über Nacht behalten und stillen könnte.
Nun folgte eine eingehendere Untersuchung, und es wurden zwei Entdeckungen gemacht. Zum ersten handelte es sich um ein männliches Monstrum, und zum zweiten – oh Wunder! – besaß es keine Vorhaut. Damit meine ich nicht, daß es beschnitten war. Nein, ich meine, daß Mostrino ohne Penishülle in diese Welt geworfen worden war. Eindeutig ein Fall für die Rabbis, und Penso lief sie holen. Die Rabbis waren beeindruckt. Das Kind war wie ein Moses gefunden worden, so disputierten sie, vielleicht war ihm bestimmt, die Juden ins Gelobte Land zurückzuführen. Die fehlende Vorhaut konnte Zeichen eines vorgeburtlichen Bundes sein und somit Mostrino als unmittelbares und vornehmstes Glied der Judenheit ausweisen. Sie bemerkten die vor ihren Nasen fuchtelnden Fingerchen. Der Buchstabe schin. War es möglich, daß auf diese stumme Art das Kind seine heilige Sendung kundtat?
Andererseits war der Säugling mißgestaltet, ein Monstrum. Dazu sah er nicht sonderlich vernunftbegabt aus, die Wahrheit ist, er sah schwachsinnig aus. Ihr müßt bedenken, dies waren gelehrte Männer, weise nicht nur in Geistesdingen, sondern auch in Welthändeln. Sie wußten, daß Sprößlinge unverheirateter Mütter im Ghetto keine Seltenheit darstellten. Auch Findlinge waren zwar die Ausnahme, aber nichts Beispielloses. Es war besser, Vorsicht walten zu lassen. Demgemäß erließen sie eine Ankündigung der Exkommunikation gegen jeden Juden, der etwas über Mostrinos Herkunft wußte und nicht vor sie trat, um davon Zeugnis abzulegen. Das Kind sollte bis auf weiteres von der Gemeinde unterhalten werden. Ricca beklagte sich, das häßliche Geschöpf habe bereits ihre Brüste blutig gekaut und leer getrunken. Nun gut. Die Rabbis gaben Mostrino in die Obhut einer jüdischen Amme. Und nachdem er auch die leer und blutig getrunken hatte, kam er in die Obhut der nächsten und danach einer weiteren. Sein Durst war unstillbar, und seine Gaumen waren wie Klammern aus Eisen.
Inzwischen hatte sich die Ankündigung der Exkommunikation durch alle Städtchen Veneziens verbreitet und sogar darüber hinaus. Niemand meldete sich. War es denkbar, daß ein Jude die Drohung der Exkommunikation mißachtete? Was also, wenn das Monstrum ein Christ war? Falls der Obrigkeit zu Ohren kam, daß die Juden heimlich einen Christensäugling beherbergten, waren die Greuel, die diese Kunde über das Ghetto bringen konnte, zu schrecklich, um auch nur gedacht zu werden. Die Rabbis entschieden, den Findling den Cattaveri zu melden.
Die Cattaveri beraumten eine sofortige Untersuchung an. Ein Blick auf Mostrino überzeugte sie, daß dieses Kind nicht von einer christlichen Mutter geboren sein konnte. Dies war offensichtlich ein Sproß des Teufels oder der Juden. Dennoch nahmen sie die Aussagen von Simcà Levi, Salomon Penso und Ricca Benincasa zu Protokoll und hörten sich die gelehrten Erörterungen der Rabbis an. Dann schlossen sie den Fall. Ihr Urteil lautet im Auszug: »Die Allererlauchtesten und Rühmlichsten Cattaveri Nicolò Caruso und Alvise Gigli haben in der Angelegenheit des am 5. currentis im Ghetto aufgefundenen männlichen Neugeborenen nach Anhörung der Zeugenbeweise und nach ordnungsgemäßer und reiflicher Erwägung derselben einstimmig entschieden, daß vorerwähntes männliches Neugeborenes im Ghetto verbleiben soll, in der Obhut geeigneter Personen.«
So gelangte Mostrino, der Beschützer der Juden, unter uns, gedieh und wuchs derart rasch, daß er in seinem sechzehnten Jahr mehr als sechseinhalb Fuß maß und über dreihundert Pfund wog. Der Boden erbebte unter seinen Schritten. Zwölf Ellen Tuch konnten seine Nacktheit nicht bedecken. Nur sein Kopf war nicht gewachsen. Er saß auf seinen Schultern wie ein zerbrochenes Ei auf dem Deckel eines Weinfasses. Haare sprossen in struppigen Büscheln auf seinem mißgestalteten Schädel. Sein Gesichtchen mit der blauroten Pflaumennase war schon lange in einer bedeutungslosen finsteren Fratze erstarrt. Und er konnte nicht sprechen. Dringliche Grunzer kamen aus seinen verzerrten Lippen, wenn er nach Worten suchte, die er nicht besaß. Sein Gruß waren die in den Himmel gereckten drei Finger, der Buchstabe schin. Mostrino war der Ghettotrottel, vollkommen harmlos, stets gutmütig. Die Kinder liebten ihn. Ein Knüppel war sein einziger Besitz, sein Spielzeug, das er nie aus der Hand ließ und mit dem er seine unschuldigen Spiele trieb. Das Urteil der Cattaveri blieb jedoch in der christlichen Welt nicht völlig unbemerkt. Baldassare Piero Maria Bembo, Kanonikus der Cattedrale di Ferrara, veröffentlichte eine markerschütternde Polemik mit dem Titel Erörterung des den Juden von Venedig geborenen Ungeheuers. »Bedenket wohl, was dies verkündiget, o Juden. Ist diese Monstrosität euch nicht zum Zeichen gegeben, daß ihr auf abirrenden und verderbten Pfaden wandelt? Müssen wir nicht aus solcherlei schließen, daß ihr teuflische Übeltaten gegen uns ausheckt? Seid ihr dadurch nicht offenkundig vom Satan und seinen Dämonen besessen? Gebt acht, gebt acht, bedenket wohl dies monströse Zeichen. Es fällt nicht uns zu, sondern euch, elendes Volk der doppelzüngigen und unversöhnlichen Synagoge. Juden, oh Juden, ich beschwöre euch beim Erbarmen des ewig lebenden Christus: bekehrt euch zu dem einen wahren Gott … Hier ende ich, im sehnlichen Streben nach der Erlösung dieses verfluchten Volkes und meinem eigenen Seelenheil.« Soweit Baldassare Bembo. Nichts als eine weitere unflätige und vergebliche Bemühung, unsere Bekehrung zu erwirken. Ich erwähne das nur, weil zu meiner unsterblichen Schande der damalige Kanonikus der Cattedrale di Ferrara einst mein Bruder war.
Ja, ich hatte einst einen älteren Bruder. Er hieß Michael und war zehn Jahre älter als ich. Zur Zeit seiner Geburt lebten wir in Rom – meine Eltern, meine ich.
Alle, die ihn kannten, sagten, Michael sei ein wunderschöner kleiner Junge gewesen, und ohne Zweifel war er das auch. Meine Mutter gewann ihren Lebenshauch aus seinem Lächeln. Mein Vater sagte, sein Blick treibe die Röte auf die Wangen eines Engels. Als er noch in der Wiege lag, stand für die Gemeinde schon fest, daß er ein großer Rabbi werden würde, vielleicht sogar der größte, ein zweiter Maimonides. Seine allerersten Worte waren »Sch’ma Jisroel«. Die Brust meines Großvaters, hörte ich, war stolzgeschwellt ob Michaels Klugheit. Ein weiterer Punkt: er wurde an Rosch Haschana geboren, seine Beschneidung war am Jom Kippur. Wie Ihr Euch vorstellen könnt, war sie ein Ereignis, diese Beschneidung.
Eines verfluchten Tages in Michaels siebentem Jahr war er allein aus, ging spazieren, im Geiste vielleicht mit einem verzwickten Problem des Gesetzes beschäftigt. Aber es kann auch sein, daß er lediglich vor sich hin pfiff oder mit dem Fuß nach einem Stein stieß. Man bedenke, obwohl deutlich zu Großem auserwählt, war er auch ein Kind. Jedenfalls führten ihn seine Schritte am Haus der Katechumenen vorbei. Ein alter Priester, der an einem Fenster saß, ein berockter Knabenschänder mit geschminkten Wangen und bemalten Lippen, lockte ihn hinein, wer weiß, unter welchem Vorwand? Michael war ein unschuldiges Kind, engelsgleich. Was wußte er von erwachsener Verworfenheit? Nach seiner Erfahrung mußte Erwachsenen als erstes vertraut und dann gehorcht werden. Also ging er hinein.
Wir wissen das alles, weil ein jüdischer Hausierer, der vorgeblich (und verbotenerweise) seine Waren unmittelbar in der Nähe feilhielt, eigentlich jedoch hoffte, einen Blick auf seine drinnen verschmachtende Tochter zu erhaschen, mitansah, wie Michael hineingelockt wurde, mitansah, wie er hineinging. Wer vermag den Schmerz meiner Eltern zu ermessen? Mein Vater mußte vom Tor des Hauses der Katechumenen fortgezerrt werden. Meine Mutter begab sich auf ihren schreienden Abstieg in den Wahnsinn. Mein Großvater starb an der seelischen Erschütterung. Die Gemeinde richtete eine Bittschrift an den Papst höchstselbst, jenen verfluchten, lächelnden Julius, mag er auf immer und ewig in den Qualen der Hölle schmoren, aber es fruchtete alles nichts. Meine Eltern sahen Michael nie wieder. Die Kirche hatte einen neuen Adepten gefunden. Nach einiger Zeit packte mein Vater seine Habseligkeiten und seine wahnsinnige Frau auf einen Karren und machte sich von Rom auf den Weg nach Venedig.
Die Christen erlahmten mein ganzes Leben lang niemals in ihren Anstrengungen. Oh, ich weiß alles über die Bekehrung. Nach einiger Zeit wurde die Bekehrung sogar gewissermaßen zu meinem Gewerbe: Gulden zu Dukaten, zum Beispiel, oder Schillinge zu Zechinen. Ja, ja, ich bekehrte sie alle. Doch mich selbst zu einem Christen? Nein, nachdrücklichst nein. Trotzdem sind vielleicht noch ein oder zwei Worte über die Bekehrung angebracht. Wir können gleich danach auf Mostrino zurückkommen.
Ich wurde in Venedig am selbigen Tag geboren, an dem Papst Julius, mögen seine Missetaten nie getilgt werden, den Talmud in Rom verbrennen ließ, ein denkwürdiger Tag. Mehr als tausend Exemplare des vollständigen Talmuds nebst zahlreichen anderen Büchern, alten und neuen, wanderten auf den Scheiterhaufen, dicke Folianten und schmale Pamphlete, Notenblätter mit sakraler Musik, erst beleckt und dann verzehrt von den hungrigen Flammen, geschwärzte Flocken der allerheiligsten Wörter stiegen im Luftsog zum erbarmungslosen Himmelsgewölbe auf. Meine frühkindlichen Schreie verloren sich im allgemeinen Wehklagen.
Und wer stiftete ihn dazu an, diesen herzlosen und unduldsamen Mann, diesen Julius? Ja, Ihr habt es erraten: die Juden. Die große Sünde wurde in der römischen Gemeinde selbst geboren, der abscheuliche Wurm wurde nächst dem unschuldigen Herzen der Knospe genährt. Drei Bekehrte flüsterten Lügen über den Talmud in die Ohren des Papstes, der lächelnd lauschte. In Verlästerung des Bundes, den Gott mit unseren Vorvätern geschlossen hatte, flüsterten sie ihre Blasphemien. Julius lächelte und nickte, nickte und lächelte. Dann gab er seinen stummen Häschern Befehle. Diese schwärmten rasch und hurtig aus und erbrachen jüdische Häuser und entrissen den zitternden Händen der Gerechten die Bücher. Eine Schändung dieses Ausmaßes blieb natürlich dem Sabbat vorbehalten, eine solche Schändung speist ihr unersättliches Bedürfnis nach Sitte und Anstand.
Bald krabbelten die Büttel des Papstes wie Kakerlaken überall durch die Romagna. Bücher ohne Zahl wurden in Bologna und Ravenna verbrannt. Die Juden litten Pein und schrien auf, doch wo war ein barmherziger Nachbar, sie zu hören? Wo ist je einer? Die Kakerlaken krabbelten und flüsterten und verbreiteten ihre Verleumdungen. Auch in Ferrara und Mantua gingen die Bücher in Rauch auf, die heiligsten Lehren zerstoben als Ruß im Wind. Und Julius hatte sein Netz sogar über Venedig geworfen. Mein Vater sah mit an, wie seine gesamte Bibliothek ein Raub der Flammen wurde. Die Christen machten Luftsprünge und klatschten in die Hände, begafften das Schauspiel, hielten feiste Wickelkinder hoch, daß sie an dem flackernden Feuer ihr glucksendes Vergnügen hatten, verkauften Orangen und Naschwerk, stahlen Geldbörsen und bereiteten sich aus unseren unsäglichen Qualen ein Freudenfest.
Solcherart war der Tag, an dem ich auf diese jammervolle Welt gelangte, ein nicht gerade günstiger Tag, alles in allem, gewissermaßen ein schwarzer Tag, dazu gemacht, wie ich schon sagte, von drei Apostaten, drei Bekehrten, die in die Ohren des lächelnden Julius flüsterten. Ihr seht, ich habe mein neues Thema nicht vergessen: die Bekehrung, davon sprechen wir jetzt.
Noch einer wurde an dem Tag in Venedig geboren, wie ich im Ghetto Nuovo, noch einer wurde zur selben Stunde geboren, da meine Mutter, nicht recht bei Sinnen, die arme Seele, mich unter Schmerzen und Tränen aus ihrem Schoß preßte. Ja, noch einer wurde geboren, ein gewisser Ascher Bassan, aus dem mit der Zeit jener ehrwürdige, hoheitsvolle und edle Signior Antonio Bassanio werden sollte. Nein, ich weiß alles über Bekehrte. Das Ghetto war Ascher nicht groß genug, er hatte ehrgeizige Ziele. »Da draußen sind sie zu Millionen«, sagte er einmal zu mir, kurz bevor er fortging. »Ihnen gehört die Erde. Kannst du mir verübeln, daß ich ein Teil davon will? Dafür ertrage ich ein oder zwei Tropfen Weihwasser.« Natürlich machte ich ihm Vorhaltungen, doch ich wußte, es war sinnlos. Und schließlich war es seine Angelegenheit. Ich schluckte meinen Widerwillen hinunter und wünschte ihm alles Gute. Wir waren einmal Freunde, wir sollten zu Todfeinden werden.
Warum starb er nicht im Schoß seiner Mutter, auf daß sie zu seinem Grab wurde und ihr Schoß zu seiner ewigen Gruft? Warum, o Herr? Ja, mein Freund wurde ein apikoires, ein Bekehrter. Und seinetwegen ist mein Kind, meine Jessica … doch davon nichts weiter. Laß ihn brennen, o Herr, in alle Ewigkeit.
Wie ich mich ereifere! Als ob das bis zum heutigen Tag irgend von Belang wäre! Merkt Ihr, wie mir die alten Flüche noch von der Zunge gehen?
Nun, vielleicht war mein Bruder Michael doch nicht so außergewöhnlich. Was mein Vater von ihm erinnerte, das hatte der Verlust geschönt. Und meine Mutter, natürlich, die arme Seele … Ich bin ihm nämlich vor ein paar Jahren begegnet, ich meine Michael, zur Zeit meines Jahrhundertprozesses, und er machte mir nicht den Eindruck eines verkappten Maimonides. Lang und dünn, der Rücken krumm, die Miene sauer und die Lippen verkniffen, war er im Priesterstande, wie ich gesagt habe, ein Kanonikus, nichts weniger, auch er ein Knabenschänder, gepudert und geschminkt. Ich sollte gut von ihm sprechen. Er war nach Venedig gekommen, um mich zu retten. Er konnte nicht wissen, daß ich seine Hilfe nicht brauchte. Das Gesetz selbst war mein Rechtsbeistand. Aber da stand er nun, liebkoste schamlos den fetten, errötenden Lustknaben an seiner Seite, der seinen Sonnenschirm trug, und die Schultern seines schwarzen Chormantels waren ekelerregend mit weißlichen Schuppen aus seinen sich lichtenden grauen Haaren bestäubt. Es war ihm zuwider, das Ghetto zu betreten. Nein, er schickte einen Gondoliere nach mir, einen Mietling, und bestellte mich so auf den Rialto ein. Dort beschwor er mich, Christum anzunehmen, nicht nur, um meinen nichtswürdigen Leib zu retten, sondern um die Erlösung meiner Seele zu erlangen. Selbstverständlich wies ich ihn ab. So viel zu Kanonikus Baldassare Piero Maria Bembo. Ich entsinne mich noch, daß er Plattfüße hatte.
Wie sehnlichst sie mich bekehren wollten! Viele Jahre zuvor, nicht lange, nachdem mein Vater in freudiger Klage über Gottes Lossprechung von der Verantwortung für mich den Segen »baruch schep’tarani« gesprochen hatte, nicht lange, nachdem ich als Maftir auf dem Almemor der Scuola Grande Tedesca die Haftara verlesen und (zum ungeheuchelten Staunen meines Vaters und zur unverhohlenen Langeweile der Gemeinde) meine d’rascha, meinen talmudischen Vortrag, über die geistigen Vorzüge eines enthaltsamen Lebens gehalten hatte, kurzum, nicht lange nach meiner Bar-Mizwa befand ich mich zufällig auf dem Rialto. Es war ein Nachmittag im Spätherbst, eine Stunde oder mehr vor dem Abendläuten.
Meiner Erinnerung nach sonnte ich mich in dem Gefühl, ein erwachsener und über die Maßen eleganter Mann zu sein. Die Augen Venedigs ruhten auf meinem neuen Wams und meinen Beinlingen. Ich stolzierte erhobenen Hauptes, eine Hand lässig am Heft des nicht vorhandenen Degens an meiner Hüfte, ein junger Herr, das Inbild ausgesuchter sprezzatura. Was für ein Esel, hm? Eben das heißt es, jung zu sein. Oh, ich war sehr vornehm, ungemein vornehm. Unter gesenkten Lidern hervor warf ich Blicke in alle Richtungen und legte die rechte Mißachtung für den Pöbelhaufe um mich herum an den Tag. Meine rote Kappe hatte ich zweifelsohne keck ins Gesicht gezogen. Wartet, wartet, nein, wir trugen zu der Zeit noch gelbe Kappen, wie die Levantiner. Rote Kappen kamen erst später auf, eine modische Neuerung. Wahrscheinlich sah sich irgendein Senator in seinem Kontor eines Tages mit unverkauften Ballen roten Tuches und sagte: Laßt die Juden rot tragen. Doch eine geschickte Näherin konnte eine gelbe Kappe zu modischer Eleganz aufputzen, indem sie einfach einen schwarzen Besatz anbrachte. Diamante, Vaters »Freundin«, hatte meine entsprechend hergerichtet. Wenn ich daran zurückdenke, muß sie ausgesehen haben, als hockte eine riesenhafte Hummel auf meinem Kopf.
Jedenfalls, in einer spontanen Regung und einem bösen Augenblick schritt ich von der Straße durch die offene Tür hinein in die Weinschenke Zu den Törichten Jungfrauen. Drinnen war es kühl und dunkel, es roch nach ranzigem Lampenöl und Essig, nach Süßholzspänen und verbotenen Speisen. Es summte von Gesprächen und gedämpftem galantem Gelächter, und in der Ecke zupfte und zirpte ein zwergenhafter Lautenspieler, ein pazzo im Narrenkleid. Sobald sich meine Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten, tat ich einige kühne Schritte in den Raum hinein und wartete darauf, daß der Lärm sich legte, wartete darauf – solcherart war meine stolzgeschwellte Unschuld –, bemerkt und bewundert zu werden. Vielleicht nahm ich eine herrische Pose ein, vielleicht eine aufreizende: mit meinen dreizehn Jahren sah ich wohl das Mädchen, das die Krüge von Tisch zu Tisch trug, sah ihren vorwitzigen jungen Busen, ein Zwillingsgestirn, von ihrem Mieder emporgepreßt, spürte auch den Wurm, der sich unter meinem Hosenbeutel in einen Leviathan verwandelte. O, das Feuer, das damals durch meine Adern rann!
Doch Gespräche und Gelächter gingen weiter, der Lautenspieler zupfte und zirpte, zirpte und zupfte. Niemand hatte von mir Notiz genommen. Das Mädchen war verschwunden. Sollte ich schlicht um ein Glas Wein rufen? Ich hatte Angst, meine Stimme könnte kicksen und mich verraten. Aber dann löste sich eine Gestalt aus den Schatten im hintersten Winkel des Raumes und stolperte auf mich zu, ein Trunkenbold, der eine Schale mit einer übelriechenden Flüssigkeit in der Hand trug. Er stand vor mir oder eher (gekrümmt wie ein Fleischerhaken) über mir und schaute auf mein emporgewandtes Gesicht herunter. Da erfuhr ich wahres Entsetzen. Ich hätte kehrtmachen und gehen sollen. Ein böser Geist hielt mich. Der Trunkenbold schwankte und schwitzte, seine Augen mühten sich in komischer Wut, den Blick auf meine Kappe auszurichten.
»Du bist ein J-J-J-Jude und deshalb ver-d-d-d-dammt.«
Nun hatte man von mir Notiz genommen. Nun herrschte Schweigen im Raum. Aber es war ein Schweigen, das Belustigung in sich barg, ein Schweigen, das atemlos darauf gespannt war, gebrochen zu werden.
»A-armer J-J-J-Jude«, sagte er, und er schluchzte um meinetwillen. »Verdammt, verdammt, ver-d-d-d-dammt, du bist gewiß verdammt.« Mit dem freien Arm wischte er sich die Stirn. Er keuchte und schnaufte nach Luft, keuchte und schnaufte und mühte sich immer noch mit der Ausrichtung seiner blutunterlaufenen Augen.
Ich sehe ihn, als stünde er jetzt vor mir. Würdet Ihr meine Handflächen befühlen, Ihr würdet sie feuchtkalt finden, naß. Ich durchlebe wieder das Grauen. Da steht er, schwankend, wirr. Er trägt ein speckiges braunes Lederwams. Seine schmalen Lippen sind speichelbefleckt.
»K-K-Kein Zweifel, du bist verdammt.«
Ich sah mich um. Zu meiner Rechten saßen an einem Tisch zwei Priester, Ordenspater, Dominikaner, und nickten lächelnde Zustimmung. Sie wußten, ein jeder Jude war verdammt.
Plötzlich nahm mein Peiniger den Arm von der Stirn, wo er sich mit dem Abwischen des Schweißes nützlich gemacht hatte, und schwang ihn in einem Bogen über meinen Kopf, so daß meine gelbe Kappe zur Tür segelte. »Ich werde deine S-S-Seele retten.« (Mögen ihm seine Zähne ewig nachwachsen und immerdar gezogen werden.) Er nahm seine Schale und schüttete ihren widerlichen Inhalt über meinen Kopf. »So t-t-taufe ich dich.«
Die Weinschenke brach in Gelächter aus.
So wird das Volk des Bundes unaufhörlich verhöhnt und verspottet. Wie lange noch, o Herr? Der Berg Zion liegt verlassen, und die Schakale treiben auf ihm ihr Unwesen. Warum vergissest du uns? Warum hast du uns seit so vielen Tagen verlassen?
Ich wischte mir die Augen. Das Mädchen hockte sich hin und hob im Übermaß ihrer Lustigkeit die Röcke über den Kopf und entblößte ihre Scham. Um mich herum war alles Gelächter.
Die Kleriker jedoch lachten nicht. Sie blickten sich an, nickten, erhoben sich von ihrem Tisch und kamen auf mich zu. »So, Bürschchen«, sagte der eine, »dir blüht die Fondamentina.« – »Allerdings«, sagte der andere grimmig, »die Verleugnung unseres Herrn Jesus Christus macht jetzt aus dir einen Ketzer, nicht mehr einen bloßen Ungläubigen.« – »Komm«, sagte der erste und streckte die Hand aus, um mich festzunehmen, »die Casa dei Catacumeni erwartet dich.«
Ich wandte mich um und floh. Hinter mir erscholl das Gebelfer grausamen Gelächters, dazu die Rufe der Priester: »Stehenbleiben!«, »Haltet ihn!«, »Ketzer!« Ich lief davon, mit dumpf hämmerndem Herzen. Ich lief davon. Was konnte ich anderes tun?
War es den Priestern ernst, oder machten sie sich nur einen Spaß? Entscheidet Ihr. Solche Dinge waren schon vorgekommen. Kinder sind ihren Eltern unter fadenscheinigeren Vorwänden entrissen worden, darunter mein eigener Bruder. Ein Christ hatte mich mit Schmutz begossen und die magischen Worte gesprochen. Aus ihrer närrischen Sicht mochte ich in der Tat ein Christ sein.
Um Venedig Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die Serenissima hat ihre Juden nie geplagt, jedenfalls nicht zur vollen Zufriedenheit Roms und der Kirche. Hier waren die von Papst Gregor XIII. vorgeschriebenen Bekehrungspredigten – strafe ihn, o Herr, für seine Niedertracht – nie im Schwange. Hier ist man allgemein der Ansicht, daß gewaltsame Maßnahmen in Glaubensdingen eher Erbitterung schaffen als Erbauung. Bedauert unsere armen Brüder in Rom und selbst in Padua! In Venedig gilt die Zwangstaufe von Kindern gleichsam als ein Verbrechen, als etwas, was man nicht tut. Aber wenn man es doch tut, was dann? Kann die Taufe rückgängig gemacht werden? Zum Glück ließen die Dominikaner von der Verfolgung ab. Doch für meinen Vater und mich, und für die Gemeinde, folgten einige bange Wochen. Die Bekehrung von Erwachsenen galt schließlich sogar hier in Venedig als ein Ziel, aufs innigste zu wünschen, und vergeßt nicht, nach jüdischem Gesetz war ich bereits ein Erwachsener. Bedenkt nur, mit welch überheblicher Barschheit mich ein venezianisches Gericht beschied, Jahre später, am Ende meines ersten großen Prozesses, als ich Klage gegen Ascher Bassan erhob, oder, um genau zu sein, gegen Signior Antonio Bassanio, den bekehrten venezianischen Edelherrn.
Er war in seinen Jahren außerhalb der Ghettomauern zu Ansehen und Wohlstand gelangt, frei von den Kneifzangen der peinlichen Gesetze, die uns beengen. Seine Galeonen segelten dickbäuchig auf der Flut, wohlgefüllt mit schwerer Seide und kostbaren Gewürzen. In jedem fremden Hafen wehte seine Handelsflagge, er überragte als großer Kaufherr das kleine Handelsvolk. Kurzum, er hatte sein Netz um den Erdball geworfen und damit Gold an Land gezogen.
Und doch kam er eines Tages zu mir um Geld. Er wollte mir nicht sagen, warum er Geld brauchte oder warum er in Geldnot zu mir kam. Das ginge mich nichts an. Aber er erbot sich, mir einen Schuldschein auf drei Monate über dreitausend Dukaten zu unterschreiben. Wollte ich einschlagen? Dreitausend Dukaten! Eine hübsche Summe.
Er hatte einen Freund mitgebracht, den er einfach als Messer Orlando Lorenzacchio vorstellte. Dieser war ein junger Geck, in leuchtendbunte Seiden gekleidet, ein Stutzer mit wunderlich gekräuseltem Haar, hochmütigem Auge und parfümiert wie eine Metze. In der Hand hielt er eine Orange, und dann und wann führte er sie an die Nase, als gelte es, diese Körperöffnung vor der eklen Luft zu schützen.
»Willst du nun den Schuldschein annehmen?«
Ich sagte, es sei mir eine Ehre.
Die güldene Wasserfliege flüsterte in Antonios Ohr.
»Als Wucherer und Jude«, sagte Antonio, »wirst du ohne Zweifel erwarten, aus dieser Anleihe Gewinn zu schlagen.«
»Als Kaufmann und als Christ«, sagte ich, »erwartest du ohne Zweifel, aus deinen Handelsgütern Gewinn zu schlagen. Oder verschenkst du deine Waren in christlicher Mildtätigkeit? Aber von dir, Signior Antonio, will ich keine Zinsen nehmen. Ich werde dir die Dukaten aus alter Freundschaft leihen.«
Das Wort »Freundschaft« gefiel ihm gar nicht. »Sehr liebenswürdig«, sagte er naserümpfend.
Lorenzacchio flüsterte ihm wiederum ins Ohr.
»Aber wir müssen etwas einsetzen, damit der Schuldschein Gültigkeit hat«, sagte Antonio. »Ach, ich hab’s: als ein lustiger Spaß laß uns sagen, daß du, falls ich versäume, meine Schuld pünktlich zu tilgen, nahe meinem Herzen ein Pfund Fleisch herausschneiden sollst. Was sagst du?«
»Ein lustiger Spaß?« Er widerte mich an. »Den Humor darin vermag ich nicht zu sehen.«
»Komm, komm, ich bestehe darauf.«
»Wir müssen zum Notar gehen.« Hätte er doch nie den Fuß über meine Schwelle gesetzt!
Ich rief nach meiner Tochter Jessica, um ihr zu sagen, daß ich fort mußte. Sie knickste artig vor den Fremden. Meine Frau starb vor Jahren, als sie ihr das Leben schenkte. So war Jessicas Schönheit für mich ein Grund zu Freude und zu Leid.
Antonio, sah ich, war baß erstaunt. Er konnte sich noch an Lea erinnern, als sie, wie Jessica, sechzehn Jahre alt war. Er verneigte sich galant vor ihr. »Dein Liebreiz tritt den Beweis an für die Schönheit deiner Mutter.«
Lorenzacchio flüsterte wieder in Antonios Ohr. Diesmal hörte ich seine Worte. »Und beweist, daß der alte Teufel Hörner trägt!« Sie lachten zusammen, wobei der Geck sich seine Orange vor die Nase hielt.
Mir gefiel die abwägende Art nicht, mit der des jungen Lorenzacchios Blicke über meine Tochter schweiften. Mir gefiel ihre gezierte Erwiderung nicht, ihr Erröten, ihr Lächeln. Ich beeilte mich, die Christen aus meinem Haus zu schaffen.
Beim Notar nahm Lorenzacchio den Schuldschein aus Antonios Hand, las ihn sorgfältig durch, lächelte schief und gab ihn zurück. Antonio unterschrieb. Lorenzacchio flüsterte in Antonios Ohr.
»Möchtet ihr heute mit uns zu Abend essen, du und deine schöne Tochter?« fragte Antonio.
»Der Signior ist zu liebenswürdig. Allein, wir dürfen nicht, selbst wenn wir wollten.«
Und das war das.
Die Zeit verstrich. Antonios Zahltag kam und ging. Endlich begab ich mich zu seinem prächtigen Palazzo, mit seinem Schuldschein in der Hand. Er wimmelte mich ab, erbat sich eine weitere Woche. Wieder ging ich zu ihm, wieder wurde ich abgewimmelt. Als ich zum dritten Mal vor dem Palazzo erschien, warfen seine Diener mich grob zur Tür hinaus, und aus einem Fenster im Obergeschoß entleerte eine gackernde Vettel einen Eimer Spülicht auf meinen Kopf, eine zweite Taufe. Die Gassenbuben Venedigs verfolgten mich bis nach Hause, johlten und brüllten vor Lachen. So viel zu »alter Freundschaft«.
Ich brachte ihn vor Gericht, verlangte nur Gerechtigkeit. Es war der erste meiner Prozesse, ein Jahrhundertfall, denn hier stand ein verworfener Jude, der einen Venezianer, einen Christen, einen Kaufherrn verklagte – eine unsagbare Unverschämtheit! Der Gerichtssaal war brechend voll. Ich verteidigte mich selbst, Antonios Schuldschein zur Rechtsgrundlage, seine Verbindlichkeit lag auf der Hand. Aber Antonio wurde vom alten Bellario vertreten, dem gerissensten Advokaten in Venedig, und ihm sekundierte der junge Lorenzacchio, kein eitler Pfau mehr, sondern Schreiber des Advokaten in schlichtem Amtskleid, mit einem Federkiel hinterm Ohr.
Ich verlor. Wie sich herausstellte, gab es ein uraltes, in verstaubten Folianten vergrabenes Gesetz, wonach im Falle, daß ein Jude das Leben eines Venezianers bedrohte, des Juden eigenes Leben verwirkt war. Das Pfund Fleisch in der Vertragsurkunde stellte eben solch eine Bedrohung dar. Vergeblich brachte ich vor, daß ich kein Verlangen nach einem Pfund Fleisch hatte, daß ich nur mein Grundkapital wollte. So viel zur Gerechtigkeit. Dann erwies das Gericht mir Gnade: ich durfte mein Leben dem städtischen Henker übergeben, oder ich durfte mich meines Lebens als Christ erfreuen. Mir blieb ein Monat Zeit, mich zu entscheiden.
Das Gebälk des Gerichtssaals hallte wider vom Beifallsgeschrei der Zeugen meiner Niederlage. Bravo! Bravo! Antonio warf die Arme um den jungen Lorenzacchio und küßte ihn auf beide Wangen. Dann wandte er sich mir zu, auf seinen Lippen lag ein Lächeln grausamen Triumphes, und in seinen Augen blitzte die Schuld des bösen Vorsatzes. Ich floh aus dem Gerichtssaal, doch die Christenschreie klangen mir noch lange in den Ohren.
Natürlich legte ich Berufung ein. Mein zweiter Prozeß verlief ohne Aufhebens. Der Gerichtssaal war fast leer. Diesmal war ich es, der den alten Bellario zum Rechtsbeistand hatte. Diesmal war kein schief lächelnder Lorenzacchio anwesend; Antonio ließ sich von seinem Kontorvorsteher vertreten. Diesmal gewann ich. Der alte Bellario war beim Stöbern in seinen verstaubten Folianten auf Gesetze gestoßen, die das erste außer Kraft setzten. Die Androhung von Tod oder Taufe wurde von mir genommen, und Antonio, vertreten durch seinen Vorsteher, wurde angewiesen, mir mein Grundkapital zurückzuzahlen – abzüglich der Gerichtskosten, die an den Staat fielen. Ich dankte dem Gericht für seine Gerechtigkeit, dankte dem alten Bellario für seine vortreffliche Beweisführung und ging.
Mein Triumph war kurzlebig. Ich kehrte nach Hause zurück, nur um festzustellen, daß meine Tochter fort war. Wie Gobbi, mein Diener, mir sagte, war Messer Lorenzacchio gekommen, sie zu holen, und sie hatte ihm gezeigt, wo ich meine Schatztruhen verbarg, die sie davongetragen hatten.
»Und du hast nichts unternommen, um sie aufzuhalten, du Tölpel?«
»Sie haben mir gesagt, Ihr brauchtet augenblicklich Euren Schatz, Herr, und habet sie angewiesen, ihn eiligst zum Gericht zu tragen.«
Ich fürchtete, meine Beine hätten sich in Wasser verwandelt. Ein schrecklicher Schmerz durchbohrte mein Herz. Keuchend schickte ich Gobbi um ein wenig Wein.
»Du hast diesen Messer Lorenzacchio schon zuvor gesehen?«





























