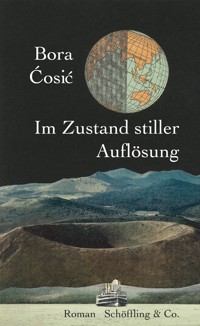13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom »Stall« über »die Straße« zum »Garten« führt der eigenartige Weg eines namenlosen Ehepaars in mittleren Jahren. Der Stall ist eine großbürgerliche, aber vermüllte Wohnung in irgendeiner europäischen Stadt des vergangenen Jahrhunderts. Umgeben von Zeitungen und wuchtigen Möbeln, dreht der Ehemann darin ab und zu mit dem Fahrrad eine Runde durch den Flur und sinniert über das Leben, die Frau kocht, fegt und näht wortlos Knöpfe an. Eines Tages durchbrechen sie die Routine, flüchten ins Ausland und finden sich mit nichts als einem überdimensionalen leeren Pappkoffer auf der Straße wieder. Dort werden sie von der Polizei aufgegriffen, die ihre Sprache nicht versteht und sie überfordert abschiebt. So landen sie im Garten, dessen Besitzer, Professor Daumer, Helfer für die Spargelernte braucht. Wie der Lehrer des berühmten Findelkindes Kaspar Hauser bringt er seinen Schützlingen anhand der Botanik eine neue Sprache bei. Doch eine Geheimoperation, die unbemerkt im Hintergrund abläuft, endet abrupt in einem Fiasko. Der »große alte, listig-heitere Mann der serbischen Avantgarde«, wie die Neue Zürcher Zeitung Bora Cosic nannte, hat mit »Operation Kaspar« einen pointierten, hintersinnigen Roman geschrieben, der den alten Migrantentraum von Bildung und einem besseren Leben gnadenlos zerplatzen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Der Stall
Die Straße
Der Garten
Autorenporträt
Übersetzerporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Operation Kaspar
Der Stall
Früher oder später gewöhnt man sich an das Zimmer des eigenen Lebens, nicht anders als man nach einiger Zeit gegen den eigenen Geruch unempfindlich wird. Selbst wenn man nach Unbehagen und Bitterkeit riecht, einer Art Moschus, dem Mief der Langeweile. So bleibt meist nur der Raum, in dem sich der Mann morgens rasiert. Er steht im Unterhemd am Waschbecken und blickt gedankenverloren in die Seifenbrühe. In einem Zimmer, lange nicht geputzt, unaufgeräumt, vollgestopft mit Kram. Der eigentlich nicht hierhergehört, sodass der Verschlag, der für die tägliche Rasur gedacht ist, offenbar als Lager für komplette Schicksale herhalten muss. Unterdessen starrt der Mann, immer noch unrasiert, in das Becken voll Lauge und fragt sich, wie es so weit kommen konnte. Früher, denkt er, war alles ordentlich, und dann geriet so viel durcheinander. Im schmutzig grauen Wasser kann sich der Mann nicht sehen, sein Gesicht nicht und seine Vergangenheit schon gar nicht. Deswegen steht er da, unentschlossen, ob er sich rasieren soll oder nicht, unsicher, ob das Zimmer, in dem er steht, überhaupt ihm gehört. Oder eher dem gemeinen Europäer, den genau genommen keiner kennt. Von daher seine Neigung, von der Handlung am Waschbecken Abstand zu nehmen. Der vorliegende Bericht handelt von einem Angehörigen unserer Rasse, einem Mann, den plötzlich das Gefühl beschleicht, er sollte von allem Abstand nehmen und vor allem aufhören, dieser Rasse anzugehören. Keine Lust mehr, jeden Morgen die paar Stoppeln abzurasieren. Wobei der Bart eines Mannes am Rande der Verzweiflung vermutlich schwächer wächst als bei einem, der sich mit brachialem Schwung durchs Leben schlägt. So wie alles, was ein fast Verzweifelter tut, schwächer ausfällt, schleppend, kaum wahrnehmbar. Und auch sein Leben vergeht, ohne groß Spuren zu hinterlassen. Eigentlich vergeht jedermanns Leben so, es geht ganz überwiegend geräuschlos seinen Gang, und auch die Zeit verstreicht, ohne dass sie ein spezifisches Geräusch von sich gäbe.
In dem Zimmer muss der Mann, immer noch unrasiert, erst die morgendlichen Dämonen vertreiben, bevor er sich anderen Dingen zuwenden kann. Beispielsweise Gedanken, die das Geschehen außerhalb des Zimmers betreffen. Vielleicht erwartet ihn ein Leben an der frischen Luft, unter Bäumen, auf Wiesen, mit Vögeln ringsum. Vielleicht auch nicht. So oder so könnte er die Stadt, in der er lebt, in Gedanken anheben, einschließlich der Fabrik am Stadtrand, in der er womöglich Arbeit fände. Dann könnte er Drähte spannen und Apparate anschließen, um die Fabrik mit den übrigen Gebäuden der Stadt zu verbinden. Danach führen Straßenbahnen, und unter der Erde ertönte der Pfiff einer Lokomotive. Zuletzt müsste das alles noch gezeichnet und mit einfachen Worten beschrieben werden: Unterirdisch pfeift ein Zug, und der Schornstein, der zur Fabrik gehört, qualmt.
Eine der Ideen des Mannes ist, dass er eine Gefährtin haben müsste. Zufällig handelt der vorliegende Bericht von einem Mann und einer Frau, die zusammenleben, ohne sich zu kennen. Endlich sehe ich, wie sich mein Held in besagtem Badezimmer rasiert. Er steht in Unterwäsche da, er besitzt bloß zwei, drei Garderoben, die müssen für alles, was das Leben erfordert, ausreichen, und die Unterwäsche ist fürs Rasieren vorgesehen. Auch seine Frau läuft, während er sich rasiert, in Unterwäsche durch die Wohnung. Der Unterrock ist Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts und wahrscheinlich auch später noch das weibliche Kleidungsstück schlechthin, ein seidenes Etwas und alles andere als eine neutrale Sache, der Unterrock ermöglichte seiner Trägerin damals einen vollwertigen Auftritt. Etwa um durch die Wohnung zu laufen, während sich der Mann mit seinem Unterwäschedress im Badezimmer rasiert. Sie kann gar nichts anderes tragen, während sie durch eine Wohnung läuft, in der sich ein Mann rasiert. Es ist so unvorstellbar wie bei jeder anderen Frau, von denen jeder Mann mindestens eine aus eigener Anschauung kennt. Sie laufen im Unterrock durch die Wohnung, während man sich im Badezimmer rasiert, und dann schaltet man gemeinsam das Radio ein. Das geht so weit, dass man einsam in seiner Ecke sitzt und sich das Mädel im Radio gar nicht anders als im Unterrock vorstellen kann, während sie den Wetterbericht ins Mikro spricht. Und weil sie ohnehin sagt, dass das Wetter schlecht wird, wäre es doch nur vernünftig, wenn sie es sich in ihrem Studio weit weg in einer anderen Stadt im Unterrock und womöglich barfuß bequem machte.
Ich kann nicht genau sagen, warum, doch die Frau wirkt, so wie sie in ihrem Unterrock herumläuft, unsicher und nervös. Wenn sie eine Schublade aufzieht, etwa um eine Spule Nähgarn herauszunehmen, bleibt die Schublade anschließend offen, auf unbestimmte Zeit. So wie die vielen anderen Schubladen, die halb geöffnet aus dem Schrank quellen wie Innereien aus einem aufgeschlitzten Bauch. Dadurch ist das wuchtige Möbelstück dauernd im Weg, die Frau fühlt sich bei ihren Wohnungswanderungen gestört und reißt ständig den Mund auf wegen der zahlreichen Hindernisse. Sie scheint jeden Gegenstand, den sie zur Hand nimmt, dort liegen zu lassen, wo sie ihn für den Moment brauchte, und schichtet auf diese Weise Berge von Dingen auf, die dem Zimmer allmählich den Charakter einer Landschaft geben. Denn alles hier ist hügelig, kein Zentimeter ebene Fläche verblieben, fehlen nur noch Sträucher und Eichhörnchen. An diese Phänomene ist der Begleiter der Frau längst gewöhnt, er wähnt sich beinah draußen in der Natur, vielleicht auf einem Ausflug. Möglich, dass in unzähligen Zimmern unserer Zivilisation Menschen mitunter das Gefühl haben, nicht durch ihre Zimmer, sondern durch ein Wäldchen oder über ein vom Unkraut überwuchertes Feld zu gehen. Weil das Leben vieler Menschen einer Brache gleicht, einem Feld, das eigentlich beackert gehörte, nur dass der Eigentümer dieses Fleckchens Erde die Landwirtschaft aufgegeben hat. Weshalb das Erdreich, auf dem die Städte stehen, unversehens in einzelne Häuser, innerhalb dieser Häuser in einzelne Wohnungen und innerhalb dieser Wohnungen in einzelne Zimmer eindringt, wie wenn das bürgerliche Leben aus verschiedenerlei Gründen nach und nach zugeschüttet würde oder sich vor dem Anbranden der Felsbrocken und Steine zurückzöge.
Der Mann trägt meistens einen Hut, er denkt, der sei beinah sein ganzer Besitz, und unter diesem Hut, einem Proletarier des Lebens gleich, bringt er seine Tage in dem Zimmer zu, von dem ich rede. So sehen entlassene Werktätige aus, die in eine Ecke gekauert im Schutz einer Hauswand auf eine Gelegenheit hoffen. Doch war die Menschheit, soweit europäisch, im zwanzigsten Jahrhundert nicht immer wieder in der Situation eines Arbeitslosen, der nicht ein noch aus weiß? Und wenn er mal zum Dienst gerufen wurde, dann zu dem an der Waffe, Gewehre waren die geläufigsten Werkzeuge jener Zeit.
Der Hut stört den Mann überhaupt nicht, während er eine alte Zeitung liest oder ab und zu Geige spielt, in der Ecke. Auch die Frau im Unterrock ist noch da, barfuß. Sie wuselt wie immer durchs Zimmer, wirkt in ihrem Auftreten immer noch nervös. Erst versucht sie, den Wasserhahn in der Küche zuzudrehen, damit er nicht ständig tropft, dann tritt sie vor den Spiegel und betrachtet sich lange in ihrem Unterrock. Manchmal fährt sie sich durch die Haare, meistens schweigt sie. Die beiden reden wenig oder fast nichts miteinander. Es gäbe recht viel, was der Mann der Frau zu sagen hätte, aber wozu? Alles, was ein solches Paar einander zu sagen hätte, wurde schon tausend Mal gesagt. Von der Glühbirne, dem Regen, über den Morgen und die Küchenschabe. Wo all diese Erscheinungen auch ohne die Worte, ja, so viel besser ohne die Worte existieren, die sie bezeichnen! Daher das Schweigen zwischen den beiden. Sie leben einfach nebeneinander in dem Universalzimmer ihres Lebens, wir alle leben dort, wir geben es nur nicht zu. Weil das Leben uns anstrengt und quält. Besonders die Frau, sozusagen meine Heldin. Von der ich erzähle, als würde ich sie sehr gut kennen, nur weil ich andere Frauen kannte, die zu Hause gern im Unterrock herumliefen. Und zwar barfuß. Während ein ähnlicher Mann in der Ecke saß, mit Hut. Und nichts anderes im Sinn hatte, als Zeitung zu lesen und ein wenig Geige zu spielen.
Die Frau sucht unterdessen die Strom- und die Gasrechnung, eben lagen sie noch da, plötzlich sind sie weg. Sie könnten zwischen die Briefe und Postkarten gerutscht sein, die auf dem ganzen Tisch verstreut liegen. Oder sind unter die Zeitschrift auf dem Boden geflattert, in der ein Artikel beschreibt, wie der weibliche Busen zu pflegen sei. Dort liegen auch leere Flaschen, die durch den Raum rollen und gelegentlich klirren, während die Frau hin und her rennt, immer noch in der Hoffnung, die verdammten Rechnungen für Strom und Gas zu finden. Die blöden Schriftstücke waren eben doch noch da, und jetzt sind sie weg, sind vielleicht runtergefallen. Ein Blatt Papier fällt gern mal hinter die Anrichte oder kriecht unter ein anderes Blatt und bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Das ist der besondere Fluch kleiner Dinge, irgendwo dahinter- oder dazwischenzufallen, und weg sind sie. Fliehen vor der menschlichen Aufmerksamkeit wie ein Dieb, der sich vor der Polizei versteckt. Gereizt sucht die Frau hinter der Anrichte weiter, rückt sie von der Wand ab, findet einen Knopf (den Wintermantel dazu hat sie vor zehn Jahren weggeworfen), ein Foto ihrer Großmutter, eine verbogene Gabel, ein eingetrocknetes Stück Wurst, aber die Rechnungen findet sie nicht, als hätten sie sich in Luft aufgelöst! Dabei sind sie ganz bestimmt noch nicht bezahlt, am Ende werden ihnen noch Strom und Gas abgestellt! So wie das Telefon aus dem nämlichen Grund schon vor längerer Zeit abgestellt wurde. Was letztlich nicht schlimm war. Denn wann immer sie jemanden anrief, war der Jemand angeblich gerade beim Haarewaschen oder hatte eine Suppe auf dem Herd stehen oder es hatte an der Tür geklingelt, und schon hängte der universale verhinderte Jemand wieder ein. Zu allem Überfluss ist die Uhr in der Nacht stehen geblieben, und jetzt ärgert sich die Frau, weil sie nicht weiß, wie spät es ist. Auch wenn Zeit im gemeinsamen Haus unserer Zivilisation wenig bis nichts bedeutet. Man sieht sie höchstens den Blechnäpfen an, die durch langen unsanften Gebrauch in der Küche verbeult sind und allmählich Rost ansetzen. Das ist die einzige Spur, die die Zeit in der Wohnung hinterließ, mal abgesehen von den Zeitungen, die noch immer den Überfall auf Pearl Harbor melden und wer 1959 zur Miss Italia gekürt wurde. Allein dadurch ist das Zimmer historisch im Kosmos verortet und durch sonst nichts. Denn die Menschen, die in dem Zimmer wohnen, hätten auch früher, etwa am Anfang unserer Zivilisation, der städtischen und europäischen, leben können. Sie könnten aber auch später leben, kurz bevor unsere Zivilisation erlischt. Demzufolge dehnt sich die Zeit des Zimmers sehr in die Länge, wird zur Geschichte eines lange existierenden Zimmers. Das unzählige Bewohner sah, obwohl es nicht so aussieht, als wären hier viele Menschen durchgezogen. Es ist nur ein bisschen unordentlich und, vielleicht infolgedessen, unglücklich.
Jeder Mann mag nun annehmen, er sei gemeint, und das stimmt bis zu einem gewissen Grad auch. Das Individuum mit Hut, das im Zimmer Zeitung liest – was für ein Bild, fast schon filmreif –, hat wahrscheinlich seine eigene Sicht auf die Welt, aber niemanden, dem er sie mitteilen könnte. Er könnte sich wohl an den Tisch setzen und sich an einer Postkarte versuchen. Auf der sein Zimmer oder eine vergleichbare allgemeine Wohnstatt für unsere Leben abgebildet ist. Aber es wäre ein reichlich idiotischer Einfall, einem Mann, der in ähnlichen Verhältnissen lebt, so eine Karte zu schreiben. Der andere weiß selbst ganz genau, wie es sich in solchen Zimmern wohnt, das braucht man ihm nicht zu schreiben. Es bleibt also nichts anderes übrig, als ihm, um die kleine Fläche auf der Rückseite zu füllen, mit breit hingemalten Buchstaben liebe Grüße zu schicken. Und selbst die paar Worte wirken sinnlos, weil auf der Vorderseite ohnehin »Gruß aus meinem Zimmer« steht. Was sich genauso gut auf das Zimmer beziehen könnte, in dem die Post ankommen soll, falls die Post funktioniert. Denn beide Zimmer sind identisch. Soviel ich weiß, kennt die Philosophie den Begriff der Identität. Er bezeichnet so etwas wie eine Aura, die besondere Luft, die diesen oder jenen Raum erfüllt, ihm eine eigene Note verleiht. Die Note ist die Identität. Die vereint, vereinheitlicht, verallgemeinert. Auf der Postkarte sind außerdem ein paar Möbelstücke zu sehen, willkürlich im Raum verteilt. So bekommen wir ein Bild von zwei gleichartigen Zimmern, die es nirgends gibt, weil sie überall sind.
Die Frau des Mannes, die im Unterrock durchs Zimmer spaziert, hat anderes zu tun, will die Anrichte wieder an die Wand rücken und danach endlich dem Wasserhahn in der Küche das Tropfen austreiben. Ich denke, ihr Mann, der ein genaues Abbild vieler Männer ist, hat die ganze Welt im Kopf, auch wenn er das nie zugeben würde. Er denkt über die Gewerkschaftsbewegung nach, über den Liberalismus oder die Abschaffung der Todesstrafe. Über die Rolle der Kreditinstitute oder das wenig vertrauenerweckende Gebaren von Versicherungsgesellschaften. Über Großkonzerne und den Bau immer größerer Ozeanriesen. Er kennt sich mit Basketball und Eislaufen aus, mit Katholiken und Protestanten, mit Faschismus und dem in zahlreichen Pamphleten gepriesenen wissenschaftlichen Sozialismus, hat eine Meinung zur Abschaffung der Kinderarbeit und zu Attentaten und zum Sturz eines Ministers, der in Prag aus dem Fenster geworfen wurde. Zur Ermordung des russischen Zaren. Zu Pferderennen. Zu Polarexpeditionen und der Meinung, dass denen da oben hoch im Norden ganz schön kalt gewesen sein dürfte.
Jetzt kennen Sie den Mann schon ziemlich gut, aber weil er fast immer den Hut aufhat, können Sie sein Gesicht vermutlich nicht gut sehen. Nicht einmal seine Frau sieht ihn richtig, denn sie hat eine ganz andere Vorstellung vom Leben in dem Zimmer. Jeder hat eigene Vorstellungen vom Leben, selbst wenn wir uns in demselben Raum desselben Zeitalters befinden, das ist für jeden von uns ein Problem. Die Frau zum Beispiel findet, ihr Mann sei schuld, wenn sie die Rechnungen nicht finden kann; bestimmt, denkt sie, hat er sie entsorgt. Von allem, was die äußerst reizbare Dame auf ihren Wanderungen zwischen Zimmer und Küche nicht finden kann, glaubt sie, der unsensible Herr hätte es aus dem Fenster geworfen. Ihrer Meinung nach lagen die Rechnungen auf dem Tisch oder auf dem Boden oder in einer Schale, egal, und dann hat sie der Grobian im Vorbeigehen zerknüllt und ins Klo befördert! Sie könnte schwören, sie hätte die Spülung rauschen gehört, obwohl er die ganze Zeit im Zimmer war, in der Ecke, und etwas auf der Geige ausprobierte.