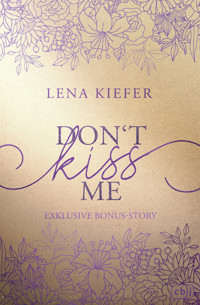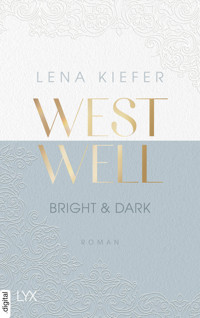8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Ophelia Scale-Reihe
- Sprache: Deutsch
Sie bietet dem Tod die Stirn und dem Schicksal ihr Herz
Die 18-jährige Ophelia ist zum Tode verurteilt. Im Auftrag des Widerstandes hat sie einen Anschlag auf den König verübt. Ihre Liebe zu dessen Bruder Lucien hat sie ebenso geopfert. Doch dann bietet ihr Phoenix, der Chef des Geheimdienstes, einen Handel an: Wenn sie bereit ist, sich bei ihren Freunden von ReVerse als Spionin der Regierung zu betätigen, kann sie ihr Leben und das ihres besten Freundes retten. Nun muss Ophelia sich entscheiden - zwischen ihren Gefühlen und dem Glauben, was sie für richtig hält.
Alle Bände der Ophelia Scale-Trilogie:
Ophelia Scale – Die Welt wird brennen
Ophelia Scale – Der Himmel wird beben
Ophelia Scale – Die Sterne werden fallen
Ophelia Scale – Wie alles begann (Shortstory, nur als E-Book verfügbar)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
LENA KIEFER
DER HIMMEL WIRD BEBEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2019 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Carolin Liepins, München
Covermotiv: Shutterstock.com (Bokeh Blur Background, Merggy, rvika, Potapov Alexander, ojka)
MP · Herstellung: AJ
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23096-8V003
www.cbj-verlag.de
Für Theresa, Roland und Kathrin, weil mit euch alles begonnen hat
1
Eins.
Zwei.
Drei.
Vier.
Fünf.
Sechs.
Ich zählte bis zehn, dann bis zwanzig, bis hundert und weiter. Als ich bei tausend ankam, hörte ich auf und begann von vorne. Ich musste das tun, ich musste zählen. Wenn ich nicht gezählt hätte, wäre ich an den Gedanken in meinem Kopf erstickt.
Der Spalt zwischen der Liege und Wand war schmal, aber ich passte gerade so hinein. Ich spürte den Beton, der unnachgiebig gegen meine Schultern drückte. Den harten Untergrund, der meine Wirbelsäule quälte. Trotzdem stand ich nicht auf. Die kalten Mauern hielten die Gefühle fern. Deswegen blieb ich dort sitzen, den ganzen Tag, jeden Tag. Meistens verbrachte ich auch die Nächte auf dem Boden. Seine Härte verhinderte die trügerische Sekunde nach dem Aufwachen, in der man glaubte, es wäre alles in Ordnung.
Achtzehn.
Neunzehn.
Zwanzig.
Ich verlagerte mein Gewicht. Das Metallgestänge der Liege drückte gegen meinen Arm. Sie war das einzige Möbelstück im Raum. Der war groß, aber ansonsten völlig kahl – drei Wände aus Beton, eine aus durchsichtigem Kunststoff, grauer Boden, graue Wände, graue Decke. Dazu gab es fünfzehn Kameras, die alles aufzeichneten, was ich tat. So ist das in einer Hochsicherheitszelle für Landesverräter und Schwerverbrecher. Für jemanden wie mich.
Ich hatte abgedrückt.
An diesen Moment erinnerte ich mich übergenau. Ich sah ihn wieder und wieder in jeder Sekunde, die ich nicht zählte. Aber dann – nichts. Kein Schuss, keine Kugel. Die Waffe hatte nicht funktioniert. Ich wusste nicht, warum. Ich musste es auch nicht wissen. In dem Augenblick, als sie mich betäubt hatten, war mir klar geworden, dass es völlig egal war, warum.
Erst hatte ich mit Eifer den Plan verfolgt, den König zu töten. Danach den, meinem Leben ein Ende zu bereiten. Beides existierte nicht mehr. Wo früher meine Überzeugungen gewesen waren, gab es nur noch einen leeren Raum – leer wie die Zelle, in der ich darauf wartete, dass man mir das Leben nahm. Die Zelle, in der mich niemand besuchte, niemand außer der Stille, die mit jedem Tag lauter wurde, mich etwas mehr erdrückte. Die Mauer zwischen mir und meinen Gefühlen schwankte. Ich krallte meine Finger so fest in die Ärmel meiner Gefängniskluft, dass sie sich in meine Haut bohrten. Der Schmerz half.
Drei Wochen war ich nun hier drin. Zweimal am Tag bekam ich eine Mahlzeit und wusste nur durch das Dimmen des Lichtes, wann die Nacht begann. Einmal täglich wurde eine Dosis HeadLock durch die automatische Zugangsklappe geschoben. In unregelmäßigen Abständen öffnete sich ein Durchgang und ich konnte duschen, mit kaltem Wasser und schlechter Seife. Meine Haare waren stumpf, meine Haut spannte, als wäre sie aus Pergament. Seit den Verhören in den ersten Tagen hatte ich kein menschliches Wesen mehr gesehen, außer in meinen Träumen. Darin tauchte immer Leopold auf, überlebensgroß und beängstigend real. Es ist das Ende für uns alle. Auch für dich.
Manchmal fragte ich mich, warum das so lange dauerte. Warum sie mich nicht endlich zu meiner Hinrichtung abholten. Aber vielleicht war das ein Teil der Strafe. Ein Leben in dieser Zelle ohne Ablenkung oder menschlichen Kontakt, bevor sie es endgültig beendeten. Ich hätte nie gedacht, dass es so entsetzlich sein könnte, allein zu sein.
Vierunddreißig.
Fünfunddreißig.
Sechsunddreißig.
Siebenunddreißig.
Ich zuckte zusammen, als sich die Klappe in der Wand öffnete. In der bleiernen Stille war das Geräusch so laut wie ein Pistolenknall. Mein Puls schnellte hoch, die imaginäre Mauer, hinter der ich mich verkrochen hatte, bekam einen Riss. Ich schob meine Finger in die Haare und zerrte daran, hieß den scharfen Schmerz in meiner Kopfhaut willkommen. Mein Herzschlag beruhigte sich.
Ein Tablett glitt durch die Klappe am Boden. Ich kam auf die Beine, um es zu holen. Das Metall war warm unter meinen Fingern, genau wie die Schüssel darauf. Die Suppe war grün und roch nach einer eigenartigen Mischung aus Gemüse und Gewürzen. Die Schwaden des Geruchs waberten durch einen Riss meiner Abwehr, kamen bei mir an. Plötzlich war ich wieder in Brighton, saß zu Hause am Esstisch und wechselte mit meinem Bruder einen Blick – ein stummer Kommentar zu Lexies Kochkünsten.
Ein scharfer Schmerz fuhr mir in den Magen. Die Erinnerung an meine Familie rüttelte an meiner Mauer. Der Löffel in meiner Hand zitterte. Nein, nein, bitte nicht, flehte ich stumm. Aber es war zu spät.
Scham. Sehnsucht. Bedauern. Einsamkeit. All das brach über mich herein, zerlegte die Mauer in Trümmer. Ein trockenes Schluchzen bahnte sich gewaltsam einen Weg meine Kehle hinauf. Ich verlor den Kampf, in dem ich nie eine Chance gehabt hatte.
Fest schlang ich meine Arme um die Beine, presste Mund und Nase fest gegen meine Knie. Mein Wimmern hallte trotzdem von den Wänden wider, Tränen durchnässten meine Hose, liefen in meine verfilzten Haare und versickerten dort. Mein Kummer und meine Wut schüttelten mich, bis nichts mehr an seinem Platz war. Mit einem heiseren Aufschrei packte ich die Schüssel und schleuderte sie von mir. Sie knallte mit voller Wucht an die Plexiglaswand gegenüber und schepperte dann zu Boden. Grünliche Suppe lief die Scheibe hinunter und sammelte sich am Boden in kleinen Pfützen, die sich dort verloren. Genau wie ich.
Erst viel später regte ich mich wieder. Meine Muskeln waren verkrampft und beklagten sich über die Bewegung. Ich schleppte mich trotzdem bis zu den Überresten meines Essens, das längst zu stumpfen Flecken getrocknet war. Ich sammelte die leere Schüssel ein, stellte sie auf das Tablett und trug beides zur Ausgabeklappe. Das kalte Metall in meinen Händen brachte mich in die Realität zurück.
Zweiundvierzig.
Dreiundvierzig.
Ich kehrte zurück in meine Nische, erschöpft und leer. Dort schloss ich die Augen und lehnte meinen Kopf gegen die Wand. Er tat weh, aber ich spürte es kaum, denn er schmerzte ständig. Das HeadLock, das sie mir gaben, war zu hoch dosiert, was die gleichen Symptome hervorrief wie eine zu niedrige Dosis. Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Sie wollten nicht riskieren, dass ich zu viel dachte.
Mein Blick huschte zu den Kameras. Schaute er zu? War er stolz, dass er es geschafft hatte, mich zu manipulieren? Oder berührte es ihn nicht, weil er es vorher schon hundertmal getan hatte? Ich erinnerte mich an den Ausdruck in seinem Gesicht nach dem Attentat. Es war verzerrt gewesen, verzerrt vor Schock und Entsetzen. Er hatte nicht damit gerechnet, dass ich nach seiner brillanten Vorstellung aus der Reihe tanzen würde.
Vierundsechzig.
Fünfundsechzig.
Sechsundsechzig.
Der Gedanke an ihn brachte mich erneut an den Rand des Abgrunds. Ich presste meine Schultern stärker gegen die Wand, bis sie taub wurden. Längst hatte ich es aufgegeben, unser letztes Treffen immer wieder durchzuspielen, jede Regung, jedes Wort. Es war sinnlos. Er war in diesem Spiel besser als ich. Er hatte mich besiegt. Zerstört. Vernichtet. Alles, was er mir hinterlassen hatte, war Wut. Wut auf mich selbst, weil ich ihm geglaubt hatte.
Eine vertraute Dunkelheit griff nach mir, und es gab einen Moment, in dem ich nachgeben wollte. Mich hineinziehen lassen in die Schwärze, damit es vorbei war. Aber dann vergrub ich erneut meine Finger in den Ärmeln meiner grauen Kluft, rieb den harten Stoff zwischen den Fingern. Es half, ich entkam. Aber es war nichts, worauf ich stolz sein konnte. Ich war nur zu feige, endgültig den Verstand zu verlieren.
Einundsiebzig.
Zweiundsiebzig.
Nein, Moment.
»Ophelia?«
Ich schreckte so plötzlich hoch, dass ich mit dem Kopf heftig gegen die Wand knallte. Der Schmerz jagte durch meine Schläfen und vermischte sich mit dem ständigen dumpfen Pochen dort. Adrenalin trieb mich auf die Füße, bis ich begriff: Es gab hier keinen Kampf. Keine Flucht. Mein Kopf wusste das. Mein Körper würde es nie lernen.
Auf der anderen Seite der Scheibe stand Caspar Dufort.
»Ist es so weit?« Ich sah ihn an und er nickte.
»Leg die an.« Er schob ein Gebilde aus Metall durch die Öffnung für die Mahlzeiten. Mein ehemaliger Ausbilder war mit seinem ebenmäßigen Gesicht, den dunkelblonden Haaren und blauen Augen immer noch attraktiver, als ein einzelner Mensch sein durfte. Aber seine Miene war jetzt unbewegt und starr, seine Haltung aufrecht und steif. Es hätte nicht deutlicher sein können, dass er mich zutiefst verachtete.
Ich nahm die Fesseln entgegen und schob meine Hände hindurch, dann die Füße. Das Metall zog sich schmerzhaft fest, eine starre Verbindung dazwischen gab mir gerade genug Freiraum, um zu laufen. Dufort ließ die Scheibe zur Seite fahren und deutete in den Gang.
»Gehen wir.«
»Okay.« Meine Stimme war heiser, mein Puls hämmerte gegen die Innenseiten meines Halses. In der ersten Zeit hatte ich Angst vor diesem Tag gehabt, dann hatte ich ihn herbeigesehnt. Jetzt war es eine Mischung aus beidem.
Dufort wich meinem Blick aus, während er die Fesseln kontrollierte.
»Komm mit.« Er ging voran. Wir verließen den Sicherheitstrakt und trafen in einem Vorraum auf vier Gardisten. Sie begleiteten uns schweigend, aber nach der Stille in der Zelle war jedes Atmen, jeder Schritt, jedes Klirren der Schnallen an ihren Stiefeln für mich so laut wie eine Explosion. Am lautesten war jedoch ihre schweigsame Feindseligkeit. Ich zog die Schultern hoch. Es half nicht.
Ich wurde in eine TransUnit verfrachtet, die speziell gesichert war und keine Fenster hatte. Jede grobe Berührung an meinen Armen spürte ich so überdeutlich, als würde man mich schlagen. Trotzdem blieb ich stumm und fügte mich. Dufort stieg vorne ein, die Gardisten bei mir. Im Innenraum fixierten sie meine Fesseln am Boden und an der Wand, bevor alle vier neben mir Platz nahmen. Sie waren schwer bewaffnet und offensichtlich auf der Hut. Wahrscheinlich erinnerten sie sich daran, was ich mit ihren Kollegen gemacht hatte.
Während wir fuhren, kamen die Gedanken an meine Familie zurück. Wussten sie, was passiert war, mein Vater und mein Bruder? Wussten sie, was passieren würde? Dass mein Leben heute ein Ende fand? Ich hoffte, dass sie keine Ahnung hatten und mein Vater nie erfahren würde, was mit mir geschehen war. Es würde ihn umbringen. Und Eneas würde sich Vorwürfe machen, weil er mich nicht aufgehalten hatte, damals in Brighton. Als ich noch bei meiner Familie gewesen war, hatte ich sie ständig vor den Kopf gestoßen. Ich war so wütend gewesen, voller Zorn auf den König und das, was er mir mit der Abkehr und Knox’ Clearing angetan hatte. Meine Rache war mir wichtiger gewesen als die Menschen, die mir am nächsten standen. Ein Fehler, den ich nicht mehr korrigieren konnte. Das Bedauern fraß sich in meinen Magen wie ein Parasit. Wenn ich noch an die Sache von ReVerse geglaubt hätte, wäre es vielleicht etwas anderes gewesen. Aber ich glaubte an gar nichts mehr.
Die ersten Tage in der Zelle hatte ich noch glauben wollen. Immer wieder war ich die Begegnungen mit dem König und der OmnI durchgegangen, auf der Suche nach Gründen, warum ich das Richtige getan hatte. Aber im Nachhinein konnte ich Leopolds Argumente für die Abkehr nicht widerlegen, ebenso wenig wie die der OmnI dagegen. Vielleicht hatten beide die Wahrheit gesagt. Vielleicht keiner von ihnen. Ich wusste es nicht, nicht nach einer schlaflosen Nacht in absoluter Stille, auch nicht nach zwei oder vier. Und mit der Erkenntnis, dass es für mich keine Erkenntnis geben würde, war das Feuer erloschen. Das, was mich ausgemacht hatte, war in der Stille versickert.
Die TransUnit stoppte abrupt. Ich musste meine Füße auf den Boden stemmen, um nicht gegen die vordere Wand zu knallen.
»Wir sind da. Keine Dummheiten.« Einer der Gardisten sah mich warnend an.
Ich nickte nur.
Als die Tür aufging, blinzelte ich ins helle Licht. Dann erkannte ich vertraute Felsen und darüber ein Gebilde aus Glas und Stahl. Das Juwel. Wir waren in der Stadt, direkt vor der Festung. War das der Ort, wo man in Maraisville eine Hinrichtung durchführte?
Die Gardisten nahmen mich in ihre Mitte, Dufort ging voran. Meine Schritte waren kurz, meine Gelenke schmerzten unter den strammen Fesseln und von den harten Griffen an meinen Armen. Aber ich sagte kein Wort, unternahm auch keinen Fluchtversuch. Wohin hätte ich denn fliehen sollen? Ich hatte Hochverrat begangen. Zu Hause hätte ich nur meine Familie und Freunde in Gefahr gebracht. Und zu ReVerse konnte ich auch nicht zurück. Nein, es gab keinen Ausweg. Ich war heimatlos, ziellos, sinnlos. Und dazu bald tot.
»Setz dich hin.«
Es war Cohen Phoenix’ Stimme, die mich herrisch auf einen Stuhl verwies. Wir waren in einem der Räume unter der Erde, mit dunklen Wänden, einem Tisch in der Mitte und einem Terminal an der Wand. Wieder wurden meine Fesseln verankert, diesmal an Boden und Tisch. Es klickte laut und endgültig, als sie einrasteten. Aber es gab keine medizinischen Terminals, keine Waffen. Was sollte ich hier?
Mit mir im Raum waren Haslock, Phoenix und Dufort. Kurz darauf kam eine weitere Person herein.
»Gentlemen.« Die Frau nickte in die Runde. Sie war Mitte dreißig, dunkelhaarig, groß und schlank. Ich kannte sie nur vom Sehen, aber ihr abweisender Blick sagte mir, dass sie sehr viel mehr über mich wusste als ich über sie. Sie setzte sich und nahm ihr Pad.
»Imogen.« Phoenix nickte ebenfalls knapp.
Imogen Lawson war Leopolds Stabschefin und damit das Oberhaupt der königlichen Ressorts. Was bedeutete, sie stand noch über Phoenix und Haslock. Ich wusste, dass sie eine ehemalige Schakalin und außerdem seit Ewigkeiten mit Leopold befreundet war, weswegen sie, mehr als jeder andere, sein Vertrauen genoss. Offenbar hatte sie entschieden, sich das Mädchen anzusehen, das den König hatte töten wollen – und ihrem Ende beizuwohnen.
Alle Anwesenden schwiegen und beobachteten mich. Ich fühlte mich unter diesen Blicken wie ein Kind, das von seinen strengen Eltern eine harte Strafe zu erwarten hat. Warum sagte denn niemand etwas? Wieso zögerten sie es unnötig in die Länge? Ich tastete mit meinen Händen über den Tisch und presste sie gegen die Platte, um mein Zittern zu unterdrücken.
»Vermutlich fragst du dich, warum du hier bist«, begann Phoenix nach weiteren fünf Minuten Stille, in denen er auf sein Pad gestarrt hatte. Es war keine Frage. Ich gab keine Antwort. »Du hast einen Mordanschlag gegen Leopold de Marais verübt und damit an diesem Land und unserem König Hochverrat begangen. Dafür sieht das Gesetz den Tod vor.«
Jetzt nickte ich. Angst schlich sich heran wie eine räudige Katze und streifte lauernd um mich herum. Meine Lippen bebten, mir war kalt. Wie lange hatte ich noch? Fünf Minuten? Eine halbe Stunde?
»Leider liegen die Dinge in diesen Tagen anders.« Phoenix dehnte seine Worte, als wolle er sie am liebsten gar nicht aussprechen.
Ich hob den Kopf? »Anders?«
Er nickte unwillig. »Die Ereignisse nach deinem Verrat zwingen uns, Alternativen in Erwägung zu ziehen. Alternativen, die deine Beteiligung erfordern.«
Ich sah auf. Was hatte das nun wieder zu bedeuten? Musste ich doch nicht sterben? Oder durfte ich es nicht?
»Was soll das heißen?« Ich sah zu Dufort, der an der Schmalseite des Tisches saß und bisher nichts gesagt hatte. Er holte Luft, aber Phoenix kam ihm zuvor.
»Agent Dufort ist nicht mehr für dich zuständig. Ich habe entschieden, das operative Geschäft der Schakale wieder selbst zu übernehmen. Es ist erforderlich, um weitere Fehler zu vermeiden.«
Ich verstand, wenn auch langsam. Dufort hatte sich dafür verbürgt, dass ich die Seite wechseln würde. Da das nicht geklappt hatte, war er degradiert worden. Vom strahlenden Vorzeigeagenten zum stummen Beisitzer. Plötzlich konnte ich verstehen, wieso er mich ansah, als wäre ich seine persönliche Nemesis.
»Sie sagten, Sie bräuchten mich«, sagte ich leise. »Wofür?«
»Für einen Job.« Phoenix schoss einen seiner eisigen Blicke auf mich ab und ich sah auf die Tischplatte. Ich hatte keine Angst vor ihm, aber vor dem, was in seiner Macht stand. Man konnte ein Leben auf schnelle Weise beenden oder langsam und quälend. Welchen Weg er bei mir wählen würde, war völlig klar.
Der Raum wurde verdunkelt und der Holoerzeuger eingeschaltet. Eine schematische Karte der Stadt erschien, dazu rote Spots am See und im Juwel – und ein Foto. Karamellfarbene Haare, ebensolche Augen und ein ätzend perfektes Gesicht.
»Troy? Was hat das mit ihm zu tun?« In den Wochen meiner Gefangenschaft hatte ich Troy Rankin mit aller Gewalt aus meinem Kopf verbannt und versucht, nicht an ihn zu denken. Denn wenn ich es tat, musste ich unweigerlich darüber nachdenken, ob ich für etwas sterben würde, das es niemals wert gewesen war.
»Es hat alles mit ihm zu tun.« Imogen Lawson deutete auf das Bild. »Troy hat an dem Abend, als du in das Refugium eingedrungen bist, etwas Wichtiges gestohlen. Wir brauchen es zurück.«
»Was?«, fragte ich.
»Die OmnI.« Phoenix’ Blick wurde noch kälter.
»Die OmnI?!« Meine Gedanken überschlugen sich. Es war, als hätte mein Gehirn wochenlang im Tiefschlaf gelegen und wäre nun mit einem Adrenalinstoß wieder zum Leben erweckt worden. »Wie ist das möglich? Er sagte, dass dafür –«
»Leopold tot sein muss?« Jetzt meldete sich Dufort doch zu Wort. »Das war gelogen. Troy brauchte den Tod des Königs nicht. Er brauchte nur jemanden, der auf ihn schießen will.«
»Aber …« Ich brach ab. Was sollte ich dazu sagen? In den vergangenen Wochen war meine Welt so oft auf den Kopf gestellt worden. Es hätte mich nicht wundern dürfen, dass es schon wieder passierte.
Die Stabschefin zeigte auf die Projektion. »Wenn es einen Angriff auf den König gibt, werden die Notfallprotokolle aktiviert. Das bedeutet, die Festung wird abgeriegelt und die Systeme in der Stadt schalten auf autonomen Verteidigungsmodus – auch der Bunker unter dem See. Niemand kann dann dort eindringen.«
»Aber Troy war schon drin«, murmelte ich.
»Er hat den Hauptkern ausgebaut und gewartet, bis die Sperre aufgehoben wurde«, nickte Dufort. »Dann hat er seinen WrInk entfernt und ist geflüchtet. Wir waren mit dir beschäftigt und haben nicht auf ihn geachtet.«
Das bedeutete, ich war auch für Troy nur eine Figur auf dem Schachbrett von Maraisville gewesen. Er hatte ein Opfer gesucht – jemanden, der in verzweifelter Verfassung war und Zugang zur Festung hatte. Und ich hatte mich bereitwillig benutzen lassen. Schon wieder. Ein Lachen stieg mir in den Hals und brach heraus. Es klang hysterisch.
Die anderen am Tisch sahen sich an.
»Braucht sie etwas zur Beruhigung?«, raunte Haslock Dufort zu.
»Nein, sie braucht bloß eine Kugel in den Kopf«, antwortete ich sarkastisch.
Phoenix überging meinen Kommentar. »Rankin hat mit dem Kern nur die elementarsten Funktionen der OmnI stehlen können. Er benötigt weitere Komponenten, um sie zu einer funktionsfähigen Intelligenz aufzurüsten. Das heißt, wir haben Zeit, Gegenmaßnahmen einzuleiten.«
Gegenmaßnahmen, zu denen ich etwas beitragen sollte. Nur was, wusste ich immer noch nicht.
Imogen Lawson deutete auf die Projektion und sah mich an. »Die Widerstandsgruppe ReVerse benutzt eine Basis im Mittelmeer – ein ehemaliger Hotelkomplex, der nach der Abkehr nicht mehr bewohnt wurde. Wir vermuten, dass Rankin sich dort aufhält, genau wie die OmnI.«
Es erschienen Bilder einer Insel. Sie war recht klein, mit einem einzelnen Gebäude darauf, das wie ein typisch italopäisches Anwesen aussah. Ich erkannte mehrere Stockwerke und einen steil zum Meer abfallenden Hang. Die Aufnahmen waren jedoch verschwommen – als wären sie aus großer Entfernung aufgenommen worden.
»Da wir die OmnI in einem Stück zurückwollen, können wir die Insel nicht einfach mitsamt ReVerse im Meer versenken.« Phoenix verzog unzufrieden den Mund. »Und weil sie Verzerrer haben, die unsere Überwachung blockieren, brauchen wir jemanden vor Ort.«
Alle schwiegen und sahen mich an.
»Moment. Sie denken dabei … an mich?« Erneut kitzelte ein hysterischer Anfall meine Kehle. Vielleicht war ich in der Zelle doch wahnsinnig geworden, ohne es zu merken. Irre wissen schließlich nie, dass sie irre sind.
»Du hast bewiesen, dass du eine Menge Leute über deine Absichten täuschen kannst.« Es schien Haslock schwerzufallen, das zuzugeben.
»Das lässt sich kaum vergleichen, oder?«, fragte ich. Schließlich hatte beinahe jeder hier gewusst, was ich vorhatte.
Phoenix und Dufort wechselten einen Blick, den ich nicht deuten konnte.
»Du bist sehr gut, was Täuschungen angeht«, bekräftigte Dufort. »Wir sind sicher, dass du Rankin davon überzeugen kannst, dass du ReVerse treu dienst, während du Informationen für uns sammelst.«
Vielleicht war es das HeadLock, das meinen Kopf so träge machte. Vielleicht waren es die vielen Stimmen und Geräusche, die ich nicht mehr gewohnt war. Aber schlugen die gerade ernsthaft vor, dass ich als Doppelagentin zu ReVerse zurückkehren sollte?
»Was sagst du dazu?«, fragte Imogen.
»Ich … ich weiß nicht«, brachte ich heraus.
»Du weißt nicht, was du dazu sagen sollst?« An Haslocks Stirn schwoll eine Ader an. »Mädchen, du hast Hochverrat begangen und hättest um ein Haar den König erschossen!«, polterte er. »Du solltest uns auf Knien dafür danken, dass wir dir einen Ausweg bieten!«
Vor ein paar Wochen hätte ich ihm noch zornfunkelnd die Stirn geboten, weil er so mit mir redete. Aber jetzt zog ich den Kopf ein.
»Nahor, bitte.« Imogen hob die Hand. »Das bringt doch nichts.« Sie sah Phoenix an. »Bitte erläutere Ophelia die Vorgehensweise, Cohen. Sie soll wissen, was sie erwartet.«
»Deine Aufgabe wäre es, ReVerse zu infiltrieren, die OmnI ausfindig zu machen, zu stehlen und zu uns zurückzubringen.« Phoenix musterte mich kühl. »Natürlich setzen wir dabei nicht darauf, dass du uns freiwillig gehorchst. Wir würden dich entsprechend ausrüsten und permanent überwachen. Und es gibt Optionen für den Fall, dass du dich nicht an die Anweisungen hältst.«
»Also einen Ausschalter?«
»Wenn du es so nennen willst, ja. Ich finde die Bezeichnung InstantClear allerdings schöner. Du bekommst ein Implantat, das eine Variante des Clearing-Serums enthält, das dir mit einem Schlag die Erinnerungen der letzten fünfzehn Jahre nimmt. Wir werden es aktivieren, sobald du vom Plan abweichst.«
Ich nickte stumm, weil ich verstanden hatte.
»Außerdem«, begann Imogen, »bekommst du im Erfolgsfall ein Clearing von nur zehn Jahren statt der tödlichen SubDerm-Injektion – und kannst nach Hause zurückkehren. Das ist unser Angebot.«
»Ein sehr großzügiges Angebot«, ergänzte Haslock murrend und machte so deutlich, was er davon hielt.
Im ersten Moment klang das unglaublich verlockend. Ein Clearing von zehn Jahren bedeutete, sie setzten mich auf ein Alter von acht zurück. Ich konnte wieder zu meiner Familie, dort erneut aufwachsen, ohne zu wissen, was passiert war. Wahrscheinlich würde ich normal leben können, irgendwann studieren, mit Lexie töpfern und mit meinem Vater Gemüse anbauen. Ich hätte mein Leben zurück – oder zumindest irgendein Leben. Angesichts meiner Angst vor dem Tod war es ein Freifahrtschein. Eine Du-kommst-aus-dem-Gefängnis-Karte.
Aber ich konnte sie nicht annehmen. Natürlich wollte ich nicht sterben. Aber ich wollte auch nie wieder ein Werkzeug sein. Erst hatte mich Ferro benutzt, dann Lucien und schließlich Troy. Jeder von ihnen hatte mich manipuliert, für seine Zwecke eingespannt, mich für irgendeine verdammte höhere Sache missbraucht. Und jetzt war ich zerbrochen und kaputt. Wenn ich noch einmal lügen, betrügen und Menschen täuschen musste, würde nichts von mir übrig bleiben. Da starb ich lieber mit dem Wissen, dass ich über das Ende selbst entschieden hatte.
»Nein«, sagte ich leise, ohne hochzusehen.
»Nein?«, echote Phoenix. »Du lehnst ab?« Das hatte er offenbar nicht kommen sehen.
Ich nickte. »Was Sie da von mir verlangen … ich bin dazu nicht in der Lage. In den letzten Monaten habe ich so viel gelogen und betrogen, dass es für ein ganzes Leben reicht – und damit Menschen verletzt, die mir wichtig sind. Ich werde das nicht wieder tun. Ich kann das nicht wieder tun.«
Die Tür ging auf.
»Dabei bist du doch so gut darin«, sagte jemand hinter mir.
2
Mein Blut gefror zu Eis. Mein Körper wurde taub. Als müsste ich mich vor einem Angriff schützen, zog ich den Kopf zwischen die Schultern und starrte auf die Tischplatte vor mir.
So musste ich nicht sehen, wie Lucien in den Raum kam. Musste nicht sehen, ob er seine goldbraunen Locken wie immer zu einem lockeren Zopf eingeschlagen hatte oder mit welchem Ausdruck in den Augen er mich bedachte. Ich wollte nie wieder in diese Augen sehen, ich wollte ihn nie wieder sehen. Den Menschen, der dieses abscheuliche Spiel mit mir getrieben hatte.
»Hast du mit ihm gesprochen?«, fragte Phoenix.
»Ja«, antwortete Lucien. »Er ist nicht begeistert, aber er lässt dir freie Hand.«
Seine Stimme war so vertraut, dass ich mir am liebsten die Ohren zugehalten hätte. Aus dem Augenwinkel erkannte ich das Rot des Pullovers, den er bei unserer ersten Begegnung getragen hatte. Machte er das mit Absicht? Wollte er mich daran erinnern, wie dumm ich gewesen war, auf ihn hereinzufallen? Ich ballte meine Hände zu Fäusten. Die Fesseln schnitten mir in die Haut.
»Gut.« Phoenix wirkte zufrieden – jedenfalls, bis er sich wieder an mich wandte. »Du solltest dir genau überlegen, ob du unser Angebot ablehnst, Ophelia. Sehr genau.«
Lucien stand rechts von mir an der Wand, die Arme verschränkt, und ich spürte seinen Blick auf mir. Ich starrte trotzdem weiterhin auf den Tisch. Konnte das nicht endlich vorbei sein? Konnte man mich nicht endlich erlösen?
»Ich habe es mir genau überlegt«, erwiderte ich matt.
»Sicher?«, bohrte Phoenix nach. »Schließlich hast du doch eine Familie im ehemaligen Königreich, soweit ich weiß.«
Erschrocken sah ich auf. »Meine Familie? Was ist mit ihnen? Was haben Sie mit ihnen gemacht?« Hatte Eneas nicht genau das gefragt, bevor ich abgereist war? Ob ich nicht darüber nachgedacht hätte, was mit ihnen passieren würde, wenn ich in Maraisville scheiterte?
»Noch nichts.« Phoenix dehnte die Worte. »Ob das so bleibt, liegt an dir.«
Mir stockte der Atem. »Sie erpressen mich?« Spielte er wirklich diese Karte aus, diese uralte, völlig zerfledderte Karte? Die Familie zu bedrohen, um jemanden zu etwas zu zwingen, das war so alt wie die Menschheit. Wahrscheinlich, weil es funktioniert.
»Ich will dich nur daran erinnern, dass du nicht allein auf dieser Welt bist. Dass du Verantwortung trägst für alles, was du getan hast, genau wie für die Menschen, die dir nahestehen.« Er sagte nur diese zwei Sätze und schaffte es, dass sich die Schuld in meinem Innern ausbreitete wie Gift.
»Und das zeigen Sie mir, indem Sie meiner Familie Gewalt androhen?«
»Das tun wir nicht«, sagte Imogen Lawson.
»Nein«, pflichtete Phoenix ihr bei. »Wir sind nicht wie deine Revoluzzerfreunde, wir tun anständigen Menschen nichts an. Aber wir müssen uns an die Gesetze halten. Und die besagen im Fall von Hochverrat eine strenge Kontrolle der Familie des Täters, damit nicht weitere Mitglieder zu Verrätern werden. Das bedeutet auch die Einschränkung von Privilegien. Sie müssten zum Beispiel in einen der Orte ziehen, in denen auch Clearthroughs untergebracht werden. Sie müssten spezielle Versorgungsstellen benutzen und regelmäßigen Überprüfungen standhalten. Alles reine Sicherheitsmaßnahmen.«
Meine Familie würde also gebrandmarkt werden, nur weil ich so dumm gewesen war, hierherzukommen. Sie müssten nach Horsham ziehen, dürften keine normalen Supply-Stationen besuchen, würden meinetwegen ausgegrenzt werden. Ich stellte mir Fleur und Lion in dieser grauen, leblosen Stadt vor. Lexie, Eneas und meinen Vater in einem der engen, kleinen Häuser unter ständiger Beobachtung. Diese Aussichten ließen mich unter der Last der Schuld verstummen.
»Auch bestimmte Einrichtungen würden ihnen verschlossen bleiben. Der Besuch einer Hochschule wäre dann schwierig.« Ich hörte, wie sehr Phoenix das genoss, aber ich fühlte keine Wut. Nur Entsetzen.
In seinem letzten Brief hatte Eneas geschrieben, dass er die Zusage von der Kunstakademie in London bekommen hatte. Ich schluckte.
»Junge Menschen sind so furchtbar leicht zu beeinflussen. Wir können nicht riskieren, dass dein Bruder seine Kommilitonen mit königsfeindlichem Gedankengut ansteckt.« Phoenix sah mich mit falschem Bedauern an.
»Mein Bruder hat keine feindlichen Gedanken!«, rief ich nun doch. »Er ist unschuldig!«
»Du wirst verstehen, dass ich auf dein Wort in dieser Sache nicht allzu viel gebe.« Er lächelte schmal. »Aber es ist ganz einfach. Wenn du deinen Fehler korrigierst, hat deine Familie nichts zu befürchten. Wenn du die OmnI zurückbringst, werden sie nie erfahren, was dein Verrat ihnen beinahe angetan hätte.«
Das Atmen fiel mir plötzlich schwer. Meine Kehle zog sich zusammen.
An der Wand regte sich Lucien. »Die Entscheidung zu kooperieren scheint dir ja sehr schwerzufallen«, sagte er und ich hörte ein leichtes Flattern, das seinen Zorn verriet. Mein Ich von vor drei Wochen hätte ihn vermutlich angeschrien – dass ich jedes Recht hatte, wütend zu sein, nicht er. Aber jetzt schwieg ich und starrte wieder den Tisch an. Meine Finger krampften sich um die Befestigung der Fesseln. In meinen Ohren rauschte es. Seine Stimme hörte ich trotzdem. »Fühlst du dich dem Widerstand so sehr verpflichtet, dass du dafür sogar die Zukunft deines Bruders opferst, Ophelia?«
Als er meinen Namen sagte – den er nur selten ausgesprochen hatte, weil er mich immer Stunt-Girl genannt hatte –, sah ich abrupt auf und begegnete seinem Blick. Das erste Mal, seit ich bewusstlos auf dem Boden des Juwels zusammengebrochen war, schauten wir einander in die Augen. Mir blieb die Luft weg.
Die OmnI hatte mir in ihren Enthüllungen einen teilnahmslosen Lucien gezeigt, den mein Schicksal nicht kümmerte und der nur einen Auftrag erledigte. Seine Augen waren matt gewesen und ohne das Feuer, in das ich mich verliebt hatte. Ich hatte erwartet, jetzt genau das zu sehen, diese fremde Version von ihm. Aber es war viel schlimmer. Da war keine Leere, keine Gleichgültigkeit, da war alles. Verletztheit, Abscheu, Verachtung … und Wut. Seine Augen waren hell vor Wut auf mich. Es dauerte nur eine Sekunde, dann sah er weg. Aber es war, als hätte er mich mit einem glühenden Eisen durchbohrt.
»Alles okay?«, fragte mich Imogen. Es klang nicht fürsorglich.
»Die Fesseln schneiden in die Haut«, sagte ich. »Aber es geht schon.« Ich schloss kurz die Augen und holte tief Luft. Dann traf ich eine Entscheidung.
»In Ordnung. Ich werde es tun.« Was hatte ich auch für eine Wahl? Ich konnte meinem Bruder nicht sein Leben wegnehmen. Ich konnte meine Familie nicht dazu verdammen, für meine Fehler zu bezahlen.
Jemand atmete auf, aber ich wusste nicht, wer. Als ich aufsah, wirkte Haslock unzufrieden, Dufort erleichtert, Imogen schien sich bestätigt zu fühlen, während Phoenix keine Miene verzog. Und Lucien … ich hütete mich davor, ihn noch einmal anzusehen.
»In Ordnung.« Phoenix nickte. »Wir werden alles in die Wege leiten und dich dann auf diesen Einsatz vorbereiten. Ich rate dir, keine Tricks zu versuchen, Ophelia. Solltest du auch nur einen Zentimeter vom Plan abweichen, werden wir nicht nur mit dir kurzen Prozess machen.«
Das glaubte ich ihm aufs Wort. Ich richtete den Blick auf die Aufnahmen der Insel.
»Ist Ferro auch dort?«, fragte ich.
»Nein. Ferro ist tot.« Phoenix’ Gesicht zeigte einen Anflug von Zufriedenheit.
»Was? Wie?« Ich merkte, ich war nicht so bestürzt, wie ich erwartet hätte. Nicht einmal überrascht. Samuel Ferro hatte seine eigenen Pläne verfolgt und damit wohl sein Schicksal besiegelt. Mit Maraisville legte man sich nicht an, ohne dafür den Preis zu bezahlen.
»Die Umstände der Elimination unterliegen unserer Geheimhaltung.« Phoenix legte die Hände aneinander. »Aber sein Tod ist der einzige Grund, warum zwei der Anwesenden sich überhaupt noch Schakale nennen dürfen.«
Wider besseres Wissen sah ich Lucien an, aber der schaute zu Boden. Dufort und er hatten also Ferro getötet, um sich zu rehabilitieren? Aber warum? Es hätte für Lucien doch die perfekte Ausstiegschance aus dem Agentenleben sein können. Aber dann fiel mir ein, dass sein Gerede vom verhassten Job und seiner brüderlichen Bürde wie alles andere gelogen gewesen war.
»Also ist Troy nun der Boss?« Das war keinen Deut besser als Ferro. Im Gegenteil.
Phoenix legte den Kopf schief. »Davon gehen wir aus, aber wir wissen es nicht genau. Bisher konnten wir niemanden einschleusen. Troy Rankin kennt ja alle aktiven Agenten und aktuellen Anwärter. Abgesehen davon lässt ReVerse niemanden in seine Reihen, der nicht schon seit Jahren für den Widerstand kämpft.«
»Deswegen also ich«, stellte ich fest.
»Du bist unsere beste Möglichkeit.« Imogen wechselte einen Blick mit Lucien. Man merkte, dass die beiden vertraut miteinander waren. Kein Wunder. Sie mussten sich schon seit seiner Kindheit kennen.
»Wenn ich nach drei Wochen plötzlich in ihrer geheimen Basis auftauche, könnte Troy allerdings misstrauisch werden«, sagte ich. »Woher sollte ich wissen, wo sich die Insel befindet?«
»Wenn dir darauf keine gute Antwort einfällt, haben wir dich wohl überschätzt.« Phoenix musterte mich mitleidig. Ich spürte den Impuls, ihm das Gegenteil zu beweisen, und plötzlich wusste ich, wie es ihm gelang, derart gute Agenten zu erschaffen. Man wollte ihm gefallen – ganz egal, ob er einen quälte. »Aber ich bin sicher, du bist ausreichend motiviert, um Troy zu überzeugen.«
Da ich nicht widersprechen konnte, blieb ich erneut stumm – und damit war das Treffen beendet. Zwei meiner Bewacher kamen herein, lösten meine Fesseln vom Tisch und zogen mich hoch. Niemand verabschiedete mich, also sagte ich auch nichts. Vor der Tür des Raumes blieben wir stehen. Dufort und Phoenix kamen direkt nach mir heraus und befahlen den Gardisten, mit mir zu warten. Dann verschwanden sie, Haslock folgte ihnen kurz darauf. Ich lehnte mich gegen die Wand, dehnte meine verspannten Schultern. Meine Hände waren in den engen Fesseln längst taub.
Da drang etwas an mein Ohr.
»Glaubst du, das ist eine gute Idee?« Imogens Stimme war schwach zu verstehen. Haslock hatte die Tür nicht richtig geschlossen.
»Keine Ahnung«, antwortete Lucien. »Aber es ist die beste Option, also sollten wir es versuchen.«
»Ausgerechnet mit ihr? Du weißt, was sie getan hat und wie sehr er darunter leidet. Wie kann Cohen in Erwägung ziehen, diese Person wieder in die Freiheit zu entlassen?«
Diese Person. Das war ich jetzt also. Aber was meinte sie damit, dass er darunter litt? Etwa Leopold? Hatte sie nicht mitbekommen, dass er das Attentat völlig unbeschadet überstanden hatte?
Ich hörte ein Schnauben. »Es ist kaum Freiheit, wenn man jede Sekunde des Tages überwacht wird. Sie wird nichts versuchen.«
»Das hast du schon einmal gedacht, Luc.«
»Ja, und ich habe dafür bezahlt, oder nicht?«, fragte Lucien und klang aufgebracht. »Wir werden nicht –«
Den Rest hörte ich nicht mehr. Einer meiner Bewacher hatte bemerkt, dass ich lauschte, und ging zur Tür. Aber da kamen Imogen und Lucien bereits heraus. Im hellen Licht des Flures wirkte er völlig anders als noch vor zehn Minuten in dem abgedunkelten Raum. Die Wut hatte sich aus seinem Gesicht verzogen und er sah jetzt erschöpft und blass aus. Mein Magen machte eine schmerzhafte Drehung. Aber bevor ich seinem Blick begegnen konnte, schloss ich die Augen. Erst als Imogen und er weg waren, hob ich wieder den Kopf.
»Komm mit.« Ein Gardist packte mich am Arm.
Ich schluckte den Kloß in meinem Hals herunter und ließ mich mitziehen.
Unser Ziel war ein medizinisches Labor in einem anderen Stockwerk der Festung. Man nahm mir meine Fesseln ab und schnallte mich mit Manschetten an einer Liege fest. Die überprüften sie zweimal, aber ich dachte ohnehin nicht an Flucht. Ich hatte keinen Plan, wusste nicht mal, ob ich einen machen wollte. Das Angebot war okay – mein Leben und die Sicherheit meiner Familie gegen die OmnI. Ich würde Knox durch das Clearing vergessen, aber dafür auch Lucien. Diese Aussicht war beinahe eine Erleichterung.
»Wir werden dir jetzt InterLinks und ein neuronales Implantat einsetzen«, informierte mich die ruhige Stimme des Weißkittels neben der Liege.
»Wozu brauche ich ein Implantat?«, fragte ich. »Nur wegen des InstantClear?« Den Namen hatte ich mir lieber direkt eingeprägt.
»Nebenbei auch das, aber primär gewährleistet es die Verbindung zu dir.« Phoenix trat in mein Blickfeld. »Wegen der Abschirmung der Insel brauchen wir jemanden, der eine Signalbrücke herstellt, über die wir dann auf einer verdeckten Frequenz Zugriff auf den Standort haben – zumindest innerhalb des Radius, in dem du dich bewegst. Das Implantat fungiert als diese Brücke. So können wir dort mithören und -sehen.«
»Sie wissen aber doch, dass normale InterLinks bei mir früher oder später den Geist aufgeben?« Ein Auslösen des Clearing-Serums wollte ich nicht riskieren.
»Natürlich, du hast uns schließlich alles über deinen Gen-Defekt verraten, als du in der Haft um dein HeadLock gebettelt hast. Aber keine Sorge, es ist eine sehr robuste Version. Die Links und das Implantat werden dich schon aushalten.«
»Und mich notfalls ausschalten«, murmelte ich.
»Ja, auch das.«
»Das war Ihre Idee, oder? Dieser ganze Deal?«
»Natürlich«, erwiderte er gelassen. »Ich sagte doch, ich überlasse die Entscheidungen nicht mehr anderen.«
»Man muss Sie ja sehr enttäuscht haben.«
»Enttäuscht? Enttäuscht ist man von einem Kind, das mit einer schlechten Zensur nach Hause kommt. Ich bin außer mir vor Wut.« Phoenix beugte sich über mich, und sein Blick war so bohrend, dass ich die Luft anhielt. »Ich toleriere keine Fehler bei meinen Leuten, aber der schlimmste Fehler von allen ist Schwäche. Eine Schwäche meines ganzen Teams, für die du verantwortlich bist, Ophelia. Ich habe keine Ahnung, wie du das geschafft hast, wo doch dein optimiertes Gehirn dein einziger Trumpf ist. Aber ich werde es schon noch herausfinden. Und wenn nicht … nun, dann werde ich deinen Tod keine Sekunde bedauern.« Er trat von der Liege weg und gab dem Weißkittel einen Wink. »Fangen Sie an.«
3
Zwei Stunden später kam ich mir vor wie ein Android. Jahrelang hatte ich mich danach gesehnt, wieder ein Leben mit InterLinks zu führen, aber jetzt fühlten sie sich an wie Fremdkörper. Das Neuroimplantat saß an der Schläfe, verborgen unter meiner Haut, verdeckt durch den Haaransatz. Die EyeLinks hatte man wie in früheren Zeiten auf die Netzhaut gedampft, meine EarLinks waren hinter den Ohren eingesetzt worden. Sie wurden kalibriert, Testsequenzen flackerten auf und verschwanden wieder, unzählige Buchstaben, Töne und Bilder. Als ich kurz davor war, mich zu übergeben, hörte es auf.
Phoenix gab den Befehl, mich loszuschnallen. Ich richtete mich auf und rieb meine Handgelenke. Mir war schwindelig.
»Du hast einen neuen WrInk, den man in den Oberarm eingesetzt hat statt in dein Handgelenk.« Phoenix deutete auf die Stelle. »Er ist durch gängige Systeme nicht aufspürbar und kommuniziert anders als gewöhnliche WrInks, nicht mit normalen Geräten, sondern nur mit deinem Implantat. Darüber können wir alles sehen, was du siehst, und alles hören, was du hörst. Wir überwachen deine Vitalwerte wie Puls, Blutdruck und Stresspegel. Und denk gar nicht erst daran, den WrInk hacken zu wollen. Das System ist gegen Manipulationen geschützt und löst in einem solchen Fall das InstantClear aus.«
Ich ahnte, dass ein Teil von ihm bloß auf diesen Moment wartete.
»Wir werden mit dir nur im Notfall über Audio kommunizieren«, sprach Phoenix weiter. »Die meisten Ansagen bekommst du über die EyeLinks. Niemand darf merken, dass du welche trägst, deswegen musst du deine Augen unter Kontrolle halten und darfst nur mit uns sprechen, wenn du allein bist. Wir werden die Kommunikation auf ein Mindestmaß beschränken, sollten andere Menschen in deiner Nähe sein, aber wir können sie nicht vermeiden.« Er verschränkte die Arme. »Alles kommt auf dein Verhalten an, du musst so sein, wie diese Leute es von dir erwarten. Sie dürfen keinen Zweifel daran haben, dass du ReVerse gegenüber absolut loyal bist.«
Ich schnaubte. Er musterte mich.
»Deine Familie wird kaum erfreut sein, dass du diesen Auftrag so wenig ernst nimmst.«
»Ich nehme ihn ernst«, sagte ich. »Aber niemand ist so perfekt, dass er das alles auf einmal hinbekommt.«
»Ein Schakal hat so perfekt zu sein«, antwortete Phoenix ungerührt. »Außerdem wollen wir nicht vergessen, dass dir ein solcher Auftritt bereits gelungen ist.«
Ich hob eine Augenbraue. »Ein Auftritt vor Menschen, die von Anfang an wussten, wer ich bin und was mein Plan ist.«
»Ach ja?« Er starrte mich abfällig an. »Ich hatte recht: Du wirst wirklich gnadenlos überschätzt.«
»Was –«
»Genug davon. Du hast jedes Recht verloren, Fragen zu stellen.« Phoenix nahm ein Pad zur Hand. »Deine Verhaftung ist 23 Tage her. Man braucht zu Fuß etwa 14 Tage von Maraisville bis zur Basis von ReVerse. Selbst wenn du behauptest, dich erst einmal irgendwo verkrochen zu haben, bleibt nicht viel Zeit, dich in Position zu bringen.«
Ich wurde nicht gefesselt, als man mich in den nächsten Raum brachte. Stattdessen legte man mir eine Sedativum-Manschette um, die flexibel war und sich um meinen Unterarm festzog. Der Weißkittel, der sie mir anlegte, sprach von einer Sicherheitsvorkehrung und dass ich keine hektischen Bewegungen machen sollte. Ich nickte nur.
Nebenan wartete Raleida Jones, die königliche Stylistin. Sie stand neben einem Tisch, auf dem ein unförmiger Haufen schwarzer Kleidung lag. Ich grüßte Raleida, aber sie hatte nicht mehr als ein nüchternes Nicken für mich übrig.
»Das sind die Sachen, die du an dem Abend getragen hast, als …« Sie ließ das Ende des Satzes in der Luft hängen. »Ich habe alles so modifiziert, dass es nach einem zweiwöchigen Marsch durch die Wildnis aussieht.« Sie hielt mir den Haufen hin und deutete auf einen Paravent. Ich nahm die Klamotten und zog mich dahinter um.
Eigentlich war die Einsatzkleidung der Schakale sehr angenehm zu tragen – anschmiegsam und weich, dabei trotzdem robust. Aber jetzt hatte man eine Menge Dreck auf dem Material verteilt und der Stoff war steif und kratzte auf der Haut. Außerdem stanken die Sachen wie Kleidung, die jemand drei Wochen nicht ausgezogen hatte. Als ich wieder hinter dem Paravent hervorkam, war ich nicht nur ein Android. Ich war ein Android, der sich als Penner verkleidet hatte.
Raleida setzte mich auf einen Stuhl und bearbeitete meine Haare. Sie waren auch vorher schon durch die Gefangenschaft verfilzt gewesen, aber nach Raleidas Behandlung sahen sie aus, als hätte ich sie ewig nicht gewaschen. Die hellbraunen Strähnen waren strohig und stumpf, dazu waren kleine Zweige und Schmutz in einen groben Zopf hineingewebt, der wirkte, als hätte ich ihn ohne Spiegel und Kamm geflochten. Meine Kopfhaut juckte unangenehm und ich sehnte mich mehr denn je nach einer Dusche. Trotzdem bedankte ich mich.
Raleida musterte mich kühl. »Viel Erfolg.«
Sie ging und ich wurde in den Raum mit der Liege zurückgebracht. Phoenix wartete bereits dort. Er unterzog mich einer Musterung, dann gab er mir einen kleinen Becher.
»Trink das.«
Ich stellte keine Fragen und gehorchte. Mit einem Schluck kippte ich die dunkelgrüne Flüssigkeit in meinen Rachen.
Sofort bereute ich es. Das Gebräu verätzte meinen Mund und die Speiseröhre, bevor es meinen Magen in Brand steckte. Ich hustete und würgte, jemand drückte mir einen Eimer in die Hand, keine Sekunde zu spät. Es schien Stunden zu dauern, bis das Würgen aufhörte. Die Übelkeit blieb. Erschöpft sank ich auf der Liege zusammen. Phoenix’ Blick wirkte zufrieden. Es schien ihn zu freuen, dass ich mir die Seele aus dem Leib gekotzt hatte.
»Was zur Hölle war das?«, keuchte ich.
»Wenn du zwei Wochen durch den italopäischen Raum geirrt bist, wirst du kaum viel Nahrung oder frisches Wasser gefunden haben.« Er zeigte zum ersten Mal ein echtes und sehr beängstigendes Lächeln. »Das Mittel simuliert den Zustand von Unterernährung, Dehydration und der Infektion mit einigen Keimen. Es ist nach meinen Vorgaben entwickelt worden.«
»Herzlichen Glückwunsch«, murmelte ich. Mein Körper meldete Großalarm: Ich fühlte mich krank und schwach, hatte wahnsinnigen Hunger und Durst. Als ich nach dem Glas auf dem Tisch griff, stand Phoenix auf.
»Das würde ich lassen.« Er stellte das Wasser außer Reichweite. »Alles, was du in den nächsten drei Stunden zu dir nimmst, kommt postwendend wieder heraus.«
Großartig. »Hätten sie mich nicht einfach umbringen können?«, stieß ich hervor. Das wäre vermutlich weniger ekelhaft gewesen. Und schneller vorbei.
Er sah mich an, die Augen kalt wie Stahl. »Sei lieber vorsichtig mit deinen Wünschen, Ophelia. Du weißt nie, ob sie nicht doch noch in Erfüllung gehen.«
Für einige Stunden brachte man mich zurück in meine Zelle, wo sich die Minuten dehnten und meine Gedanken um die Frage kreisten, ob ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Es war, als würde sich alles wiederholen: Erneut musste ich in ein unbekanntes Terrain eindringen und den Menschen dort vormachen, ich wäre eine von ihnen. Schon wieder musste ich taktieren, lügen und auf der Hut sein. Und es war egal, ob ich die Kraft dafür hatte. Ich musste es tun.
Dufort trat an die Scheibe meiner Zelle. »Es geht los.«
Ich stand auf und ging zur Türöffnung. Da ich immer noch die Sedativum-Manschette trug, gab es keine Fesseln, als ich Dufort zum Ausgang folgte.
Vor den Toren des Gefängnisgebäudes röhrten die Aggregate einer FlightUnit. Dufort begleitete mich, als ich einstieg. Außer uns waren zwei Soldaten an Bord, die mich jedoch nicht beachteten. Ich setzte mich auf einen der hinteren Plätze und schnallte mich an. Dufort ließ sich mir gegenüber nieder, nahm ein Pad hervor und schwieg.
Wir starteten. Durch das Fenster neben meinem Sitz konnte ich Maraisville sehen, das immer kleiner wurde. Ich erkannte die Festung und die Altstadt, meinen Wohnbezirk und den See. Am Hang außerhalb lag das Castello della paura, eine alte Burgruine mit einer tragischen Vergangenheit – vor allem für mich. Als wir darüber hinwegflogen, versetzte es meinem leeren Magen einen Stich.
»Bekomme ich kein Briefing?«, fragte ich, als wir bereits eine halbe Stunde geflogen waren. Dufort sah von seinem Pad auf.
»Warum sollte ich dich briefen? Du kennst ReVerse besser als ich. Außerdem halten wir ständigen Kontakt zu dir.« Er vertiefte sich erneut in seine Lektüre.
Ein Teil von mir wollte etwas sagen, sich bei ihm entschuldigen, weil er meinetwegen degradiert worden war. Es tat mir leid, dass meine Tat ihn zu Phoenix’ Fußabtreter gemacht hatte. Aber Dufort war es auch gewesen, der alles ins Rollen gebracht hatte – meine Rekrutierung und die Sache mit Lucien. Also sagte ich nichts.
Wir flogen Richtung Süden und ich sah hinunter zu den Dörfern und Landschaften, die an mir vorbeihuschten, dem dunklen Teppich der Wälder, den sandigen Feldern dazwischen und schließlich einer Hügelkette. Als wir uns dem Meer näherten, zog Dufort einen silbernen Gegenstand hervor. Es war die kleinere Version eines SubDerm-Injektors. Er drehte ihn in der Hand.
»Das wird dich die nächsten Tage über Wasser halten«, sagte Dufort. »Es sind fünf Einzeldosen. Versteck es irgendwo am Körper, wo man es bei einer Durchsuchung nicht findet. Du hast keine Ahnung, ob man dir von der ersten Sekunde an vertrauen wird.« Er sah mich an. »Wir werden dir einen neuen Injektor zukommen lassen, wenn es sicher ist. Wir deponieren ihn auf dem Festland, dann kannst du ihn unter einem Vorwand abholen.«
Ich schob den kleinen Zylinder mit dem Serum, das mein übersensibles Gehirn in Schach hielt, in eine versteckte Tasche an der Innenseite meines Oberarms. »Troy weiß von dem Medikament und seiner Wirkung. Wie soll ich ihm weismachen, ich hätte drei Wochen ohne Dosis überlebt?«
»Dafür bin ich nicht zuständig, Ophelia. Das ist dein Problem.« Dufort wich meinem Blick aus. Ich holte Luft.
»Hör zu –«
»Nein«, sagte er schnell. »Ich will kein Wort darüber hören. Du und ich, wir haben beide Fehler gemacht, die wir für den Rest unseres Lebens bereuen sollten. Aber das ist auch alles, was wir gemeinsam haben.«
Obwohl ich fand, dass er daran selbst die Schuld trug, fühlte ich mich schlecht. »Das alles hätte anders laufen können, wenn weniger Lügen im Spiel gewesen wären.« Ich sah ihn an.
»Ja, vielleicht«, gab er zurück. »Aber das werden wir wohl nie erfahren.« Dann wandte er sich ab und sah hinaus, bis die FlightUnit landete. »Wir sind da.«
Durch das Fenster sah ich ein Stück sandiges Land, dahinter etwas Wald. Ich schnallte mich los und Dufort nahm mir die Manschette ab. »Du bist einen Tagesmarsch von der Insel entfernt. Wir halten Kontakt mit dir und instruieren dich, in welche Richtung du gehen musst. In fünf Stunden wird es dunkel, bis dahin solltest du dir einen Schlafplatz gesucht haben. Das Gebiet ist unbewohnt, aber trotzdem halten sich eventuell Menschen dort auf. Sei wachsam.«
Meine EyeLinks kalibrierten sich erneut und passten sich der neuen Position an. In einem Feld an der Seite wurde FUNKTIONSTEST 12-14angezeigt. Dann folgten einige Bilder und Buchstaben ohne Sinn, schließlich verschwand beides. Zurück blieb nur eine Richtungsangabe, die mir sagte, wohin ich gehen musste.
Dufort horchte auf etwas in seinen EarLinks. »Der Test ist abgeschlossen, du kannst dich auf den Weg machen. Denk daran, dein einziges Ziel ist die OmnI. Finde sie und bring sie zurück. Völlig egal, was es kostet.« Die Zugangsrampe der FlightUnit wurde heruntergelassen und Dufort ging mit mir hinaus. Der Boden unter unseren Füßen bestand aus sandigem Lehm, die Fläche war mit bodendeckendem Grün und brusthohen Sträuchern übersät. Es roch schwach nach Meer.
»Bist du bereit?«, fragte mich Dufort. Es erinnerte mich an den Einsatz in der Villa Mare, an eine Zeit, in der noch alles in Ordnung gewesen war.
»Nein«, sagte ich ehrlich.
Zum ersten Mal seit meiner Verhaftung erkannte ich in Duforts Gesicht meinen ehemaligen Ausbilder wieder. »Ich bin sicher, du bekommst das hin.« Er nickte mir zu. »Pass auf dich auf.«
»Du auch«, sagte ich und meinte es ehrlich. Dann atmete ich tief ein, drehte mich um und marschierte los.
Es war ein schöner, sonniger Tag. Jeder andere hätte das warme Wetter sicher genossen, das Zwitschern der Vögel und das entfernte Rauschen des Meeres. Aber für mich war es grässlich. Nach der langen Zeit ohne Tageslicht und irgendwelchem Kontakt zur Außenwelt war die Sonne zu grell, das Meer zu laut, und den verdammten Vögeln hätte ich am liebsten den Schnabel zugehalten. Außerdem fühlte sich meine Kleidung an, als wäre sie aus Schmirgelpapier, und mein Hunger brachte mich fast um. In der FlightUnit hatte ich noch etwas Wasser zu mir genommen, aber mein Körper quälte mich trotzdem mit Schwindel und Schwäche als Folgen des Phoenix-Gebräus. Zum Glück floss durch das Gebiet ein kleiner Fluss. Als ich ihn erreichte, trank ich gierig und hielt dann mein Gesicht in das kühle Wasser. Wäre ich allein gewesen, hätte ich mich bis zum nächsten Morgen nicht mehr geregt.
Allerdings war ich nicht allein. In meinem Kopf gab es nun ein Implantat, das eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung durch Maraisville ermöglichte. Ich wusste nicht, wer mir die Befehle gab, die in unregelmäßigen Abständen vor meinen Augen auftauchten, aber eines war klar: Er oder sie mochte mich nicht. Ein unbarmherziges Geh sofort weiter, du hast nur noch drei Stunden bis Sonnenuntergang trieb mich wieder auf die Beine. Sehnsüchtig sah ich dem fließenden Wasser hinterher, als ich den Hinweisen der EyeLinks folgte.
Es war ein merkwürdiges Gefühl, hier draußen in Freiheit zu sein und trotzdem keine Privatsphäre zu haben. Ich nutzte die Zeit, um mich wieder an die EyeLinks zu gewöhnen und trainierte unauffällige Augenbewegungen, um nicht erkennen zu lassen, dass ich welche trug. Wenn ich bei ReVerse ankam, musste ich vorbereitet sein, damit sie mich nicht enttarnten.
Die Vegetation wandelte sich von Büschen zu Pinien, der Boden wurde steiniger. Ich ging in gemäßigtem Tempo und hielt die Augen offen. Ab und zu begegnete mir ein Fuchs oder ich sah eine Schlange auf dem Boden, aber sonst war die Gegend verlassen. Ich war froh darüber. Wenn mich jemand in dieser Verfassung sah, würde das nur Fragen aufwerfen und Aufmerksamkeit erregen. Auf keines von beidem war ich scharf.
Als es dämmerte, entdeckte ich einige alte Mauern, die zu einer Ruine gehörten. Sie stand auf einem Hügel mit Blick über das tiefblaue Meer und bot sicher einen guten Schlafplatz. Aber da jedes alte Gemäuer mich entweder an Lucien oder an Leopold erinnerte, ging ich weiter. Kurz darauf fand ich eine Stelle, wo die Bäume dicht an dicht standen und mich ein paar Büsche zusätzlich vor neugierigen Beobachtern versteckten. Dort setzte ich mich auf den Boden und lehnte meinen Rücken an einen Stamm. Eine Nachricht tauchte in meinen EyeLinks auf. Status?
»Ich lebe noch«, sagte ich. »Wie man sieht.« Ich bewegte den Kopf von rechts nach links. Meine EyeLinks blendeten etwas ein: Regenwahrscheinlichkeit für die kommende Nacht: 65 Prozent. Voraussichtliche Temperatur: 13–16 Grad.Ich sah nach oben, aber das Blätterdach kam mir stabil genug vor, um einen Regenguss zu überstehen. Da keine weitere Nachricht folgte, schien Maraisville einverstanden zu sein. Vielleicht war es ihnen aber auch schlicht egal.
Müde schloss ich die Augen und sah, wie in der Ecke ein roter Punkt aufleuchtete und dann verschwand. Wahrscheinlich wurde auf diese Art gemeldet, dass es jetzt nichts Interessantes mehr zu sehen gab.
Ich war bestens ausgerüstet mit Prä-Abkehr-Technik und doch empfand ich keine Freude darüber. Jahrelang hatte ich mir nichts mehr gewünscht, als endlich wieder vollständig zu sein, ausgerüstet mit allen technischen Sinnen. Aber ausgerechnet in den Wochen vor dem Attentat hatte ich mich endlich an den Zustand ohne InterLinks gewöhnt. Jetzt hinterließ das Tragen der Links ein schales Gefühl – als wäre es eine Strafe. Wie hatte Phoenix gesagt? Sei lieber vorsichtig mit deinen Wünschen, Ophelia. Du weißt nie, ob sie nicht doch noch in Erfüllung gehen.
Damit schlief ich ein.
Mitten in der Nacht wachte ich auf, weil es donnerte. Ich öffnete die Augen und wurde geblendet: Blitze zuckten durch die Bäume und tauchten alles in grelles Licht. Eine Minute später wusste ich, dass die Wahl meines Schlafplatzes falsch gewesen war: Hagel schoss vom Himmel und durchschlug die Blätter des Baumes über mir, als sei es nasses Papier. Ich sprang auf, hielt meine Arme schützend über den Kopf und rannte in Richtung der Ruine.
Nach Sekunden war ich völlig durchnässt, der Boden war rutschig und ich glitt immer wieder aus. Regen überspülte die Wege und ich tastete mich im Dunkeln vorwärts, so schnell ich konnte. Es schien trotzdem Stunden zu dauern, bis die alten Gemäuer vor mir auftauchten.
Ich hatte Glück – einer der Räume war nahezu erhalten. Zwar tropfte der Regen durch das morsche Dach, aber es war besser als gar kein Schutz. Irgendetwas quiekte, als ich mir eine Ecke zum Schlafen suchte, aber ich war zu müde, um mich zu ekeln. Unter dem Poltern des Donners und dem Rauschen des Regens rollte ich mich zitternd zusammen und schloss die Augen. Noch bevor der rote Punkt auftauchte, war ich wieder eingeschlafen.
Status?
»Unverändert«, murmelte ich. »Ich bin auf dem Weg nach Süden, meine Umgebung besteht aus Pinien, Sträuchern, Sandboden und Meer.« Sahen die eigentlich zu oder schliefen sie noch?
Es war früher Morgen und die Sonne tat so, als hätte es das nächtliche Gewitter nie gegeben. Meine Haare trockneten allmählich und mein Körper taute auf. Ich hatte mich früh auf den Weg gemacht, nachdem ich von einem Vibrieren meiner EarLinks geweckt worden war. Man hatte mir verschwiegen, dass sie so was konnten. Ich wollte nicht wissen, für welche Funktionen das noch galt.
Als jemand mit mir sprach, zuckte ich zusammen. »Wir haben Aktivität in der Nähe festgestellt.« Ich erkannte Duforts Stimme. »Vielleicht sind es nur ein paar Wanderer, aber wir gehen auf Nummer sicher. Du solltest in Richtung Osten ausweichen, damit dich niemand in die Zange nehmen kann.«
»Okay. Danke.« Ich war froh, dass er mit mir redete. Die sterilen Nachrichten auf den EyeLinks waren gewöhnungsbedürftig, wenn man nicht wusste, wer am anderen Ende war.
Aufmerksam horchte ich auf Schritte oder Stimmen, aber es war nichts zu hören. Trotzdem änderte ich meinen Kurs und ging auf den dichten Pinienhain zu. Ein Fehler, wie sich herausstellte.
»Na, wen haben wir denn da?«, stoppte mich eine schnarrende Stimme.
Ich fuhr herum.
4
Sie waren zu viert. Die Stimme gehörte dem einzigen Mädchen der Gruppe, einer schmalen Brünetten mit kinnlangen Haaren und dunklen Augen, die etwas zu sehr funkelten. Sie stand neben drei Jungs von schlank bis bullig, zwei von ihnen hatten Masken auf. Der einzige, der nicht vermummt war, hatte raspelkurze Haare und helle Augen, die mich abschätzend musterten. Er und die anderen trugen schwarze, abgenutzte Kleidung, funktional und robust. Man hätte denken können, wir wären alle in der gleichen Band.
Meine EyeLinks zeigten mir die Namen der beiden Unmaskierten an. Elodie Norberg, 22 Jahre, und Tatius Renkler, 26. Ein paar Informationen gab es über ihre Herkunft, aber mich interessierte nur die letzte Zeile: Mögliche Verbindung zu Radicals.Ich stöhnte innerlich. Kaum verließ ich Maraisville, lief ich diesen Idioten in die Arme? Das musste ein Scherz sein.
»Kannst du nicht reden?«, fragte das Mädchen abfällig.
»Natürlich kann ich reden«, gab ich zurück. »Ich dachte nur, deine Frage wäre rhetorisch.«
»Was machst du hier?« Das war der Kerl, Tatius.
»Wandern.« Ich sagte es, als wäre das vollkommen klar. An meiner Kleidung waren keine Embleme aus Maraisville, also konnte man mir die Verbindung zu den Schakalen nicht ansehen.
»Genau. In den Klamotten und ohne Gepäck.« Elodie sah mich an, als wäre ich nicht ganz dicht. »Wer bist du? Woher kommst du?«
»Warte einen Moment.« Ich hob die Hand. »Ich muss kurz über den wichtigen Grund nachdenken, warum ich euch das verraten sollte.«
Mach sie nicht wütend, sagten meine EyeLinks. Ich ignorierte den Hinweis. Die waren vielleicht in meinem Kopf, aber deswegen konnten sie mich noch lange nicht steuern.
»Nehmt sie mit«, sagte Tatius zu den beiden Maskierten. »Wir befragen sie später.«
Ich war geschwächt und müde, hatte seit Ewigkeiten nichts gegessen und das Phoenix-Kotz-Gebräu waberte immer noch durch mein Blut. Aber kampflos würde ich mich diesen vier Witzfiguren sicher nicht ergeben und damit riskieren, dass man meine Familie doch noch brandmarkte. Mein Körper spannte sich an, meine Hände ballten sich zu Fäusten. Ich war bereit.
Aber dann fiel mein Blick zu Boden und ich hatte eine bessere Idee. Blitzschnell ging ich in die Hocke, grub meine Finger in den feuchten Sand und schleuderte ihn auf meine Gegner. Dann drehte ich auf dem Absatz um und sprintete los.
Sie waren in der Überzahl, aber es gab nur schmale Wege und die Sträucher standen hier sehr dicht. Wenn ich schnell genug war, konnte ich mich vielleicht vor ihnen verstecken. »Wohin?«, keuchte ich leise. Auf den EyeLinks erschien ein Pfeil, der mich Richtung Meer schickte. Na, danke für die Hilfe. Der Strand war breit und über Hunderte von Metern einsehbar. Genauso gut konnte ich mir eine Zielscheibe auf den Rücken malen.
Ich ignorierte den Tipp und wandte mich nach Süden, rannte schneller. Meine Stiefel trommelten in unregelmäßigem Rhythmus auf den Boden, ich schlängelte mich im Laufen zwischen den Bäumen hindurch. Immer wieder blieb ich mit der Schulter an einem Stamm hängen, die Äste der Büsche brachten mich ins Straucheln. Schwarze Flecken tauchten vor meinen Augen auf, mein Körper schien dreitausend Kilo zu wiegen. Wie weit war ich noch von der ReVerse-Basis entfernt? Konnte ich es bis dorthin schaffen?
Plötzlich brach etwas aus dem Gebüsch neben mir, prallte gegen mich und riss mich zu Boden. Ich landete hart auf der Seite und bekam keine Luft. Trotzdem sprang ich eilig auf die Füße. In meinem Mund schmeckte ich Dreck.
»Schöner Trick, Prinzessin. Aber achte beim nächsten Mal darauf, dass du auch triffst.« Es war das Mädchen, Elodie. Sie stand vor mir, in Kampfhaltung, die schwarzen Augen leuchteten. Dann griff sie an.
Sie kämpfte unkonventionell, aber effektiv. Mit meinem ersten Tritt erwischte ich sie nicht, weil sie sich rasend schnell wegdrehte. Dafür traf sie mich mit der Faust in der Seite. Ich taumelte, fiel auf die Knie, verfluchte meine Verfassung. Eigentlich erkannte ich die Schwachstellen von Elodie und hatte die Manöver im Kopf, um das auszunutzen. Aber mein Körper gehorchte nicht. Schwerfällig kam ich auf die Beine, landete einen Treffer und bekam einen mit doppelter Wucht zurück. Wieder rappelte ich mich auf, versuchte es mit einem Tritt gegen ihre Beine. Sie war schneller. Ihr Ellenbogen traf meine Rippen wie ein Hammer. Ich keuchte und wich nach hinten aus.
»Du weißt, wie das endet, oder?« Sie grinste, als würde ihr das Kämpfen keinerlei Mühe bereiten. »Du solltest besser aufgeben.«
Sie hatte recht. An einem besseren Tag hätte ich sie vielleicht besiegen können, aber heute? Ich zögerte das Unvermeidliche nur hinaus.
Da trat ich auf etwas. Es war ein Ast, so dick wie mein Arm und ebenso lang. Als Elodie erneut zum Angriff überging, schnappte ich ihn und holte aus. Es krachte, als das morsche Holz auf ihrem Brustkorb zersplitterte. Sie schrie auf und ging zu Boden. Ich nutzte die Gelegenheit und rannte davon.
Weit kam ich nicht. Zwar holte ich alles aus meinen Reserven heraus, aber es war nicht genug. Die Schritte, die schon bald hinter mir ertönten, waren schnell und leichtfüßig – von jemandem, der seine Kraft nicht mühsam zusammenkratzen musste. Als mich ein Stoß in den Rücken traf, stürzte ich wie ein gefällter Baum in den Sand.
»Ich hab sie!«, rief Tatius Renkler und drehte mich um. Kurz darauf trafen die drei anderen ein.
»Können wir sie direkt hier kaltmachen?« Elodie starrte mich hasserfüllt an. Sie hielt sich die Rippen, das Gesicht schmerzhaft verzogen.