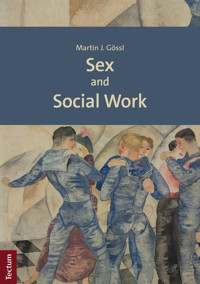Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
opiparus, adj.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fugit irreparabile tempus.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1. Kapitel
Es gibt nur wenige Tage, an denen die pulsierende Weltstadt ohne Anstand und Verpflichtung den beheimateten Menschen ein klein wenig Ruhe zugesteht und die Straßen in einer erträglichen Stille zurücklässt. Der Mythos der nicht schlafenden, nicht ruhenden Metropole, die so wenig aufzuweisen hat und doch so vieles beheimatet, erfindet sich im Getöse des täglichen Aufwachens und Zubettgehens fortwährend, am Tag wie in der Nacht. Das Reizvolle beginnt und endet im Moment. Das scheinbar Reizlose bleibt greifbar und erhält einen Glanz, vielleicht auch, weil gerade dieser Ort mehr ein Zentrum darstellen dürfte als viele andere Plätze dieser Welt. Fernab politischer Zentren entfaltet die Stadt ihre Macht mit dem Gewicht der gelebten Tatsache. Kein amtierender Präsident residiert hier, aber durchaus Monarchen. Keine Parlamente geben hier kräfteraubenden Auseinandersetzungen Platz zur Diskussion, sehr wohl aber werden hier Weltentscheidungen in Plenarsitzungen getroffen. Nicht einmal die weltfinanzielle Entscheidungsgewalt wird dieser Schönheit zugestanden, trotzdem entscheidet sich hier täglich, wer verliert und wer gewinnt.
Die charmante Erfüllung unerwarteten Begehrens und die damit verbundene Nichtenttäuschung lockt vor allem jene Menschen, die diesen Ort und sein Metier erleben möchten. Gütig, in einen Faltenrock der 1920er Jahre gehüllt, ein Glas Champagner in der einen, ein Buch in der anderen Hand, thront die Grand Dame am oberen Rand der Tafel, welche die wichtigsten Städte zu verköstigen weiß. Hellwach, die Impulse der Zeit spürend, die gesamte Welt im Schoß tragend, lächelt sie milde, selbst bei jenen Themen, die Grausames in sich tragen. Nichts kann man ihr anhaben, niemand darf sie vereinnahmen und keiner soll Gnade erwarten. Wie eine gute Gastgeberin weiß sie zu unterhalten, doch ebenso leidenschaftlich Grenzen zu ziehen. Niemals ist sie fair, keinesfalls zuvorkommend und nur selten einer langjährigen Treue verbunden.
Das sich in den Gläserfronten spiegelnde Licht und die als Gegenangriff in Stellung gebrachten Reklamen ergeben eine atemberaubende Szenerie, gleichwohl damit der Exodus einer nächtlichen Dunkelheit zu betrauern ist. In das Gelb der Lichter und das reflektierende Blitzen der Lackspiegelungen mischen sich farbenfrohe Proklamationen, die ihre Wirkung, nämlich eine herausragende Ankündigung verschiedener Kaufoptionen ankündigen zu müssen, nur marginal zur Entfaltung bringen. Hinzu kommen allzu menschliche Auseinandersetzungen, permanent brummende Motorengeräusche und fortwährend summendes Luxusgetöse von kühlenden, heizenden, befeuchtenden oder entfeuchtenden Maschinen für das unverzichtbare Mikroklima in den Arbeits- und Wohnräumen.
Dort, wo ein wenig Glas die Aufgabe einer Barriere zugedacht worden ist, um das Mikroklima vor unerträglichen Temperaturen, Geräuschen und fluoreszierenden Einflüssen zu bewahren, übernehmen Menschen die belebende Wirkung. Stille und damit den drohenden Stillstand gilt es zu vermeiden. Sie sind Vorboten des Untergangs in die Bedeutungslosigkeit. Wegbegleiter in die Stagnation und in direkter Folge die eigentlichen Strafen einer Stadt, die nicht weiß, warum sie jener Sehnsuchtsort geworden ist, der sie nun einmal sein darf.
Wer geht, erlebt, wer steht, vergeht.
Unzählige Mobiltelefone schreien wie technisierte Monsterwesen, die im Falle maximal rücksichtsvoller Zurückhaltung, mit Maulkorb versehen, durch Brummen auf den Tischen auf sich aufmerksam machen. Die obligatorischen Laptops aller Couleurs beleuchten Dutzende Hände und Gesichter; sie verzerren den Menschen, bewerfen ihn mit Licht und erheben, ohne um Erlaubnis zu fragen, Anspruch auf das Äußere und die Aufmerksamkeit. Wer sich in dieser Welt befindet, weiß, sich darzustellen: Intime Gespräche, frisch aufkommende Probleme oder elementare Erlebnisse werden ohne Rücksicht auf die Integrität der eigenen oder gar Respekt gegenüber einer anderen Person mit beeindruckender Impertinenz geführt. Die Parallelität des Gleichen oder die Gleichzeitigkeit desselben führt direkt von den Sinnen in die eigene Wirklichkeit. Was ein Smartphone nicht darstellen kann, wird über statuserhebende Kabelverbindungen auditiv übermittelt.
Wer nicht spricht, ist still, wer nicht hört, bleibt stumm.
Selbst die Darstellung der eigenen Person, gerade wenn sie auf kreischende Unterstützung von außen verzichten muss, kann in der Haltung, ausladender Mimik und im In-sich-Ruhen für andere Raum ergreifen. Stille Lippenbewegungen zu den Lieblingssongs, lachende Gesichtszüge zum Gelesenen oder sinnierende Blicke mit symbolsicherer Schwere machen es möglich.
2. Kapitel
Jakob Einfinger weiß mit zielgerichteter Präzision sich kulturell schnappig, dennoch den Gegebenheiten angepasst, freundlich einen Caffè Latte unmissverständlich distanziert zu beschaffen. Entsprechende Höflichkeiten werden in dieser Stadt leise, nebenbei und der eigentlichen Aufforderung beifügend in schneller und nebensächlicher Weise vorgetragen. Der Wunsch kommt dabei einem Befehl gleich, der bei Nichterfüllung jeglich denkbares Szenario nach sich ziehen könnte.
In einem witzigen Café in der Waverly Street hofft Jakob Einfinger auf ein klein wenig Ruhe, um die Gefühle, vielleicht aber auch nur die innere Unruhe, abschütteln zu können. Nur selten schaffen es diese Stadt und ihre Menschen, sich in sein Gemüt einzunisten. Umso schwerer ist es dann jedoch, diese unliebsamen und fremden Regungen wieder loszuwerden. Ein paar Wollhandschuhe im Sommer als lächerliche Darstellung des eigenen Modeverständnisses, unerzogene Hunde von unfassbarer Hässlichkeit als Hausmittel gegen die emotionale Verwahrlosung im Alter und eine beißende Armut, die sich in Form von Entertainment auf der Straße tarnt, knabbern seit Tagen beständig an der so tiefsitzenden Gelassenheit dieses Mannes. Der ewige Tag und die Atemlosigkeit dieser Stadt wandeln sich in solchen Momenten von einem faltenlosen Kleid zu einer zerschlissenen Kluft.
Bereits beim Eintreten weiß der in morgendliche Stille zurückgezogene Jakob Einfinger um die Chancenlosigkeit seiner erhofften Heilung. Das Café, so wie viele Cafés der aktuellen Zeit, ist mit Stehtischen und Hockern zugepflastert, sodass lediglich ein Gang zum Bestellen für hereinströmende und hoffentlich schnell wieder verschwindende Kunden offensteht. Und ebenso selbstverständlich ist die optimale Nutzung des Raumes ad absurdum geführt, da der zugestandene Platz adäquates Sitzen unmöglich macht, weswegen das Heiligtum einer Wiener Kaffeehaustradition als Gesellschaftsort und Raum meditativer Vertiefung in die Presse und Literatur der Zeit konsequent eine Entweihung erfährt. In dieses Sakrilegs mischen sich in periodischen Intervallen die etwas verzweifelten Ausrufe eines jungen Mannes, der, händeringend die Kaffeemaschine bedienend, frisch fertiggestellte Heißgetränke an die richtige Personen zu bringen verpflichtet ist, dabei aber keineswegs seine eigentliche Berufung, nämlich zur Hintergrundmusik eine Oberstimme zum Besten gebend, vernachlässigen möchte.
Das Ambiente will Gemütlichkeit vermitteln, die Farben erzählen die Geschichte von Mutter Erde und ihrem selbstlosen Bemühen, den Kaffeebohnen das Gedeihen zu ermöglichen, damit sie nun, nach Begleichung eines atemberaubenden Geldbetrages, von jemandem in sich aufgesogen zu werden. Im Gegensatz zu den Bildern einer intakten Welt der Widersprüche, wo schönste Blüten über den Kadavern verendeter Tiere gedeihen, bleiben die inszenierten Gegensätzlichkeiten im künstlichen Gefüge des Kaffeehauses zerstritten: Weder die Menschen im Café noch die mitgebrachten Reste einer zivilisierten Welt scheinen mit dem Konzept harmonieren zu wollen.
Kaum hat man einen Platz im strengen Wettbewerbskampf für sich beansprucht und eingenommen, wird die einsetzende Eingewöhnung in das vorhandene Stimmungsbild durch quietschende Begrüßungszeremonien durchbrochen. Neben fehlender Authentizität ist es das maßlose Übertreiben von Emotionen, die der einfache Jakob Einfinger als besonders störend empfindet. Die Notwendigkeit von Höflichkeitsfloskeln im dankbaren Bewusstsein – sie haben doch schon so einige Abende gerettet – stehen eindeutig außer Zweifel. Doch müssen sie komödiantischstrapazierend eingesetzt werden?
Jakob Einfinger, wenig überrascht, dennoch genervt, widmet sich wieder dem Kaffeegenuss und seiner Onlinezeitung aus Österreich. Dabei steigt in ihm das nostalgische Gefühl der Vergangenheit hoch, denn genau jetzt vermisst er das gedruckte Wort und die damit einhergehende Erinnerung an Graz. Er kann förmlich den Geruch seiner Geburtsstadt wahrnehmen, den Dialekt auf den Straßen hören und das Gefühl – nämlich Zeit haben zu dürfen – spüren. In solchen Momenten fällt es besonders schwer, modern zu sein. Vor allem dann, wenn er anscheinend der Einzige ist, der an Kopfschmerzen leidet, wenn Tage zu früh mit konzentrierten Blicken auf Bildschirmen beginnen. Niemand außer ihm verzwickt die Augenlider, um dem gleißenden Bildschirmleuchten Einhalt zu gebieten.
Der erste Schluck vom Caffè Latte stimmt den sinnierenden Jakob Einfinger versöhnlich. Trotz aller störenden Elemente im energiefressenden Mikroklima dieses nur scheinbar zum Verweilen einladenden Ortes der Gemütlichkeit, muss das Urteil fair bleiben: Der Kaffee ist gut und durchaus in einer Qualität, die sich nicht verstecken muss. Auch nicht vor einer Wiener Kaffeesiedertradition. Ein zweiter Schluck bestätigt das anfängliche Urteil, wobei diesmal viel bewusster der cremige Milchschaum langsam seine wohltuende und beruhigende Wirkung entfaltet. Mögen es die Wärme oder das Koffein sein, das Gemüt wird unmittelbar sanfter und gleichsam wacher.
Die Qualität des Kaffees ist das eine, das Ambiente das andere. „Der Service hingegen schon“, denkt sich Jakob Einfinger mit verträumtem Blick auf die zurückgelassenen Pappbecher am Nachbartisch. „Wann wurde mir eigentlich das letzte Mal ein Kaffee in einer Keramikschale serviert? Direkt an den Tisch serviert? Hierhin, wo ich sitze, in einer echten Tasse?“, grübelt der sich an die Vergangenheit schmiegende Jakob Einfinger im Bewusstsein, keine Antwort auf die Frage zu erhalten oder gar geben zu wollen. Ein plötzlicher Ruck unterbricht das eigene Mitleid. Ein junger Mann, offensichtlich der jüngste im Team des Coffee Shops, drängt sich verhalten, schüchtern und wahrscheinlich für seine Verhältnisse kämpferisch durch die Menge, um die mit braunen Rändern versehenen Cappuccino-Erinnerungen wenig würdevoll in einem Plastikeimer dem reinigenden Prozess der Entsorgung zuzuführen. Eine Träne, direkt unter dem linken Auge, als Tattoo für die Ewigkeit dem Gesicht hinzugefügt, lässt einen zweiten Blick auf diesen Mann mit asiatischem Hintergrund werfen. „Warum? Warum eine Träne, und warum so sichtbar im Antlitz eines Menschen? Was macht dieser junge Mann nur, wenn er in die Ungnade des erbarmungslosen New Yorks fällt? Wer mag dieses Zeichen seiner Identität akzeptieren und wertschätzen, ohne soziale oder gar pathologische Rückschlüsse zu ziehen?“, sinniert Jakob Einfinger, nicht ohne dabei seinen väterlichen Gefühlen, nämlich die Sorge um eine gerechte Zukunft für diesen jungen Mann, Raum für fantasievolle Gedanken zu geben. Und binnen weniger Sekunden und ohne nur ein Wort mit dem Mann gewechselt zu haben, fühlt er sich nahe. Wohlig nahe in scheinbar verwandtschaftlicher Vertrautheit und bereit, ungefragt Ratschläge zu erteilen, zu bevormunden; er will doch nur das Beste. Erneut unterbricht ein äußerer Einfluss die Gedanken; eine kalte Morgenbrise hat sich durch die Undichte der Fensterfront in die Mitte des Raumes gewagt und dabei den Gästen einen Schauer über den Rücken gejagt. Ein Zeichen der Lebendigkeit, dem man sich im Umfeld von Asphalt, Beton und Gittern allzu gern ausliefert. Der Schauer berührt den modebewussten Jakob Einfinger nur marginal; Schichten exquisiter Baumwolle umschmiegen seinen Körper, geben ihm Halt, Sicherheit und Selbstvertrauen.
Die Faszination ist dem Gesicht des wahrscheinlich einzigen Österreichers vor Ort deutlich abzulesen; wahrscheinlich ist er auch der einzige, dem das Treiben eine Beachtung wert ist. Vier Angestellte sorgen für einwandfreien Kaffee, wobei fünf Tische und drei Barbretter sowie zwei Bänke mit je zwei Sitzplätzen im Freien das Territorium befüllen. Trotz des atemberaubenden Verhältnisses zwischen Sesseln, Tischen, Bänken und Servicepersonal darf die direkte Bedienung am Platz als unzweckmäßig verstanden werden. Sie wird nicht einmal angedacht, auch nicht angedeutet. Der Bedientresen dient als Schranke für beinahe alle und markiert mit absoluter Klarheit, dass niemand – nahezu niemand – den angestammten Ort kreativer Brühkunst betreten darf oder zu verlassen in der Lage ist. Lediglich dem jungen Mann mit der schwarzen Träne im Gesicht werden als Trabant der kreativen Fokusgruppe Ausschweifungen für die Reinigung zugestanden.
Jakob Einfinger bleibt gerade in dieser Umwelt urbaner Trends ein Alien mit Tarnkappe. Die vielen Jahre fern eines Heimatbegriffs machen ihn zu einem Anderem, wo auch immer er steht, und doch zu einem assimilierten Teil des Ganzen. Dabei fühlt er sich nicht fremd. Hier, in diesem Manhattan, an jenem Ort, an dem ihm so viele Ecken und Kanten vertraut und freundlich erscheinen, aber dennoch vieles für ewig fremd und fern bleiben wird, hat er sich all die Jahrzehnte eine Faszination für die Menschen erhalten und doch eine Fähigkeit des Dazugehörens entwickelt. Trotz oder gerade wegen dieser Stadt.
Und so ist sich der Kaffeeliebhaber Jakob Einfinger sicher: New York erfindet sich permanent selbst und spart nicht mit Anleihen bei allen Teilen der Welt. Eine hohe Kaffeekultur war nur die logische Konsequenz der letzten Jahre, ihre Interpretation in Form solcher Cafés jedoch eine Kultur für sich. Weder ein Landtmann noch ein Starbucks. Weder Trash noch Chique. Weder Genuss noch Stress.
Eine junge Frau, die ihr leichtes Übergewicht zugunsten ihrer Oberweite zum Einsatz bringt, wodurch sie noch praller erscheint, setzt sich in dieser Sekunde und ohne Vorwarnung oder emphatisches Augenzwinkern an die Seite des ehrwürdigen Jakob Einfingers. Die Heftigkeit der Platzierung lässt nicht nur den Stuhl beinahe zerbersten, sondern auch die Bodenbretter erbeben. Die in Form gepressten weiblichen Rundungen offenbaren ihren wahren Ursprung. Und auch das wundert ihn nicht. Nicht mehr. Ganz offensichtlich hat der cremige Kaffee seine Wirkung vollends entfaltet.
Seine Zeit in der turbulenten Metropole dauert nun schon viel zu lange an; Jahrzehnte sind es und niemals war dies so geplant. Die vielen glücklichen Faktoren im Leben des Jakob Einfinger sorgten jedoch dafür, dass er weder Angst noch Unsicherheit erleben und somit dem Verstreichen von Zeit keine Beachtung schenken musste. Die österreichische Bundesregierung zeichnet sich durch großkoalitionäre Stabilität oder, je nach Deutungsmuster, Stagnation aus, und seine damaligen politischen Verbindungen sind zwar leicht abgekühlt oder pensioniert, aber dennoch greifbar, wenn es die Situation erfordert. Stabilität hat doch ihre Vorteile, gerade für jene, die die Veränderungen meiden sollten und durchaus bei entsprechender Aufmerksamkeit durch Fremdbestimmtheit davon betroffen sein könnten. Genau das ist der Grund, so ist sich der politisch interessierte Jakob Einfinger sicher, warum viele Menschen, egal wo, Veränderungen nicht schätzen würden, und es nur wenige geben kann, die sie sich herbeiwünschen. Da Jakob Einfinger das einer Plakatreklame entsprungene Manageralter der Achtziger schon etwas hinter sich gelassen hat, weiß er, was ein Drängen von unten und ein Ziehen von oben für den sich nach harmonischer Ruhe sehnenden Menschen bedeuten kann. Dem geschuldet gibt es nur noch weniges, das ihn zu beeindrucken vermag, am wenigsten jedoch herausragende Positionen in Politik oder Wirtschaft. So wichtig sich jemand zu erklären vermag, so kompetent er sich auch zu vermarkten gewillt ist, alle leben in der wahnhaften Gier nach Wachstum und im verdammten Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Sie alle umspült die Vergesslichkeit, niemand kann ohne Netzwerk bestehen oder gar Bestand haben. Jeder braucht sein Gegenüber und jeder hat auch eines. Die Frage ist nur: Wie viele, wie gut und wie tragfähig ist das Gegenüber? Zu glauben, ein Netz an sozialen Verbindungen verheimlichen zu können, um eine Wahrheit zu propagieren, die die eigene Kompetenz als etwas darstellt, das die Restlichen dieser Welt überstrahlen könne, ist ebenso lächerlich wie beeindruckend effektiv in der populären Argumentation. Denn nichts lässt sich schneller als ein Produkt von Netzwerken entlarven als eine vorzuweisende Karriereleiten Und andererseits wird nichts so absolut gesehen wie eine Person mit beruflichem Erfolg, die alles anscheinend aus eigener Kraft geschaffen hat. Diese permanente und allgegenwärtige Täuschung des eigenen Schaffens funktioniert, weil sie von vielen als solches gesehen werden möchte. Die eigentliche Wahrheit, nämlich die Wahrhaftigkeit von Zufall, Netzwerken und Glück wäre in ihrer Essenz als Erklärungskonzept geradezu kommunistisch. Vielleicht ein Grund, warum der philosophierende Jakob Einfinger mit dieser Erklärung so gut sein Auskommen gefunden hat. Vielleicht ist es aber auch nur eine Erklärung, die seine eigene Bequemlichkeit erhabener wirken lässt. Sicherlich jedoch entspricht dies seinem elementaren Grundsatz, Anerkennungen nur jenen zu gewähren, die sie sich als Personen verdient haben.
Jakob Einfinger darf – in der besonnenen Klarheit über den Werdegang vieler – seit einigen Jahre als Kulturattaché im Österreichischen Kulturforum in New York nicht nur seine Dienstpflichten erfüllen, sondern sich dabei auch im entsprechenden Maße und dem Alter und Status entsprechend wohlfühlen. Mit einem nicht hinterfragten Diplomatenpass ausgestattet und damit einen durchaus komfortablen Reisemodus genießend, ist der Umstand, sich keiner direkten Leitungsfunktion verpflichtet zu sehen, das eigentliche Fundament seiner Freiheit. Knapp unter dem Radar medialer Aufmerksamkeit fliegend und dabei dem Bundesrechnungshof der Republik Österreich nur als Beamter ohne Verantwortung auskunftspflichtig ist die Verteilung der Funktionen nach dem bestehenden großkoalitionären Ist-Zustand die Chance, Wichtigkeit nicht mit administrativer Enge zu verwechseln. Ein Fehler, dem allzu gern viele jüngere Beamte in der Wahrnehmung ihrer Stellung und Aufgaben unterliegen. Die wahren Vorgesetzten sitzen in Wien und befinden sich dort – wenig überraschend – in den entsprechenden Parteigremien der Sozialistischen Partei, oder, wie man heute angehalten ist zu sagen, der Sozialdemokratischen Partei. Dem Ring entrückt war dem Beamten Jakob Einfinger zeitlebens die Adresse und Telefonnummer eines Gebäudes in der Löwelstraße bekannter als so manche Abteilung im Kulturministerium. Seine regionalen Freiheiten in Manhattan könnten dieser Realität geschuldet nicht größer sein. Doch Freiheiten sind wertlos, wenn sie nicht bewertet werden. Ebenso zufrieden ist Jakob Einfinger mit den monetären Entschädigungen. Dienstrechtliche Kleinigkeiten wie Arbeitszeiten oder Urlaubsanträge, aber auch Reisekosten und entsprechende Vorsorge für die Zukunft sind nicht nur optimal geregelt, sondern im Gegensatz zu vielen prekären Lebenssituationen von New Yorkerinnen und New Yorkern keine einzige sorgenvolle Minute wert. Seine Abhängigkeiten nach Wien verzwirnen sich in subtiler Form, wobei auch hier die Entspannung durch Kontakte das Gemüt Jakob Einfingers geprägt haben. Wer nichts werden, sondern nur nichts verlieren will, hat aktuell im zyklischen Spiel der Politik die besten Karten in der Hand. Niemand verbreitet mehr Angst als jene, die Wünsche hegen und auch bereit sind, sie zu verfolgen. Jakob Einfinger ist ein exzellenter Netzwerker, er umschmeichelt als charismatischer Auslandsmitarbeiter im besten Alter politische wie unpolitische Persönlichkeiten durch den eloquenten Einsatz seines Erfahrungswissen und durch konzilianten Humor im kleinen wie großen Rahmen, die, von wem auch immer, als wichtig und beachtenswert kategorisiert wurden. Schon etwas ergraut und nahezu immer älter als die heimische Diplomatie und Ministerriege kann die amüsante Figur, die er sich über Jahre zurechtgerichtet hat, besonders leichtfüßig und authentisch den Ball des Kultursports über das internationale Weltnetz spielen. Eine Rolle, die er sich auf den Leib geschneidert hat, immer mit dem Bestreben, ein gutes im schlechten Leben führen zu dürfen.
Die Morgennachrichten aus Österreich sind nicht nur bereits einige Stunden alt – zumindest so nach Wiener Zeitrechnung – sondern gleichsam wohlbekannt und erfreulich. Alles bleibt, wie es ist, auch wenn die Unzufriedenheit mit dem Kabinett sowohl die Medien als auch die Oppositionsparteien beschäftigt. Das medial-politische Unwohlsein, das sich im Gemüt des Sozialisten Jakob Einfinger als reine Zufriedenheit widerspiegelt, wird flauer. Eigentlich stimmt es gar nicht; eigentlich spürt Jakob Einfinger keine Regung mehr, wenn die täglichen Nachrichten eintreffen, obgleich er das Lesen stets genossen hat. In der Tat rufen die Schlagzeilen aus seiner Heimat nur mehr marginales Interesse in ihm hervor, die er lediglich aus einem alten Pathos von Pflichtbewusstsein für die österreichische Innenpolitik verfolgt. Mit diesem Pflichtbewusstsein ausgestattet, liest er viele der innenpolitischen Artikel in handhabbarer Schnelligkeit, um eine der wenigen lästigen Pflichten, die er sich selbst auferlegt hat, abzuschütteln. Seine Augen sind dabei nur auf Schlagworte gerichtet, die eine Umwälzung des Systems andeuten könnten oder durch eine treffende Bezeichnung biografisches Interesse hervorrufen. Beides erklärt sich Jakob Einfinger mit profanem modernem Überlebensinstinkt und banaler kindlicher Neugier.
Der Kaffee neigt sich dem Ende zu und die kalte Kaffee-Milch -Mischung hat ihren geschmacklichen Reiz verloren. Der Duft der verbrühten Bohnen ist einwandfrei, allein der Milchgeruch schreckt ab. Erkaltete Milch stinkt. Das tat sie schon immer. Mit dieser Überzeugung ist für Jakob Einfinger der Augenblick gekommen, aus der morgendlichen Einbegleitung aus Licht und Lärm den Sprung in die offene Welt New Yorks zu wagen. Es ist Zeit aufzubrechen und das kleine Chaos des geschlossenen Raumes gegen das große Ganze einzutauschen. Der Morgen wird dabei Vergangenheit und geht längst in den Vormittag über.
3. Kapitel
Das Typische an einer Metropole wie New York ist wohl die permanente Neuerfindung ihrer selbst. Erneuerung bedeutet Veränderung und Bewegung, wobei am Ende gerade in all dem die kleine Hoffnung verborgen liegt, ein wenig Wohlstand für jeden Einzelnen finden zu dürfen.
Jakob Einfinger ist kein typischer New Yorker, ebenso wenig würde er als typischer Wiener durchgehen. Auch wenn viele der Annahme sind, er wäre einer der beiden Idealtypen, muss er doch immer wieder abwinken oder Enttäuschung erwirken, sobald ein Klischee nicht wird und nicht bedient werden will. Vielleicht ist es die zur Schau getragene Selbstverständlichkeit, schon seit seiner Studienzeit entsprechende heimatliche Ministerinnen und Minister bei ihren Vornamen zu nennen, ganz so, als konferierte er regelmäßig und herzlich mit den politischen Größen der Zeit. Möglicherweise ergibt sich aus den geografischen Ungenauigkeiten – Wien, Graz oder New York und die Welt – ein interpretatives Vakuum. Eventuell ist es aber auch der fehlende Akzent oder Dialekt, der so oft Menschen der gehobenen Einkommensschicht urbaner Zentren als Differenzkategorie notwendige Hilfe bietet, um Neuaufstieg, altes Geld und Herkunft abzuleiten. Welche Kategorien auch immer zur Anwendung gekommen sind oder nicht: Sowohl das Spiel mit Namen als auch die Verweigerung prononcierender Attitüden sind bewusste Entscheidungen in den jungen Jahren des Studenten und heutigen Attachés. Nur allzu früh waren Jakob Einfinger die Mechanismen im Spiel um Repräsentation und Macht vertraut. Und ebenso früh hatte er sich dazu entschieden, diese Mechanismen für seine Ziele zu nutzen.
Schon in der Kindheit, behütet von seinen Eltern und schützend flankiert durch die Schar der Großeltern, wurde die politische – vornehmlich sozialistische – Erziehung ein Grundpfeiler des vorgegebenen Denkens. Der häusliche Meinungskanon orientierte sich dabei vor allem an den Positionen des jeweiligen Parteivorsitzenden, wobei der glückliche Zustand, gleichsam ein tiefsitzendes Misstrauen gegenüber allen Gewerbetreibenden, Industriellen und Bauern zu hegen, dauerhaft unterstützend wirkte. Ebenso der Arbeiterbewegung folgend wurde die übergebührhche Aussprache österreichischer Dialekte oder gar der modische Einsatz von Tracht abgelehnt und der Würde des Arbeiterhemds unterworfen. Jede brachliegende Grünfläche wurde im Vorbeifahren als die uns doch allen bekannte Schieflage im nationalen landwirtschaftlichen Fördersystem angeprangert. Jeder Mercedes eines Unternehmers war das unerträgliche Symbol der zur Schau gestellten kapitalistischen Dekadenz. Dass dabei der eigene Großvater leidenschaftlich obsessiv seinen weißen Mercedes nahezu wöchentlich beim Unterstand des Feuerwehrverbandes wusch, imprägnierte und putzte, stand auf einem anderen Blatt; nämlich auf dem roten Blatt der sorgfaltstreuen Arbeiterschaft. Dass jegliche Wiese dankbar als Auslauf für den Hund intensiv genutzt wurde, ohne dabei an die lästigen Überreste tierischer Notwendigkeit zu denken, wurde in den Baumschatten der Aufmerksamkeit gedrängt. Weitreichende Inkonsequenzen weltanschaulicher Couleur waren und sind notwendige Hilfskonstruktionen, um dem roten Glanzlicht eine größtmögliche Schaubühne zu gewähren. Die einzig gültige Regel dabei: Was der Arbeiter besitzt, hat er rechtschaffen erworben, im Schweiße seines Angesichts erarbeitet. Dabei galten als Arbeiter jene, die entweder das Parteibuch besaßen oder aufgrund ihrer Arbeitstätigkeit selbst in den Wirtschaftswunderjahren keinen Aufstieg erfahren konnten.
In dieser klaren Weltperspektive wuchs nun Jakob Einfinger gemeinsam mit seiner Schwester auf. Die Entbehrungen der Jugendjahre waren – auch wenn heutige Geschichtsbücher solche zu berichten wissen – nur gering, der Karrierepfad seiner Familienmitglieder war stetig nach oben gehend und beeindruckend schnell voranschreitend. So gehörten neben Geburtstagen und anderen obligatorischen Zusammenkünften ebenso Feierlichkeiten zu beruflichen Karriereschritten zum liebgewonnenen Programm des Jahreskreislaufes. Es waren die goldenen Zeiten der sechziger und siebziger Jahre, in denen Arbeit und Einkünfte ausreichend vorhanden waren. Zuerst wurde das Rad der Wirtschaft angekurbelt, dann das Rad der politischen Umwälzung. Es folgte die Etablierung einer Ära, die – wie vielen damals nicht ganz bewusst war – später eine Welt verändern sollte. Viele Menschen der damaligen Zeit profitierten entweder von der einen oder von der andern – manche sogar von beiden – Veränderungen. Das wirtschaftliche Wachstum sowie die politische Neuprofilierung konnten im Duett zu einem spürbaren Impuls des eigenen Lebens werden. Die beinahe bäuerlich anmutende Großfamilie Einfinger profitierte von beiden Bereichen. Zuerst in der staatsnahen Industrie, später im politischen Alltag der Kreisky-Regentschaft.
Der mit seinen Gedanken zufriedene Flaneur Jakob Einfinger beschreitet seinen Broadway mit heiterer Laune. Wie so oft fühlt er sich beim Anblick der Gebäude, der Menschen und vor allem der täglichen Szenerie wohl. Der sonnige Herbsttag schmeichelt der vielschichtigen Stadt im gleichen Maße wie sein Tweedsakko ihm selbst: Elegante, verwobene Muster ver- und bedecken das Innere in momentaner Heiterkeit. Der milde sonnige Augenblick ohne Durst, Hunger oder Leid. Dieser Moment kann nur durch einen klassischen Stil von zeitloser Form gewürdigt werden. Und diese Würdigung ist ihm heute ganz sicher gelungen. Ein weißes Hemd kündigt die tiefblaue Strickkrawatte an, die wiederum linear in einer gelben Weste mündet, um dort – mit einer entsprechenden Woge der Eitelkeit – adrett zu entschwinden. Das Tweed ist in einem helleren Braunton gehalten, weswegen die größtenteils verdeckte Weste und das Sakko sich gegenseitig stützen, beinahe schmeicheln. Nichts lässt Druckstellen erkennen, die inszenierten Falten fließen den Körper entlang und geben dem sich bewegenden Menschen eine agile Gestalt. Die dunkelblaue Hose und die braunen Schuhe runden die Gesamterscheinung ab. Lediglich die blau-gelb gestreiften Socken, die an bereits entdeckte Farben – sockelartig als Reminiszenz an die schon in den Höhen hervorgebrachte Farbharmonie – erinnern, verraten, dass die Person unter dem Zwirn durchaus modern denken könnte. Doch wer schenkt heute noch dem Sockel oder gar den Socken Beachtung?
Die in tägliche Verwendung gelangte Kleidung war und ist dem Mann von Welt, und als solcher muss sich doch jeder bezeichnen dürfen, der in dieser Stadt zu leben in der Lage ist, ein Anliegen. Niemand sollte sich ärmer machen, als er ist, außer Armsein ist eine milieuspezifische Tugend. Jeder sollte sich zumindest über den ersten Eindruck hinaus den größtmöglichen Anteil an Chancen offenhalten, will er im viel zu engen Aquarium großstädtischer Buntheit gesehen werden. Mode, und hier ist kein Zweifel angebracht, ist ein solches Werkzeug der eigenen Möglichkeiten. Polo statt T-Shirt und Weste statt Pullover. So einfach scheint es zu gelingen, ist sich Jakob Einfinger sicher; und auch hier ist für ihn kein Zweifel angebracht. Kleidung hat nichts mit viel Geld zu tun und Geld nichts mit guter Kleidung.
„Wie narzisstisch“, maßregelt sich Jakob Einfinger selbst. Doch die Spiegelung in einer Fensterscheibe, die hinter dem Glas die jugendlichen Trends von Morgen zu rahmen verpflichtet ist, hat ihm erneut vor Augen geführt: Heute sieht er nicht nur gut aus, sondern fabelhaft; es sitzt alles perfekt. Etwas Narzissmus darf sein, vor allem, wenn er auf so einer soliden Basis ruhen darf. Selbst die Hose schmeichelt den Beinen – überraschend. Sogar seinen Beinen. Durch das unliebsame Familienerbe, nämlich unkaschierbar dünne Beine, war die Suche nach den richtigen Hosen eine Lebensaufgabe geworden, die ihm jedoch mit zunehmendem Alter besser zu bewältigen gelingt. Denn an so manchen