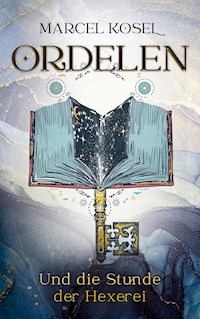
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Leibhaftig auf Erden wandelnde Götter, groß und klein von aller Art, schmieden seit je das Schicksal Ordelens - die Welt am Rande der Schöpfung. Eigentlich wollte Johannes seine verhasste Heimat nur so kurz wie möglich wiedersehen, doch die Irrtümer der Götter und die geheimnisvollen Hexereien der Magister spannen ein Netz, in das ausgerechnet er sich verstrickt. Flüsternde Stimmen in den Tempelruinen, ein grauenhaftes Wesen des Nachts in der Stadt und ein sich finster zusammenbrauender Sturm vor der Küste: Als entflohener Sohn eines Hexenmeisters ahnt nur Johannes den Zusammenhang eines größeren Übels. Nichts wäre ihm lieber, als auf der Stelle umzukehren, doch würde er dann seine neuen Freunde im Stich lassen und einen Fehler wiederholen, der ihn schon sein ganzes Leben lang quält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Domi
Inhaltsverzeichnis
Der Anfang vom Ende
1 – Johannes
2 – Mareike
3 – Johannes
4 – Mareike
5 – Katharina
6 – Mareike
7 – Johannes
8 – Mareike
9 – Torsten
10 – Alexander
11 – Mareike
12 – Elisa
13 – Johannes
14 – Garlef
15 – Johannes
16 – Mareike
17 – Johannes
18 – Theresina
Das Ende vom Anfang
Der Anfang vom Ende
Ordelen, die Welt am Rande der Schöpfung, erlebt ihre letzten Tage. Zermürbende Kriege und üble Machenschaften zeichneten ihre Geschichte, bis endlich die zahllosen Götter, die auf ihr wandeln, das Schlimmste zu verhindern beschlossen. Leibhaftig ziehen sie durch die Welt und sorgen für all die schrecklichen und schönen Dinge, die den Menschen dort widerfahren, sodass die Mystiker Ordelens ständig über ihre Absichten rätseln. Manchmal gelingt es ihnen, die vielfältigen Göttererscheinungen richtig zu deuten, doch noch nie waren die Gelehrten so verstört wie jetzt. Lange brauchen sie, um zu verstehen, was da geschieht im Plan der Götter. Und als sie es endlich begreifen, wenden sie sich vom Krieg im Osten ab, den sie so lange sorgenvoll beobachteten und blicken entsetzt nach Nordwest.
Dort, jenseits der See, liegt ein alter Kontinent, an dessen entlegener Küste das geschundene Land Töwerin liegt. In diesen hintersten Winkel der Welt haben sich düstere Schatten zurückgezogen; in die Wälder, in die Ruinen. Fensterläden und Türen sind bei Nacht verschlossen, denn niemand wagt sich hinaus.
Schwere Nebel verhüllen alte Bäume und unheilvolle Winde rascheln zwischen den Blättern. Man weiß nicht, woher sie wehen, doch sind Stimmen in ihnen, Flüstern. Für die Händler auf den Waldwegen sind sie nicht bestimmt; eilig treiben die Fuhrmänner ihre nervösen Pferde. Bloß nicht hinhören, die Götter dulden keine Zeugen. Ein drängendes Flüstern im Wind, das jene von ihnen ruft, die seit dem ersten Tag den Weltenschlaf verbringen und vor dem Ende Ordelens nicht zu erwachen beabsichtigten. Träge heben sie sich aus dem Schlaf, alte Titanen im Nirgendwo der Welt, und stemmen langsam ihre riesenhaften Leiber empor. Es gibt etwas zu tun, damit das Ende gewährt werden kann und es bleibt kaum noch Zeit.
Die Menschen Töwerins sind einiges Leid gewohnt. Sie wohnen in kleinen Städten hinter dicken Mauern, tragen zerschlissene Kleidung und blicken scheu zu Boden, wenn etwas Ungewöhnliches geschieht. Machtgierige Herzöge wirken finstere Zauber, mit denen sie ihr Volk untertan halten. Töwerinische Hexerei ist einzigartig auf Ordelen und allein der Name verbreitet Entsetzen in der gesamten Welt. Geschichten kursieren von gottloser Finsternis, die den Himmel überzieht, dass es manchen Tags sei wie tiefe Nacht. Sonne und Götter bleiben ausgesperrt, wenn verschwiegene Hexer ihre Pergamente entrollen. Skeptisch sehen sie in alle Richtungen, ob auch kein Gott im Verborgenen lauert, einen Blick auf die geheimen Schriften zu erhaschen.
Magister Ortholt, oberster Zauberkundiger der Stadt Fahlenwalk, befindet diese Nacht als den rechten Augenblick. Es herrscht schwerer Sturm an der Nordküste, wo das Land ans Meer grenzt. Von einer hohen Steilküste aus blicken die äußersten Gebäude der Stadt auf die endlose See. In dieser fernsten Ecke Töwerins haben sich dunkle Wolken am Himmel zusammengetan, die schwere Regenfälle vom Land her gegen die Stadt treiben, während die stürmische See unter den Klippen dagegen hält. Blitzt es vom Himmel, bricht krachend eine Welle. Schlägt der Donner durch die Wolken, schmettern turmhohe Wellen gegen die Steilküste.
Mond und Sterne halten sich verborgen, wie auch die Bürger sich furchtsam in ihren Häusern verkriechen. In dieser rauen Nacht stört niemand den Magister. Niemand würde es wagen, bei solchem Unwetter vor die Tür zu gehen. Und die Leute tun gut daran, denn in dieser Nacht endet ein Leben zwischen den Gebäuden der Stadt.
Schwer trommelt der Regen auf den Arkanistenplatz, um den die größten und schönsten Häuser der Stadt aufragen. Das Wasser fließt in Strömen von den Spitzdächern am Mauerwerk der Gebäude herunter, läuft über Balkone und Reliefs, Erker und Turmfenster. Man weiß, was sich in dieser Nacht ereignet, und hält es für klüger, nichts zu sehen. Kein Licht flackert in den Gebäuden; feige Dunkelheit gähnt in den Fenstern. Niemand achtet auf den durchnässten Magister, der gehetzt an den Häusern vorüberrennt. Etwas läuft nicht nach Plan.
Magister Ortholt hebt den Leuchtkristall und prescht die breite Treppe hinunter, die vom Arkanistenplatz fortführt. Er erreicht die breite Straße des Händlerviertels mit ihren vielen Betrieben und dem abgesetzten Bürgersteig, doch rennt er unbeirrt direkt durch das knöchelhohe Wasser. Nur wenig kann er erkennen im Licht des Kristalls, das den dichten Regen kaum durchdringen kann. Erst, als er das Reckentor am Ende der Straße erreicht, bestätigt sich sein Verdacht. Ein junger Bursche irrt ihm entgegen, die Sachen klatschnass, das Wasser übers Gesicht laufend. Mit blutverschmierten Händen hält er sich die Seite, ehe er erschöpft zu Boden sinkt.
Ihn und vier andere Anwärter auf eine Lehrlingsstelle im Magistrat hatte Ortholt angewiesen, Stellung an fünf ausgewählten Plätzen in der Stadt zu halten, die einen arkanen Rahmen bilden sollten. Dem Burschen hier war das jedenfalls nicht gelungen. Mit einem hölzernen Bannstab in der Hand sollte er eigentlich die ganze Nacht ausharren, keinen Schritt vom Magistramarkt weichen, komme, was da wolle. Ein Wesen sollte eingefangen werden, hatte der Magister erklärt - ein Scharr, eine ganz besonders üble Art unter den Göttern, die für Furcht und Angst sorgt. Die Postierung der Stäbe war entscheidend für die Integrität des Bannrahmens. Doch als der Feigling das Geschöpf erblickt hatte, als es direkt auf ihn zukam, hatte ihn wohl Panik erfasst, sodass er um sein Leben rannte. Es muss ein Wunder gewesen sein, dass er irgendwie entkommen war. Jetzt windet er sich keuchend auf dem kalten Pflaster. Sein Blut vermischt sich mit dem Regenwasser, das am Boden vorüberrinnt.
Magister Ortholt nimmt zornig Notiz vom Versagen des Burschen, entreißt ihm den Bannstab und klettert unwirsch über ihn hinweg durch das Reckentor. Auch seine eigene Kleidung, eine lange Amtsrobe, ist völlig durchnässt und klebt kalt auf der Haut. Seine Haare hängen ihm nass ins Gesicht, während ihm fortwährend Wasser in die Augen läuft. Er muss den Stab sofort am Magistramarkt in Stellung bringen.
Zwielichtige, enge Gassen winden sich zwischen den Gebäuden jenseits der Hauptstraßen, in denen das Wasser bei Regen bis an die Türschwellen reicht und die Erde der ungepflasterten Wege vollkommen aufweicht. Schwer ächzt der Magister, als er in diesem Unwetter die Durenflucht-Gasse entlangstapft. Ein sattes Schmatzen klingt bei jedem Schritt aus dem Schlamm. Trotz seiner hohen Stiefel sinkt er so tief ein, dass ihm das Wasser ins Schuhwerk läuft und seine Füße frieren lässt. Von den Dächern der nahen Gebäude stürzen endlose Wasserströme über seinen Kopf, laufen ihm in den Nacken und kalt den Rücken hinunter. Er flucht, doch muss er weiter.
Bei unterbrochenem Bannrahmen steht dem Zorn des Scharrs nichts mehr im Weg, doch dauert es eine Weile, bis Ortholt den Ernst der Lage begreift. Er hat das Wesen mit dem Bannkreis erzürnt, das war ihm von vornherein klar. Doch irgendwann, nachdem er den Jungen erblickt hatte, war ihm klargeworden, wie kritisch die Situation nun ist. Er hatte einfach nicht damit gerechnet, wie feige dieser Bengel ist. Ortholt kann die zornige Präsenz des Gottes am Ende der Straße förmlich spüren, er sinnt auf Rache. Der Magister ist erleichtert, als er das Holztor am Ende der Durenflucht-Gasse offenstehend vorfindet, durch das man ins Vorviertel gelangt, in dem der Abschaum der Stadt haust. Gepflasterte Straßen gibt es dort gar nirgends, sondern nur enge, gewundene Matschwege zwischen verkommenen, bröckelnden Gebäuden. Der Magistramarkt ist nun zum Greifen nah.
Endlich erreicht er ihn, und dort hinten sieht er schon das Seil liegen, das den Ankerpunkt des Stabes umringt. Dorthin muss er, dann ist es geschafft. Der Zorn über den feigen Bengel vertreibt seine Angst. Wieso auch muss er sich mit solchen Lakaien herumschlagen? Die Häuser ringsum sind dunkel und wirken, als wollten sie mit den Ereignissen der Nacht nichts zu tun haben. Viele Fensterläden haben sich bei dem Unwetter losgerissen und knallen lautstark auf und zu.
Magister Ortholt ist vom langen Lauf völlig erschöpft, ist er doch bereits über fünfzig Jahre alt und solche Anstrengungen nicht gewohnt. Jetzt brennt ihm die Lunge so sehr, dass er sich keuchend auf die Knie stützen muss. Nur noch dort hinüber, gleich. Überall auf dem Markt läuft das Wasser zusammen, über dem ein Blitzschlag donnernd durch den Sturm knallt. Als Ortholt sich keuchend aufrichtet, blickt er in das grimmige Gesicht einer übermannsgroßen Statue. Es ist das Gesicht seiner Großmutter, als sie noch lebte. Sie selbst hatte diese Statue von sich auf dem Magistramarkt aufstellen lassen.
Hinter der Statue schleicht ein hüfthoher Schatten hervor, kaum mehr als schwarzes Wallen in schwarzer Nacht, man kann es fast nicht erkennen. Hatte er es nicht vorhin noch hinter sich gespürt, am vorderen Ende der Durenflucht-Gasse? Wie konnte es ihn überholen? Oder gehört der Scharr zu jenen Göttern, die sich an beliebigen Orten manifestieren können? Magister Ortholt notiert die Möglichkeit mental. Berufsroutine hält seine Gedanken in Ordnung, selbst in Augenblicken wie diesem. Der Scharr wirkt nur in der Nacht so finster, stellt er weiter fest. Er ist bei Tage schon in anderen Farben gesichtet worden.
„Was bist du?“ fragt er das Wesen um Luft ringend. „Und was willst du hier?“ Er schätzt seine Chancen ab, an dem Wesen vorbei zum Ankerpunkt zu gelangen, wo der Stab den Bannkreis erneuern würde. Jetzt, da es zur direkten Konfrontation gekommen ist, spürt Ortholt keine Angst mehr, weder vor dem Scharr noch vor dem Tod, denn er ist ganz in seinem Element. Als Magister der Stadt ist es seine Pflicht, übernatürlichen Vorgängen auf den Grund zu gehen, was sowohl arkane Vorfälle betrifft als auch Einmischungen der Götter wie diesem hier. Lauernd nähert sich das Wesen und zeigt seine blutverschmierten Klauen. Das Blut des Jungen, denkt Ortholt. Sicher ist er längst tot, das wäre nur gerecht.
Um sich vor dem Scharr zu schützen, wünschte Ortholt ein geschriebenes Schema dabei zu haben, eine Zauberschriftrolle. Stattdessen muss er sich nun mit rudimentärer Magie behelfen, um an dem Scharr vorbei zu kommen, die er mit Händen und Gedanken notdürftig zusammenwirken muss. Also schleudert er den Bannstab über das Wesen und zeichnet mit dem Finger komplizierte Muster in die Luft, der Flugbahn des Stabes hinterher. Und just in dem Moment, als der Stab hinter dem Scharr auf das nasse Pflaster scheppert, taucht der Magister an genau dieser Stelle mit einem Zapp aus dem Nichts auf, den Stab wieder in der Hand.
Verstört wirbelt das Geschöpf herum und scheint arg überfordert, da Götter das Konzept töwerinischer Hexerei kaum begreifen können. Rasch legt der Magister die verbleibenden Schritte zurück, doch nur eine Armeslänge von seinem Ziel entfernt reißt ihn ein stechender Schmerz im Bein zu Boden. Ortholt stürzt hart auf das Pflaster, schmeckt Regenwasser und Blut. Von Schmerzen gequält dreht er sich auf den Rücken, um nach dem Stab zu suchen, der ihm aus der Hand gefallen ist, doch springt ihm das Wesen schwer auf die Brust, dass ihm die Luft wegbleibt. Der muffige Gestank nasser Tiere schlägt ihm entgegen, während das knurrende Monster die Zähne fletscht. Aus der Nähe sieht Ortholt, dass es langes, zotteliges Fell hat. Oder nein, es ist kein Fell, es ist… kann das sein? Als er das Fell zu berühren versucht, rammt ihm der Scharr die Zähne in den Hals. Ein letzter, glühender Schmerz vor dem Ende.
„Nanu? Du bist ja gar kein Scharr…“ ist das Letzte, was dem Magister durch den Kopf geht.
1 – Johannes
Die Bürger von Fahlenwalk wurden in den späten Nachtstunden vom Sturm erlöst. Am nächsten Morgen liegt die Stadt friedlich, nass und erschöpft. Überall tropft es noch von den Dächern, als Johannes auf das größte Gebäude am Arkanistenplatz zugeht. Seine Fassaden leuchten im schönen Morgenlicht und die vielen, von munteren Vögeln umflatterten Turmdächer ragen hoch in den Himmel. Zahllose Fenster blicken wachsam über die Stadt, hinter denen er seine Kindheit verbrachte. Johannes ist vom Anblick seines Elternhauses ganz ergriffen. Viele Jahre war er fort, seit er mit fünfzehn Jahren davongelaufen war. In seiner Erinnerung war es ein trostloser Ort. Jetzt, fast zehn Jahre später, schmerzt es ihn zu sehen, dass seine Heimat so schöne Anblicke wie diesen hier zu bieten hat. Er hatte Fahlenwalk viel mehr vermisst, als er sich eingestanden hatte.
Im zarten Morgenlicht, das die nassen Gemäuer zum Funkeln bringt, stehen eine Handvoll schwarz gekleideter Leute traurig beisammen. Sie richten ihre Blicke zu Boden oder schauen einander nur vorsichtig an. Sie wirken verloren; wissen nicht, was werden soll. Der schöne Morgen dringt nicht in ihr bekümmertes Herz, doch einer von ihnen legt dem anderen die Hand auf die Schulter und spricht aufmunternd. Auch von den anderen erhält er Zuspruch. Dann wenden sie sich ab und gehen gemeinsam fort. Zurück bleibt ein einziger, gebrochener Mann.
Johannes erschrickt, als er ihn erkennt. Es ist Richert, der Hausdiener seiner Eltern aus Kindestagen. Warum blickt er so bekümmert? Johannes hat ihn eigentlich als hartherzigen Mann in Erinnerung. Wenn sein Vater Johannes bestrafte, war Richert dienstbeflissen zur Stelle, um auf die penible Einhaltung der Strafe zu achten. Und er wurde oft bestraft! Wenn er beim Essen kleckerte, musste er danach die ganze Küche schrubben. Wenn er in einem Buch eine Seite einriss, musste er das ganze Buch abschreiben. Wenn er etwas Vorlautes sagte, musste er die Nacht durch in der Ecke sitzen und schweigen. Schon die kleinste Verfehlung erregte den Zorn seines Vaters und immer wieder kam Richert, um die Strafe zu überwachen. Sein gestrenger Blick war manchmal schlimmer als die Strafe selbst.
Doch all das ist lange her und heute wirkt Richert ganz und gar nicht mehr streng. Als er Johannes erblickt, wendet er sich ab und geht ins Haus; wohl ohne ihn erkannt zu haben. Johannes zögert hier am Ende seiner weiten Reise. Er trägt praktische Kleidung aus wetterfestem Leder, dazu Stiefel und eine Reisetasche über der Schulter. Seit Monaten ist er nun schon unterwegs, seine Füße schmerzen und er hat Hunger. Aber erst in den letzten Tagen wurde ihm wirklich mulmig im Bauch, wenn er daran dachte, wieder vor seine Eltern zu treten. Als Jugendlicher hatte er sich von ihnen abgewandt, war fortgelaufen. Die Wut in seinem Bauch hatte ihn fortgetrieben.
Gute zehn Jahre ist das nun her. Wie mochten seine Eltern wohl reagieren? Er fasst Mut und klopft an der Tür, in der Richert eben verschwunden ist. Das Kribbeln in seinem Bauch wird stärker, als sie sich tatsächlich einen Spalt breit öffnet.
Richerts Gesicht allein hebt sich aus dem Spalt hervor und blickt ihn an. Er hat rot unterlaufene Augen, die in starkem Kontrast zu seiner aschfahlen Haut stehen. Eine Weile stehen sie so. Richert, der nicht realisieren kann, wer vor ihm steht und Johannes, der nicht weiß, was er sagen soll. Richert ist alt geworden. Viele, dünne Falten, die Johannes nicht kennt. Das Haar in Strähnen grau, aber ordentlich gekämmt. Endlich kommt Leben in Richert, als er den Sohn seines Dienstherrn wiedererkennt. Er schaut perplex und öffnet mechanisch die Tür.
„Kommt doch herein, Herr! Ich hoffe, Ihr hattet eine angenehme Reise“, grüßt Richert automatisch.
Johannes tritt durch die Tür und nickt verkrampft. „Ja, hatte ich“, gibt er knapp zurück. Es ist gelogen.
Durch die hohen Fenster strahlt weiches Morgenlicht in den Raum, das ihn in warme Farben taucht. Lange Gardinen werfen elegante Schatten über den gefliesten Boden. Die große Treppe mit dem wundervoll verzierten Holzgeländer windet sich anmutig in die obere Etage hinauf und verläuft sich in einer Galerie, die rings um den Saal verläuft. Von dort oben hatte er als junger Bursche oft hinuntergesehen, um den eintreffenden Besuch zu beobachten. Anfangs durfte er das noch, aber später bekam er dafür Schelte.
Der große Spiegel ist mit einem seidenen, schwarzen Tuch verdeckt.
Richert reicht ihm einen Arm. „Kommt, ich nehme eure Tasche. Eure Weste auch, Herr!“ Die kleine Routine hilft, das Eis zu brechen. Als er auch seine ledernen Handschuhe auszieht, dreht er sich unauffällig so, dass seine rechte Hand verborgen bleibt. Das Zeichen, das auf seinem Handrücken prangt, würde jetzt nur alles verkomplizieren.
„Es tut mir Leid, dass ich hier so unangemeldet auftauche. Ich hätte einen Brief vorausschicken sollen.“ Er schlüpft auch reflexartig aus seinen Stiefeln, wie früher. Kurzer Besuch behält seine Schuhe an.
Auch Richert realisiert erst durch dieses Detail die Bedeutung der Situation. „Ihr seid zurück“ murmelt er. „Beim Dreifachen, wie viele Jahre ist das her? Wo habt Ihr nur gesteckt?“ In seinem alten Gesicht ringen Gefühle miteinander.
Das ist nicht der Richert, den ich von früher kenne, denkt Johannes. „Ich hoffe, Vater ist überhaupt zu Hause. Früher war er ja oft unterwegs.“
Richerts Blick verfestigt sich und er wirkt sehr gefasst. „Herr, nun, da Ihr zurück seid, gibt es sicher Vieles zu besprechen. Das Meiste wird einen Augenblick warten können, Herr. Aber nicht so das Folgende.“ Er ringt noch einmal um Fassung und setzt mit gebrochener Stimme fort. „Herr, ich bedaure Euch kundtun zu müssen, dass Euer ehrenwerter Vater in dieser Nacht verstorben ist.“ Zügig wendet er sich ab und hängt Johannes Weste an die Garderobe.
Die Nachricht hat eine eigenartige Wirkung auf Johannes. Zunächst ist da der kalte Schock, aber anstatt der Trauer macht sich Erleichterung in Johannes breit, die seine Nervosität vertreibt. Alles ist gut, denkt er. Er redet sich das nicht nur ein. Nein, er empfindet das wirklich. Alles ist jetzt gut. Aber darf man so denken? Ist es richtig, so gar keine Trauer aufkommen zu spüren? Es geht doch immerhin um den eigenen Vater! Sicher, es war keine schöne Kindheit zuletzt, aber davor, all die Jahre? Er hat so viele glückliche Erinnerungen an seinen Vater aus der Zeit vor ihren vielen Konflikten. Früher war er liebevoll, gütig, mit einem milden Lächeln. Er wurde ja erst später so grausam. Dennoch, kann ihn sein Tod so kalt lassen?
„War es ein… ein natürlicher Tod?“
Richert wendet sich um, die Augen glänzend von Tränen, aber auch Zorn funkelt darin. Ein wenig schneidend fährt er Johannes an.
„Nein, war es nicht. Er starb bei dem Versuch, den furchtbaren Scharr zu jagen, der in den letzten Tagen für Unruhe in der Stadt gesorgt hat.“ Mehr sagt er nicht, aber er blickt Johannes so intensiv an, als wäre da noch mehr. Johannes Blick fällt auf das polierte Wappen Fahlenwalks, das an Richerts Kleidung blitzt: Eine Sonne, die im Meer versinkt.
„Und wie kommt Mutter damit klar? Kann ich sie sprechen?“
„Eure… Eure Mutter? Eure Mutter ist verreist.“ Richert scheint irritiert. „Ich dachte, Ihr wüsstet das. Kommt, ich mache Euch einen Tee!“
Im Salon setzt sich Johannes in einen der großen Sessel und blickt auf die herablassend blickenden Gesichter in den Gemälden ringsum. Im großen Lehnstuhl dort, der mit der hohen Polsterlehne, pflegte sein Vater immer zu sitzen. An den vielen Abenden mit hochrangigen Gästen Fahlenwalks wurden hier bei Wein und Pfeife die aktuellen Tagesthemen diskutiert.
Johannes trinkt seinen Tee umständlich mit links, die rechte Hand verborgen unter dem Tisch auf dem Schoß. Wortlos schaut Richert an ihm auf und ab, dann geht er, um Helga zu holen, die Hauswirtin. Auch sie kennt Johannes bereits seit Kindestagen. Als sie mit Richert in den Salon kommt und Johannes erblickt, atmet sie laut ein und umklammert vor Schreck das Amulett, das sie um den Hals trägt. Johannes ist erleichtert, zu sehen, dass sie sich fast gar nicht verändert hat. Zwar ist sie nicht mehr ganz so dick wie früher, aber sie trägt noch immer ihren Dutt und eine Schürze. Ihr Amulett war Johannes in seiner Kindheit kaum aufgefallen. Heute aber weiß er, dass es das Emblem des dreifach gekrönten Gottes aus dem Westen ist. Und er erkennt außerdem, dass Helga selbst aus dieser Gegend stammt, denn sie hat das typische, fast quadratische Gesicht der Väl, die dort leben und die er selbst auf seinen Reisen kennengelernt hat.
Helga überwindet ihren Schreck und schaut zu Richert. „Beim Dreifachen, Richert, was machen wir denn jetzt? Denk nur an…“ Sie nickt verschwörerisch zur oberen Etage, ohne sich die Mühe zu machen, Johannes irgendetwas zu erklären.
„Helga“, setzt Richert an. „Bereite dem jungen Herrn ein Bad! Der Herr sieht von der Reise erschöpft aus.“ Durch seine eigenwillige Betonung und seinem vielsagenden Blick begreift Helga. „Am besten im oberen Badezimmer“, fügt er hinzu. Artig deutet Helga einen Knicks an, wie früher, wenn Johannes Eltern ihr eine Aufgabe erteilt hatten, und eilt zügig davon.
„Wo ist mein Vater jetzt?“ fragt Johannes etwas zu unbekümmert.
Um Fassung bemüht spricht Richert mit heiserer Stimme. „Er ist hinten im Gästezimmer aufgebahrt. Doktor Rommewind nimmt noch die Untersuchung vor. Er sagt, es dürfe jetzt niemand hinein. Und er bereitet ihn vor auf… naja, auf die Beisetzung. Ich schlage vor, Ihr nehmt zuerst das Bad, das Helga bereitet. Ich werde Euch indes einige Kleider besorgen.“ Verstohlen blickt er an Johannes hinab und auf die schmutzige Reisetasche. „Mit dieser Art Bekleidung könnt Ihr Euch am Todestag Eures Vaters in der Stadt nicht blicken lassen. Es wäre seiner nicht würdig. Auch wenn ich nicht weiß, ob dergleichen für Euch relevant ist.“ Richert reißt sich zusammen, auf weitere Beleidigungen zu verzichten, und verschwindet aus der Tür, während sich Johannes mit hochrotem Kopf ertappt fühlt.
Im Badezimmer schlägt ihm eine warme Dunstwolke entgegen, hinter der die blanken Fliesen an den Wänden glitzern - ein ungeheurer Luxus in dieser Gegend. Aus einem Badezuber, in den Helga heißes Wasser hineinkippt, steigt weißer Dampf empor, der nach starken Badekräutern duftet. Johannes hatte sich in all den Monaten seiner beschwerlichen Reise nur sporadisch an Seen oder im Regen waschen können. Der Gedanke an ein richtiges, heißes Bad bringt ein Leuchten in sein Gesicht, das er auch am Todestag seines Vaters nicht zurückhalten kann.
Nachdem er sich entkleidet hat, ohne auf Helga zu achten, die ihn schon seit Kindestagen nackt gesehen hat, steigt Johannes vorsichtig in den heißen Badezuber. Die Wärme dringt in seine müden Glieder und lockert die verkrampften Muskeln. Die Reise war anstrengend, doch wie sehr, das spürt er erst jetzt. Eine ganze Weile ruht er so, seift sich dann bis in die Haarspitzen ein und taucht ganz unter Wasser. Dort, inmitten wohliger Wärme, ist ihm, als würde er jemanden schmerzhaft seufzen hören, weshalb er rasch wieder auftaucht und sich umsieht. Achso, Helga rückt nur den Beistelltisch neben dem Badezuber zurecht. Das Kratzgeräusch auf den Dielen ist vermutlich im ganzen Haus zu hören.
Als Johannes aus dem Zuber steigt und sich abzutrocknen beginnt, bricht Helga endlich das Schweigen.
„Also, wo hast du… wo habt Ihr all die Jahre gesteckt, Herr? Eure Mutter ist fast verrückt geworden vor Sorge. Sie hat viel gestritten mit Eurem Vater, oh ja. Es war nicht leicht, nachdem Ihr weg wart. Alles hat sich irgendwie verändert, seitdem. Eure Mutter am meisten. Ich schätze, Ihr hättet sie am Ende gar nicht mehr wiedererkannt. Naja, wir alle mussten uns erst daran gewöhnen. Auch für mich war es ja eine Umstellung. Immerhin hatte ich nun weniger Arbeit. Ja, sicher, das ist nun wirklich kein Problem, in dem Sinne. Aber trotzdem! Mir war schon bange, dass mir dann gekündigt wird. Aber es muss ja auch gekocht werden und geputzt und alles.
Eurer Mutter habe ich das alles gesagt. Ich habe gesagt: Herrin, hab‘ ich gesagt, die Arbeit im Hause darf nicht liegenbleiben. Ihr dürft mich nicht fortschicken, Herrin! Aber Eure Mutter hatte ja immer ein gutes Herz gegen mich. Natürlich hat sie mich bleiben lassen. Hat mir sogar noch Komplimente gemacht, wie zufrieden sie mit meiner Arbeit ist. Sie sagt, alles ist immer blitzeblank, wenn ich gewischt habe. Und mein Essen schmeckt ihr auch, das sagte sie, ja!“
Helga fingert nervös an ihrem Anhänger umher und plappert so viel wie in Johannes Erinnerung, was er damals auf Dauer sehr anstrengend fand. Diesbezüglich hat sie sich kein bisschen verändert. Und der Tod ihres Dienstherren scheint sie auch nicht weiter zu bekümmern, was Johannes ein wenig wütend macht, obwohl er selbst ja ähnlich empfindet.
Wieder ein Geräusch, wie ein schmerzliches Stöhnen. Nanu? Hatte er sich das also doch nicht eingebildet? Es kommt von irgendwo aus dem Haus. Helga zuckt zusammen und plappert lautstark unsinniges Zeug.
„Jaja, wie das so ist dieser Tage. Jeder macht, was er kann, nicht wahr? Und so ist es doch gut.“ Warum versucht sie das Geräusch zu verheimlichen? Hier ist noch jemand im Haus, ganz klar. Ein Anflug von Zorn regt sich in Johannes. Wer ist er denn, dass er sich hier an der Nase herumführen lassen muss. Ist er nicht der Sohn seines Vaters, der Helgas Dienstherr war? Was erdreistet sie sich also?
Richert steckt kurz den Kopf zur Tür herein und reicht Johannes einen Stapel neuer Kleider der ihn entgegennimmt, ohne dabei auf seinen rechten Handrücken zu achten. „VERRÄTER“ steht dort in unförmigen Buchstaben eingebrannt ins Fleisch, was Richert natürlich sofort bemerkt und so tut, als sei nichts. Richert nickt Helga zu, dass sie mit hinauskommen möge, ein geheimnistuerisches Verhalten, das Johannes heute wie damals ein Gefühl der Ausgrenzung beschert.
Als er im Bad allein ist, wischt er den großen, beschlagenen Spiegel sauber, um sich davor anzukleiden, doch erschreckt ihn sein eigener Anblick. Als er im Westen lebte, im großen Reich Välas, ging es ihm ziemlich gut. Er hatte vor seiner Abreise einen richtigen, wohligen Bauch. Aber jetzt, während er sich die Rippen abtastet, entsetzt ihn, wie hager er in den letzten Monaten der beschwerlichen Reise geworden ist.
Vor der Tür flüstern Helga und Richert hektisch miteinander, doch versteht Johannes nur einzelne Wortfetzen.
„…am selben Tag… ist doch kein Zufall… lasse mich doch nicht für dumm verkaufen…“
Was meinen die beiden bloß? Am selben Tag? Geht es um ihn? Was ist denn am selben Tag? Meinen sie, dass er am selben Tag zurückkommt, an dem sein Vater gestorben ist? Verdächtigen sie ihn etwa, da irgendwie involviert zu sein? Das ist doch lächerlich! Und überhaupt, wozu diese Geheimniskrämerei? Warum sprechen sie ihn nicht einfach direkt darauf an? Er hasst so etwas! Wenn er nachher mit Doktor Rommewind spricht, wird er erst einmal direkt fragen, woran sein Vater eigentlich gestorben ist.
Die Kleidung, die Richert ihm gebracht hatte, besteht neben sauberen Untersachen allen Ernstes aus einer langen, dunklen Robe, wie sie von der Oberschicht Töwerins getragen wird. Eine Robe! Johannes hatte in Kindestagen noch keine getragen und in der Fremde erst recht nicht. Als er überkopf hineinschlüpft und das lange Ding bis zu seinen Füßen entrollt, kommt sie ihm vor wie ein Frauenkleid und ist außerdem unangenehm schwer. Im Spiegel erblickt er einen stolzen, adeligen Mann aus einer Welt, in der Söhne mit ihren Vätern im Einklang leben. Die Ärmel sind lang. Wenn er die Arme sinken lässt, verdecken sie sogar seinen Handrücken…
Vor dem Bad flüstern die beiden noch immer hektisch miteinander. Johannes platzt der Kragen. Schwungvoll öffnet er die Tür, worauf die beiden erschreckt zusammenfahren.
„Gibt es vielleicht etwas, das ihr mich fragen wollt?“, geht er sie an, doch schweigen sie erschrocken. Johannes zwingt sich zur Ruhe. „Nachher möchte ich noch zum Barbier gehen, Richert. Wo finde ich einen?“
„Ich werde Herrn Jorgensam kommen lassen, den Barbier eures Vaters.“ Richert macht sich sofort auf den Weg und lässt Johannes mit Helga allein zurück, die wenig erfreut blickt. Immerhin ist sie es jetzt, die ihn zum Leichnam seines Vaters begleiten muss.
Auf dem Weg zum hinteren Gästezimmer, in dem sein Vater aufgebahrt sein soll, kommt Johannes am unteren Gästezimmer vorbei, aus dem er eine tiefe Stimme hört und wieder einen schmerzhaften Seufzer.
„Äh…“, bringt Helga hervor, aber ihr fällt wohl nichts ein. Johannes kann nicht anders und öffnet dreist die Tür. Der Geruch von Blut, Schweiß und scharfer Medizin trifft ihn unvorbereitet. In einem der drei Einzelbetten des kleinen Raumes liegt ein Kind, ein Junge, vielleicht zwischen zehn und zwölf Jahre. Ein Mann sitzt bei ihm, der dem Jungen mit einem getränkten Tuch eine offene Wunde unter den seitlichen Rippen betupft.
Der Junge ist blass und hat Schweiß auf der Stirn. Mit geschlossenen Augen versucht er während der Behandlung ruhig zu atmen, doch ein gequälter Seufzer entweicht ihm. Von ihm kommt also das Geräusch! Neben dem Mann auf dem Boden steht eine Ledertasche voller medizinischer Instrumente. Ist das also Doktor Rommewind? Aber wer ist der Junge und was macht er hier? Als der Doktor sich zu Johannes umwendet, zieht der sich rasch zurück.
„Entschuldigen Sie, ich wollte nicht stören“, sagt er nur und schließt die Tür. Wieso haben Helga und Richert den Jungen verschwiegen und was ist überhaupt mit ihm passiert? Er kann sowas nicht leiden, dieses Verschweigen und die Heimlichtuerei! Auffordernd blickt er Helga an.
„Das ist der junge Lukas, Herr. Er, äh… er war bei dem Unfall Eures Vaters zugegen und wurde auch verletzt, irgendwie. Er hatte assistiert, aber wir konnten ihn noch nicht befragen. Ihr habt ja seinen Zustand gesehen, Herr. Wir hoffen, dass er es schafft. Oh, steh uns bei, Herr der drei Kronen. So viel Blut, oh je, oh je.“ Helga umklammert in Gedanken versunken ihr Amulett. „Ich musste alles saubermachen, Herr, aber ich… ich kann Blut nicht so gut riechen. Mir wird dann irgendwie…“ Schon wird sie blass und hält sich die Hand vor den Mund, ehe sie hastig zurück ins Badezimmer läuft. Ihre schnellen, kurzen Schritte knallen laut auf den Dielen. Johannes hört noch ihr Husten und geht genervt mit zurück. Durch die Tür hindurch spricht er lauter.
„Was meinst du damit, es sei ein Unfall gewesen? Was ist denn passiert? Und wobei hat der Junge meinem Vater assistiert? Was ist da vorgefallen in der Nacht?“
Er verlangt eine Antwort, bekommt stattdessen aber nur Helgas Würgen zu hören. Resigniert und ein bisschen angewidert überlässt er sie sich selbst und begibt sich notgedrungen allein zum Leichnam seines Vaters.
Das hintere Gästezimmer; dort, hinter dieser Tür, liegt er also. Der Grund für seine über zehnjährige Abwesenheit.
„An dem Tag, an dem ich wiederkomme, stirbst du, alter Mann!“ So hatte er ihm damals in der Eingangshalle gedroht. Eine Erinnerung, bei der er inzwischen selber Gänsehaut bekommt. Schon damals hatte er die Worte bereut, um der guten, früheren Jahre willen. Aber als es ausgesprochen war, gab es kein Zurück mehr. Johannes Finger war fest auf seinen Vater gerichtet, der von der Treppe auf ihn herabblickte, mit so zornigem Gesicht, dass man glauben musste, er würde die Arme ausbreiten und als Flugschatten auf seinen Sohn herniederstürzen. Dieser hasserfüllte Blick ging ihm seither nicht wieder aus dem Kopf. Das Bild begleitete ihn auf der Reise in den Westen bei Tag und auch noch des Nachts in seinen Träumen. Es war auch da, wenn er aufwachte; zehn Jahre lang war es da.
Aber als Johannes an den Sarg tritt, und das Gesicht seines Vaters erblickt, trifft ihn der Schock. Sein Vater, dieses grausame Schreckgespenst, das er zuletzt war, sieht ganz und gar nicht mehr schrecklich aus. Sein Gesicht ist ganz friedlich, als sei er durch den Tod mit sich selbst und der Welt versöhnt worden. Darf das geschehen, denkt Johannes? Darf man am Ende eines Lebens, in dem man andere gequält hat, einfach so in einen friedvollen Tod übergehen? Gibt es keine Strafe, keine Abrechnung? Es ist unglaublich. Sein Vater hat Frieden gefunden, ohne sich mit seinem Sohn auszusprechen. Wer hätte das gedacht… Mit dem beklemmenden Gefühl, um seine Aussprache betrogen worden zu sein, zieht er sich vom Sarg zurück.
In der Tür wartet Richert, der Johannes Beklommenheit wohl für Trauer halten muss, da er mit Tränen in den Augen einfühlsam lächelt. Johannes kann den arroganten Diener von früher in Richert nicht mehr erkennen.
Richert ergreift Johannes Hände. „Es tut mir leid, wenn ich Euch gegenüber etwas abweisend erschien, Herr. Ich dachte fast, das Schicksal Eures guten Vaters sei Euch gleichgültig. Aber nun sehe ich, dass ich mich geirrt habe und wie offenkundig bewegt Ihr seid.“ Für einen Moment verändert sich Richerts Körperhaltung, sodass Johannes glaubt, er wolle ihn gleich umarmen. Vorsorglich verschränkt Johannes die Arme. „Jedenfalls, wenn dies nicht der falsche Moment sein sollte, ich habe Herr Jorgensam gleich mitgebracht, er wartet auf Euch.“
„Mein aufrichtiges Beileid“, murmelt der Barbier, und macht sich geschäftig an Johannes Haaren zu schaffen. Als er schon die Wangen rasiert hatte und Johannes ungepflegter Bart, der ihm auf der Reise gewachsen war, nur noch um Mund und Kinn steht, packt Richert die Überraschung.
„Meine Güte, Ihr seht genau so aus, wie Euer Vater.“
„Den ganzen Bart ab!“, entfährt es Johannes plötzlich. Es schwingt ein bisschen Panik mit, die er nicht vorhergesehen hatte, worauf Richert finster aus dem Fenster blickt.
Als Herr Jorgensam geht, kommt Helga mit einem Besen herein, um die Haare von den Dielen aufzufegen, doch schiebt sie sie nur gedankenlos mit dem Besen vor sich her. Offenbar beschäftigt sie etwas, das sie sich nicht auszusprechen traut.
„Ist irgendwas, Helga?“, fragt Johannes ungeduldig, doch druckst sie schon wieder nur herum, worauf Johannes der Geduldsfaden reißt. „Heraus jetzt mit der Sprache!“
Erschrocken fingert sie an ihrem Anhänger und weicht seinem Blick aus. „Es ist so, Herr. Worüber wir vorhin gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob es so recht klar wurde. Also die Arbeit, Herr. Im Haus, meine ich. Es ist doch immer viel zu tun, oder nicht?“
Johannes versteht nicht worauf sie hinaus will, doch Richert erlöst die beiden und spricht an Helgas statt.
„Herr, Helga möchte wissen, ob Ihr uns zu entlassen gedenkt oder unsere Anstellung fortsetzt, nun da Ihr das Erbe Eures Vaters antretet.“ Aus irgendeinem Grund schwingt ein vorwurfsvoller Ton mit, doch Johannes begreift gar nichts.
„Das Erbe antreten? Wieso sollte ich? Meine Mutter erbt doch alles. Wann ist sie denn von Ihrer Reise zurück?“ Richert und Helga wechseln erstaunte Blicke. Anscheinend dachten sie, der jeweils andere hätte Johannes schon aufgeklärt.
Richert spricht weiter. „Herr, Eure Mutter brach bereits vor über zwei Jahren zu ihrer Reise auf. Sie ist seitdem aber wie vom Erdboden verschluckt. Niemand weiß, was mit ihr geschehen ist. Wir haben natürlich nach ihr suchen lassen, lange Zeit, Herr. Aber es gab nicht die geringste Spur. Es gibt so wenige Zeugen ihrer Reise, dass wir zu der Annahme gekommen sind, dass ihr noch innerhalb des Herzogtums irgendetwas wiederfahren sein muss. Dies ist alles sehr bedauerlich, Herr.“ Nun ist es Richert, den das im Prinzip kalt zu lassen scheint, wohingegen Helga ein paar Tränen aus den geröteten Augen fortblinzeln muss.
Johannes hatte keine Ahnung gehabt; natürlich nicht! Wie könnte er? Er hatte eigentlich geglaubt, mit seinen Eltern Aussprache halten zu können, wenn er zurückkehrt. Aber nun ist sein Vater tot und seine Mutter gilt als vermisst. Endlich macht sich doch so etwas wie Sorge in ihm breit, aber solange nicht klar ist, was mit seiner Mutter geschehen ist, wie könnte er da Trauer empfinden?
„Hatte sie denn gesagt, wohin die Reise gehen sollte?“
Richert schüttelt bedauernd den Kopf. „Das weiß niemand, Herr.“ Helga wirkt überrascht. Sie öffnet den Mund, um etwas zu sagen, entscheidet sich dann aber dagegen. Dann noch einmal: Mund auf, Mund zu. Johannes kann es nicht leiden.
„Nun sprich doch!“, fährt er sie an.
„Es ist nichts!“, ruft sie und hält sich die Hände vor den Mund. Lügnerin. Es war schon immer eine Qual mit ihr und Richert.
Nach einem Seufzer fährt Richert fort. „Nach töwerinischem Recht gilt Eure Mutter als über zwei Jahre vermisste Person als verstorben. Damit seid Ihr rechtmäßiger Erbe des gesamten Vermögens Eures Vaters, seiner Besitzungen, dieses Anwesens und seines Amtes als Magister der Stadt. Ihr seid nun unser neuer Dienstherr, Herr. Auch wenn die formale Erbschaft noch nicht vor Vogt Garlef angenommen wurde. Dennoch wäre es für Helga… und mich… wesentlich zu wissen, ob Ihr unsere Anstellung fortzusetzen gedenkt.“
Johannes ist geschockt. Er wollte nur ein paar Wochen bleiben, allerhöchstens. Und jetzt plötzlich zerrt ihn das Schicksal am Kragen empor und schmeißt ihn in die toten Fußstapfen seines Vaters? Ein irres Lachen entfährt ihm bei dem Gedanken, das Amt des Magisters zu erben und in der Stadt herumzustolzieren wie sein Vater.
„Ihr denkt doch nicht, dass ich so blöd bin, dieses Erbe anzunehmen?!“
Richerts Miene versteinert und Helga sieht aus, als würde ihr alles aus dem Gesicht fallen. Natürlich, es sind ihre Arbeitsstellen; vielleicht war er etwas zu vorlaut. Er hätte es freundlicher sagen können, ja wirklich.
„Tut mir leid, wirklich“, bringt er an Helga gewandt heraus, die aufrichtig um ihre Anstellung besorgt scheint.
Es stimmt wohl, wer würde schon die Haushälterin des ehemaligen Magisters einstellen? Wer würde ihr in seinem Haus über den Weg trauen? Kann Johannes sie einfach so in den finanziellen Abgrund stürzen? Außerdem ist der Dienst für dieses Haus ihr Leben. Er war schon einmal in einer Situation wie jetzt und musste eine Entscheidung treffen, die das Schicksal anderer Menschen bestimmt hatte. Unwillkürlich streicht er über seinen Handrücken. VERRÄTER.
„Ich muss darüber nachdenken.“ Eilig verlässt er den Salon, um der Situation zu entkommen, schlüpft in seine Stiefel und verlässt das Haus. Zwar ist er vom endlosen Wandern auf seiner langen Reise bereits völlig erschöpft – seine Beine fühlen sich an wie Blei und er krümmt sich fast vor Hungerschmerzen - aber er kann jetzt nicht in diesem Haus bleiben.
Ziellos läuft er über den Arkanistenplatz zur breiten Treppe, die zum Händlerviertel führt. Ein Gardist mit eisenbeschlagenem Holzknüppel patrouilliert dort und grüßt untertänig, als er Johannes in seiner elitären Robe sieht.
„Herr“, sagt er und nickt so, wie früher Johannes Vater gegrüßt wurde.
„Ich bin nicht dein Herr!“, schreit Johannes ihn an und stampft aufgebracht davon. Die Robe wallt bei seinem festen Schritt und seine Aura strahlt bedrohlich. Jedem, dem er begegnet, wird klar: Hier geht der stolze Erbe töwerinischen Adels.
2 – Mareike
Im großen Wald von Fahlenwalk liegt eine alte, verlassene Tempelruine. Halb in einen Hügel gebaut, erstrecken sich Türme und Mauern bis ins Blätterdach. Sie sind aus glatten, gemauerten Steinen, an denen Moos und Ranken im Sonnenlicht ruhen. Zahllose Fenster blicken aus den vielen Etagen herab. Es sind träumende Fenster, da es keine Räume mehr hinter ihnen gibt. Der größte Teil des Tempels ist längst eingestürzt.
Inmitten dieser Gemäuer sitzt friedlich eine junge Frau auf einer steinernen Bank. Mareike liebt diesen Tempel, in dem sie sich behaglich und gut aufgehoben fühlt. Ihre zarten Hände flechten biegsame Ranenzweige zu einem eleganten Korb, während sie gelassen vor sich hinträumt und die Zeit vergisst. Auf ihren Lippen schwingt ein Lied, das sie unendlich leise vor sich hinsingt, doch kann sie sich nicht erinnern, wer es ihr beigebracht hat. Seine Strophen entstammen einer fremden Sprache, die sie noch nie gehört hat und trotzdem fließend dahinsingen kann. Vielleicht ist es eine vergessene Sprache; vielleicht ist es ein Wiederhall dieses Tempels, der in ihr erklingt, wie die Saiten einer Laute.
Der Tempel ist ein magischer Ort, ihr Lieblingsort. Einige Tage ist die stürmische Nacht nun her, in der der Magister so schrecklich umkam, sodass der Boden des Waldes zu nass war, um den Tempel zu besuchen. Doch nun endlich kann Mareike wieder friedlich zwischen den Ruinen träumen.
Nach einiger Zeit geht sie zur „Goldenen Tür“, wie sie sie nennt, die an der Rückseite des Tempels liegt, direkt in den Hang des Hügels gemauert. Zwar ist sie aus Stein, doch die metallenen Verzierungen schimmern im Sonnenlicht als wären sie aus Gold. Sachte legt sie Hände und Stirn an die Tür, schließt die Augen und lauscht der flüsternden Stimme im Innern.
„Sie haben euch gebunden und eure Zeit verlängert, doch nicht gegen meinen Willen. Alles, was sie taten, geschah nach meinem festen Willen.“ Die Stimme ist flüsternd und fern, zärtlich aber bestimmend. Sie muss den Atem anhalten, um sie zu hören, so weit weg scheint sie, und wenn Mareike auch die Worte versteht, so begreift sie ihren Sinn nicht.
„Ich komme bald wieder“, flüstert sie.
Das laute Knacken eines Zweiges, das jemandes Anwesenheit verrät, lässt sie herumwirbeln. Wer geht denn da? Am liebsten möchte sie sich verbergen, doch sie zwingt sich, nicht von der Stelle zu weichen. Dies ist ihr Tempel, ihre Ruine, die sie selbst entdeckt hat und seither so oft wie möglich besucht. Niemand sonst hat sich in all den Jahren hier gezeigt und das soll auch so bleiben.
Beherrscht, aber mit pochendem Herzen, wühlt sie in ihrer Tasche. Sie sammelt Kräuter für Ihren Meister rings um Fahlenwalk, doch schickt er sie natürlich nicht vollkommen schutzlos fort; erst recht nicht, wenn ein Scharr umgeht. Töwerinische Wälder sind gefährlich, wenn man sich nicht gerade nahe der Städte aufhält, so wie hier. Trotzdem, für den Fall der Fälle hat ihr Meister ihr etwas mitgegeben. Ein Wurfpäckchen mit Rastanborken-Pulver. Wer es einatmet, erleidet heftige Muskelkrämpfe und Atemnot, die bis zum Erstickungstod führen können.
Langsamen, aber würdevollen Schrittes umkreist sie die Quelle des Geräuschs, obwohl ihr Herz wie verrückt vor Angst schlägt. Da geht jemand zwischen den Säulen der Ruine, nur wenige Meter von ihr entfernt. Kein Scharr… aber ein junger Mann!
Der Eindringling trägt eine nach töwerinischem Adel geschnittene Robe, sodass sie erst glauben mag, es handele sich um eine Obrigkeit, doch entgeht ihr nicht, dass auf seiner rechten Hand ein Wort prangt, das Mareike überall erkennen würde, auch wenn andere es übersehen mochten. „VERRÄTER“ steht dort, das einzige Wort, das Mareike zu lesen gelernt hat. Im Südwesten, an der Grenze nach Brebaaron, wo sie aufgewachsen ist, kamen oft heruntergekommene Brebaar mit diesem Brandmal nach Töwerin. Es sind Halunken und Räuber, Banditen und Mörder, die von den primitiven Stämmen ihrer Heimat verstoßen wurden. Wie ist es möglich, dass so ein Barbar diesen heiligen Ort kennt? Er gehört hier nicht her. Die Luft zischt fluchend im Blätterwerk über dem Tempel, die Schatten ziehen sich vorsichtig an seine Mauern zurück. Mareike kann es spüren - der Mann muss hier weg.
„Also, wer bist du und was willst du hier? Du bist hier nicht willkommen.“ Sie klingt viel sicherer, als sie sich fühlt.
Bei ihren Worten wirbelt der fremde Mann herum und blickt sie erschreckt an. Ein schmales Gesicht, dunkle Haare, dunkle Augen. Töwerinisch, denkt sie irritiert, und viel zu fein geschnitten für einen Herumtreiber aus Brebaaron.
„Entschuldige“, sagt er. „Ich wollte dir keine Angst machen. Ich dachte eigentlich, hier wäre niemand. Zumindest war das früher so. Ist noch jemand mit dir hier?“
Mareike weiß nicht recht, ob sie ihm trauen soll. Er benimmt sich zwar sehr vornehm, ist aber auch ein gebrandmarkter Krimineller. Was wird er wohl mit ihr machen, wenn sie zugäbe, allein zu sein? Ihre Hand hält das gefährliche Wurfpäckchen in ihrer Umhängetasche fest umschlossen.
„Ich bin nur zufällig hier“, lügt sie. „Mit meinen Kameraden aus der Kräuterstube. Sie sind da drin und graben nach Zwirnwurz. Es sind kräftige Männer.“ Mit dem Kopf deutet sie hinter sich zur goldenen Tür. „Sie mögen nicht, wenn man sie stört.“
Zweifelnd legt er den Kopf schief und forscht in ihren Augen. „Die Tür ist versiegelt, seit vielen Jahren schon“, entgegnet er. „Und ich bezweifle, dass da unten überhaupt etwas wächst. Mein Name ist Johannes. Ich bin erst seit wenigen Tagen zurück in der Stadt.“ Er blickt eine Weile stumm umher. „Aber früher habe ich hier gelebt; also in Fahlenwalk. Daher kenne ich auch die Ruine. Als Kind bin ich oft hier gewesen. Es war ruhig, ich konnte den Kopf frei bekommen und mich von meiner Familie ein wenig zurückziehen, wenn es nötig war. Und du?“
Da er sich wirklich zu vornehm für einen Brebaar benimmt, beginnt sie ihm allmählich zu glauben und kann sich wieder etwas entspannen.
„Ich bin Mareike. Und ich bin es nicht gewohnt, hier jemanden zu treffen. Tut mir leid.“ Sie setzt sich im Schneidersitz auf den Rumpf einer umgestürzten Säule ins Sonnenlicht, wie die Druiden es tun, von denen ihr Großvater ihr erzählt hat.
Ohne sie zu beachten setzt sich Johannes an einen verwitterten, alten Altar und zieht ein winziges, mit schwarzer Flüssigkeit gefülltes Fläschchen hervor, in dem er mit einem dünnen Stab zu rühren beginnt. Nachdem er es mit unzufriedenem Gesicht gegen das Sonnenlicht begutachtet hat, kippt er es achtlos auf die alten, gebrochenen Pflastersteine, mit denen der Boden bedeckt ist.
Wie kann er es wagen, ihren geheimen Rückzugsort so unachtsam zu beschmutzen? Flugs springt Mareike auf und schnappt ihm das Fläschchen aus der Hand.
„Was fällt dir ein?“, empört sie sich.
Abwehrend hebt er die Hände. „Das ist doch nur Tinte!“ Wütend will sie das Fläschchen am liebsten zertrümmern und ihn an der Schulter von hier wegzerren, aber etwas hält sie zurück.
„Tinte?“, fragt sie. „Willst du etwa schreiben?“ Der Gedanke macht sie nervös, da sie selber, wie die meisten Leute in Töwerin, nicht schreiben kann. Im Gegensatz zu all den anderen nagt es aber an ihr, dass sie es nie gelernt hat. Mit neugierigem Pochen in ihrer Brust lässt sie Johannes gewähren und gibt ihm das Fläschchen zurück.
Aus einer schmalen Ledertasche an seinem Gürtel zieht er ein mitgenommenes, dünnes Büchlein, dessen weicher, lederne Einband den vielen Seiten kaum Halt gibt. Sorgfältig legt er es auf den Altar und verrührt schwarzes Pulver mit Wasser in dem Fläschchen zu schöner, dunkler Tinte, die er zufrieden gegen das Sonnenlicht prüft.
Als er in dem losen Buch blättert, blickt Mareike über den Rand auf seine Eintragungen. Zwar kann sie nichts davon lesen, aber das Schriftbild wirkt sehr gleichmäßig und elegant. Immer wieder überblättert er auch Seiten, auf denen Kohleskizzen zu sehen sind von Landschaften und Gebäuden, aber auch von Wesen, deren Gestalt Mareike nur von den Geschichten ihres Großvaters bekannt sind. Hat Johannes diese Wesen wirklich gesehen?
Irritiert zieht sie sich von dem Buch zurück. Es ist egal, wie weit man reist und was man dabei erfährt, denn was man in seinem Herzen nicht selber reifen lassen kann, findet man auch in der Fremde nicht. Mitleidig blickt sie auf Johannes und das Journal seiner Odyssee, in das er nun mit wundervoll eleganter Handschrift weiterschreibt. Die grässlichen, dünnen Linien des Brandmals auf seinem Handrücken wollen nicht recht zu seinen zarten Fingern passen.
Fragend deutet sie auf das Buch. „Wo bist du denn überall gewesen, um so viele Sachen zu sehen?“
Eine Weile schreibt er konzentriert, dann blickt er auf und streicht nachdenklich über die weiche Schreibfeder.
„Ich bin schon seit einer ganzen Weile weg, seit zehn Jahren etwa. Damals bin ich nach Westen gegangen, nach Brebaaron, wohin auch sonst? Ein paar Monate blieb ich da.“ Er versteift sich und spricht schnell weiter. „Aber dann bin ich schon bald nach Välas weiter, wo ich dann auch die ganzen Jahre verbracht habe. Es ist sehr schön da und ich freue mich, bald wieder zurückzukehren. Ich bleibe nur kurz hier in Fahlenwalk.“
Als Johannes erwähnt, dass die Väl ein sehr gläubiges Volk sind, das die Götter verehrt, ihnen Opfer darbringt und Lieder und Gedichte erzählt, will sie ihn auf die Probe stellen. Ist er nur ein Angeber oder weiß er wirklich so viel über das ferne Välas, wie er behauptet. Sie fragt ihn, ob er eines dieser Gedichte aufsagen kann, von denen er spricht. Verdutzt blickt er sie an und meint, dass er sicher eines davon aufgeschrieben hat.
„Hier ist es“, sagt er nach einigem Blättern. „Ich finde es ja ein wenig verstörend, aber urteile selbst.“
Im Untergang sind wir geboren,
nackt am Leibe und verwirrt.
Keiner Sprache Worte mächtig
uns der Kopf mit Chaos schwirrt.
Wir sehen Menschen weh;
und wahnsinnig und schmerzverzerrt.
Und die Schreie! Und die Toten!
Tausend' Leben ausradiert!
Konfus erheben wir den Blick
und finden riesige Gestalten,
Die miteinander Feuer rufen
und noch andere Gewalten.
Zornig ringen sie,
zerschmettern grausam ihresgleichen,
Und achten nicht der Menschen,
die entgeistert ihnen weichen.
Manche sehen aus wie Tiere,
riesenhaft und beißen sich,
Manche sind wie Feuergeister
und sie zaubern fürchterlich,
Manche sind uns Menschen gleich,
mit Schwertern voller Schmutz und Blut,
Es sind die Götter uns‘rer neuen Welt,
und sie treibt die Zornesglut.
Auch am Himmel überm Schlachtfeld
fliegen sie wie dichter Schwarm,
Von ferne her sie tragen Feuer
sacht wie Kinder, ruhig im Arm.
Wo sie es sanft zur Erde setzen,
brennt die Flamme lichterloh,
Es lässt in Asche neue Menschen,
frisch gebrannt, im Geiste roh.
Hinter ihnen, endlos oben,
gleißt ein Licht in Farben hell,
Jene Welt, von der wir stammen,
geht zu Grunde schön und grell.
In fremden Zungen Wort und Lieder,
Rufe und Gedichte gar
Vernehmen von den Göttern wir
die Klage, dass sie einstmals war.
Das Gedicht hat Mareikes Ruhe gebrochen und sie ziemlich aufgewühlt. Wer schreibt denn so etwas? Sie kann nicht glauben, dass sich das jemand ausgedacht hat, aber noch weniger kann sie glauben, dass es sich dereinst wirklich so zugetragen hat. Im Wirbel der Verse, die in ihrem Kopf widerhallen, kann sie die Stimme hinter der Tür hören – bis hierher!
„Ich höre das Gedicht von ferne, und jedes Wort ist wahr. Auch ich war da zu jener Zeit, und tat, was nötig war.“ Die Stimme bestätigt ihr flüsternd, was Johannes vorgetragen hat.
Eine Hand auf ihrer Schulter bringt sie in die Gegenwart zurück.
„Es tut mir leid, ich sagte ja, es ist verstörend.“ Johannes packt seine Sachen zusammen und erhebt sich. „Ich muss allmählich zurück. Es gibt noch so viel zu tun vor der… naja.“
„Warte mal!“, ruft sie und springt auf. „Kennst du noch mehr solche Gedichte? Oder andere Überlieferungen aus der Zeit?“ Wenn die Stimme sagt, dass sie bei den Ereignissen anwesend war, möchte Mareike noch mehr über diese Geschehnisse erfahren. Vielleicht bekommt sie so eine Vorstellung davon, zu wem die Stimme gehört, ohne ihre Ruhe dort unten zu stören.
Abwehrend hebt Johannes die Hände. „Ich habe doch in meinem Reisejournal keine Abhandlung über antike Mythen! Außerdem sind solche Sagen doch gemeinhin bekannt. Aber wenn dich das interessiert… in der Bibliothek des Magistrats gibt es solche Geschichtsbücher. Vielleicht finde ich da ja was…“
Mareike ist enttäuscht. Die städtischen Magistrate horten alle Schriften und Archive Töwerins, so auch das Magistrat von Fahlenwalk in seiner großen Bibliothek. Aber man muss sich gutstellen mit dem Magister, um Zugang zu erhalten. Sie weiß, dass Valerin Zugang zur Bibliothek hat, da er oft damit angibt, im Magistrat die Schriften einsehen zu dürfen. Aber dieser Johannes hier? Oder sie selbst? Und überhaupt, erhält vermutlich niemand mehr Zugang zu den Büchern, ehe nicht ein neuer Magister ernannt wird.
„Nie und nimmer lassen sie uns ins Magistrat.“
Sie tut den Gedanken unwirsch ab und ist wütend, dass ihr nie eine richtige Ausbildung zuteilwurde, in der sie selber Lesen gelernt und Zugang zu Geschichtsbüchern bekommen hätte. Sie will jetzt endlich wieder alleine sein.
„Mach dir mal keine Gedanken“, meint Johannes. „Du sagtest, dass du in der Kräuterstube arbeitest? Ich schaue mal, ob ich ein gutes Buch daheim über die alten Sagen finde und lasse es dann dorthin bringen.“ Schließlich macht er sich auf den Weg.
„Achso, und ich werde dich hier nicht mehr stören. Ich wusste ja nicht, dass jetzt jemand anders den Ort für sich entdeckt hat. Es ist großartig hier, oder? Schön, dass das auch jemand anders so empfindet. Aber vor der Tür dahinten solltest du dich in Acht nehmen; die ist nicht umsonst versiegelt.“ Er sagt es zwar, aber er sieht nicht so aus, als würde er ihr diesen Ort so gern überlassen wollen. Ein bisschen wehmütig blickt er sich noch einmal um, ehe er geht.
Endlich ist er weg! Mareikes ganze Anspannung fällt von ihr ab. Sein Gedicht war zwar aufregend und sie hatte nach weiteren Geschichten verlangt, aber sie könnte ihn auch nicht länger an ihrem vertrauten Lieblingsort ertragen. Wenn sie Lust auf ein Gespräch hat, und das hat sie eigentlich nie, dann geht sie auf den Markt, oder zu Elisa, ihrer Freundin. Aber hier will sie bitte schön ungestört sein! Frustriert blickt sie nach dem Stand der Sonne, der sie antreibt, endlich ihrer eigentlichen Arbeit nachzugehen.
Der Wald um Fahlenwalk ist alt und sich größtenteils selbst überlassen, mit Bäumen, deren Blätterdach sich hoch über Mareike zusammenschließen. Beständiger Wind von der See rauscht in den Blättern, durch die nur wenige Sonnenstrahlen hinunter auf den Boden dringen. Überall wächst dichtes Gebüsch zwischen den teils aus dem Erdreich herausragenden Wurzeln der Bäume, über die sich dickes Moos ausgebreitet hat.
Gedankenverloren wandelt sie zwischen den Bäumen zu der Stelle, an der sie Kräuter für den Meister sammeln muss. Rabstängel, Dämmerwuchs und Zundergelb sind es heute, die an einer kleinen, verfallenen Holzbrücke wachsen, die entlang eines längst vergessenen Trampelpfades einen winzigen Bach kreuzt. Rings um die Brücke sucht Mareike den Boden nach Zundergelb ab, doch ist das zierliche Kraut mit den gelblichen, kleinen Blüten komplett verschwunden. Stattdessen ist alles mit sprödem Flatterfarn überwuchert, einer wertlosen Pflanze.
Auch weiter den Bach entlang, wo sonst Zundergelb und Dämmerwuchs so üppig wachsen, ist nichts zu finden. Drüben, vor dem kleinen Vorsprung, ist ebenfalls nichts und auch hinten auf der kleinen Lichtung wächst nur Unkraut. Ein Wandel geht mit dem Wald vor, den Mareike in den letzten Tagen und Wochen deutlich bemerkt hat. Kräuter, Blumen und Tiere werden seltener, Unkraut und Gestrüpp hingegen stärker. Sie ist sich sicher, dass dies mit der Stimme im Tempel zusammenhängt, die in letzter Zeit lauter und fordernder geworden ist, wie auch der Wald strenger und gröber wird. Mareike fürchtet sich nicht vor dieser Veränderung, da alles geschieht, wie die Götter es bestimmt haben.
Fahlenwalk liegt auf einem Plateau der Wrangergast, einer zerklüfteten Erhebung, die sich über den nördlichen Teil Töwerins erstreckt. Normalerweise gelangt man über einen langen, gewundenen Weg auf das Plateau. Doch an der rückwärtigen Seite führt noch ein anderer Weg in die Stadt hinauf, eine alte Treppe, schmal und steil, aus der Zeit, als Fahlenwalk noch mit Stadtmauer und Türmen befestigt war. Wenn man aus dem unberührten, verlassenen Teil des Waldes kommt, ist das der kürzeste Weg.
Nachdem Mareike endlich ein paar Kräuter gefunden hat, steigt sie die schmalen Stufen an der Felswand hinauf. Das Gebüsch an der Steilwand wuchert neben ihr hoch, sodass sie nicht auf das Wasser unter sich blicken kann. Nur an einer einzigen Stelle auf halber Höhe ist es von einem steinernen Pavillon durchbrochen, einem alten Sichtposten, an dem Mareike innehält und gedankenverloren über das Meer blickt. Die Wellen sind in letzter Zeit besonders stark, denkt sie, obwohl es gar nicht so windig ist. Es wirkt, als sei das Meer in Unruhe, so wie auch der Wald.
Als Mareike schließlich die geschäftigen Straßen betritt und die letzten Leute mit ihren Einkäufen vom Markt an ihr vorübergehen, fühlt sie sich sofort fehl am Platz, wie eine Flamme im Schnee oder wie Wind in einem Gebäude. Sie fühlt in sich Farben und Lieder, Tiefe und Güte, viel mehr, als eine Stadt aus Routine und Anstand fassen kann.
Die Kräuterstube erreicht sie von der Händlerstraße aus über eine abzweigende, gewundene Pflasterstraße hinunter in den Kräuterhof, der von etwa einem Dutzend Häusern ringsum begrenzt wird, die nahtlos aneinanderschließen. Ein paar Laternen und das Licht aus den umliegenden Fenstern halten die Nacht noch zurück, sodass nur noch ein paar friedliche Alte auf den Bänken sitzen, die um den großen Baum inmitten des Platzes stehen. Sie rauchen Pfeife und schreien sich die Neuigkeiten des Tages in die schwerhörigen Ohren.
Als Mareike den Kräuterladen betritt, schlagen ihr der Lärm und Gestank des Abendausschanks entgegen, bei dem sich die Kunden so dicht in den Verkaufsraum drängen wie in einer Taverne. Zwar darf hier kein Alkohol verkauft werden, aber viele der Kräutertees stehen dessen berauschender Wirkung in nichts nach.
Die Gäste sitzen auf Stühlen und Hockern oder lehnen an den Verkaufsregalen, während sie laut miteinander schwatzen und an ihren heißen Getränken schlürfen. Um den vielen Leuten zu entgehen, flüchtet sich Mareike wie üblich hinter den Tresen zu Valerin, ihrem Kollegen, und packt die gesammelten Kräuter aus. Ein ätzender Geruch hängt an seiner sonst so eleganten Kleidung, der sie an bittere Arzneien erinnert. Je schneller sie hier fertig ist, desto eher kann sie auf ihr Zimmer im Obergeschoss verschwinden, da sie mit dem Abendverkauf zum Glück nichts zu tun hat.
Direkt vor ihr sitzen zwei Kunden am Tresen; ein bulliger Kerl mit riesigem Kreuz und kräftigen Oberarmen und eine Frau, die genervt einen schreienden Säugling tätschelt. Was sie sich dabei denkt, ein so kleines Kind diesem Stress aus Lärm und Gerüchen auszusetzen, will Mareike gar nicht wissen. Eilig senkt sie den Kopf und sortiert ihre Kräuter vor sich. Hauptsache, sie muss sich nicht mit dem Kerl oder der verantwortungslosen Mutter unterhalten.
„Eigentlich wollte ich ja nur ein Jahr hierbleiben“, blafft der stämmige Mann über den Lärm hinweg in ihre Richtung. „Aber da sie ja jetzt einen Hafen unten an der Küste bauen wollen, überleg ich mir das nochmal. Das kann gute Arbeit bringen. Für Schreiner wie mich gibt’s ja bestimmt eine Menge zu tun dann. Aber ob ich das jetzt wirklich mache, weiß ich auch nicht mehr. Dieses Scharr-Mistvieh kann dich ja an jeder Ecke erwischen. Das ist alles nicht mehr so sicher hier.“
Valerin schenkt ihm dampfenden Tee aus einer schön gearbeiteten Porzellankanne nach. Er trägt ein elegantes, teures Gewand, das seine gerade und schlanke Statur betont. Dazu bewegt er sich so würdevoll, als hätte er eine elitäre Erziehung genossen. Als Mann ist er schön anzuschauen, findet Mareike, wenn er sich nur nicht immer so künstlich verhalten würde.
„Arbeit am Hafen?“, ruft er dem Mann mit übertriebener Überraschung zu. „Wer weiß, ob das mit dem Hafen überhaupt noch etwas wird…“ Mit gespieltem Zweifel zuckt er die Schultern und wendet sich zu den Regalen um. Mareike weiß, wie sehr er es genießt, andere mit seinem Wissen zu locken, um sich dann den Rest aus der Nase herausziehen zu lassen. Es sind diese kurzen Augenblicke der Wichtigkeit, von denen er lebt und die Mareike so lästig findet. Wäre er nicht gleichzeitig ein so fähiger Geschäftsmann, würde sie sich fragen, warum der Meister ihn behält.
Die Frau mit dem Säugling jedenfalls hat angebissen. „Was meinen Sie denn damit? Ich dachte, das ist beschlossene Sache, dass der Hafen gebaut werden soll.“ Ihr Kleines hat aufgehört zu weinen und vergräbt überfordert sein Gesicht in ihrer Kleidung.
Mit erneut vorgetäuschter Überraschung wendet Valerin sich zu ihr um. „Aber die Fischer unten im Dorf, wo der Hafen gebaut werden soll, haben sich doch geweigert, ihre Hütten aufzugeben. Es heißt, die Entschädigung sei nicht hoch genug. Das weiß doch jeder, nicht wahr, Mareike?“ Da weder die Kundin noch Mareike von diesem Gerücht wissen, schweigen sie verlegen.
„Naja“, fährt Valerin zufrieden fort. „Soweit ich weiß, denkt der Vogt nicht im Traum daran, die Entschädigung zu erhöhen. Im Gegenteil, er will sogar…“. Valerin murmelt etwas vor sich hin, während er seine Worte geschickt mit dem klappernden Kannendeckel übertönt.
„Wie bitte?“, hakt die Frau mit zum Zerreißen gespannten Nerven nach. Irgendwie bekommt er es immer hin, dass man nochmal nachfragt und dann noch einmal. Wäre sein Durst nach Aufmerksamkeit nicht so anstrengend, wäre Mareike von seinem Einfallsreichtum tatsächlich beeindruckt. Hastig säubert sie die letzten Rabstängel, um sich nur schnell von all dem hier zurückzuziehen, von dem Gestank, dem Lärm, von Valerins Gehabe.
Der bullige Kerl hustet mächtig, ehe er sich an die Frau gewandt einmischt. „Er hat gesagt, der Vogt will jetzt gar nichts mehr zahlen. Er will die Leute einfach mit Gewalt aus ihren Häusern rausprügeln, wenn sie sich quer stellen.“
Entsetzt blickt sie den Mann an, den Mund vor Sprachlosigkeit offen, während Valerin ärgerlich auf die leere Tasse des Mannes deutet.





























