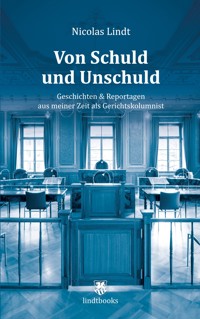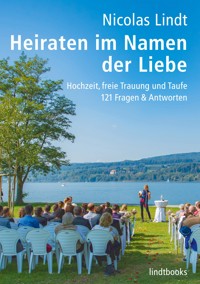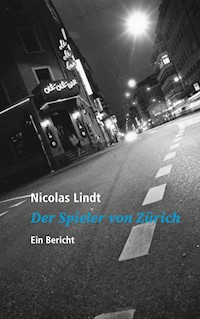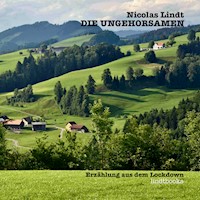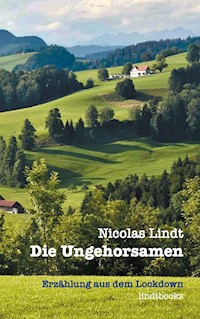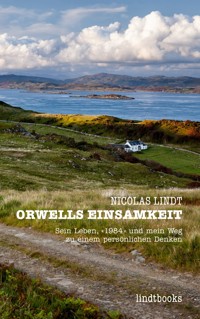
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Im schicksalhaften Jahr 1984 reiste ich auf die schottische Insel Jura, wo George Orwell sein letztes Werk schrieb - den düsteren und zugleich prophetischen Zukunftsroman «1984». Ich fühlte mich Orwell geistesverwandt. Sein bewegtes Leben und die tragische Entstehungsgeschichte des Buches standen am Anfang meines eigenen Weges. Es war der Weg zu einem persönlichen Denken.» Aus dem Inhalt: ORWELLS EINSAMKEIT ARTHUR KOESTLERS TÖDLICHE ENTTÄUSCHUNG DIE BEFREIUNG Mein Bruch mit der Linken und der Weg zu einem persönlichen Denken DIE PERSÖNLICHE SICHT DER DINGE 126 Texte und Aufsätze aus den Jahren 1982 Brief aus dem Exil Wenn die Sonne nicht wiederkäme Die Kientaler haben auch eine Meinung und nicht einmal die gleiche Der Hauptfeind E.T. tut gut «Niemand darf Dich daran hindern, umzukehren und zu sagen: Ich bereue, was ich getan habe» Die Berliner Mauer und die Schweizer Armee Vom Neid der Besitzenden Die Stunde vor dem Krieg Beklemmung Die Zeichen, die wir uns wünschen GEDANKENGÄNGE Zukunftsgedanken Über den Pessimismus Über den Techniker und den Künstlerr Über Expertendenken und persönliches Denken Das seltsam leere Gefühl der Freiheit Wilhelm Tell für Fortgeschrittene Sternenberg gibt es nur einmal Unser Kampf mit der Zeit Die Spinne Sachzwang Die Verletzung der Sprache Aufstieg und Fall der Geranien Ein Abenteuerspielplatz der Seele Die Heiserkeit der Vernunft Das Ende des Schuldgefühls Ein unsichtbarer Feiertag Selber Schuld Die Vorfreude auf den Montag Es lohnt sich Süchtig nach Melodie Wofür steht die Schweiz? Kap Horn
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Trust yourself
Bob Dylan
INHALT
ORWELLS EINSAMKEIT
Die Anreise
Der Weg nach Barnhill
Die Begegnung
ARTHUR KOESTLERS TÖDLICHE ENTTÄUSCHUNG
DIE BEFREIUNG
Mein Bruch mit der Linken
und der Weg zu einem persönlichen Denken
DIE PERSÖNLICHE SICHT DER DINGE
Texte und Aufsätze aus den Jahren 1982 – 83
Brief aus dem Exil
Wenn die Sonne nicht wiederkäme
Die Kientaler haben auch eine Meinung und nicht einmal die gleiche
Der Hauptfeind
E.T. tut gut
«Niemand darf Dich daran hindern, umzukehren und zu sagen: Ich bereue, was ich getan habe»
Die Berliner Mauer und die Schweizer Armee
Vom Neid der Besitzenden
Die Stunde vor dem Krieg
Beklemmung
Die Zeichen, die wir uns wünschen
GEDANKENGÄNGE 1994 – 2005
Zukunftsgedanken
Über den Pessimismus
Über den Techniker und den Künstler
Über Expertendenken und persönliches Denken
Das seltsam leere Gefühl der Freiheit
Wilhelm Tell für Fortgeschrittene
Sternenberg gibt es nur einmal
Unser Kampf mit der Zeit
Die Spinne Sachzwang
Die Verletzung der Sprache
Aufstieg und Fall der Geranien
Ein Abenteuerspielplatz der Seele
Die Heiserkeit der Vernunft
Das Ende des Schuldgefühls
Ein unsichtbarer Feiertag
Selber Schuld
Die Vorfreude auf den Montag
Es lohnt sich
Süchtig nach Melodie
Wofür steht die Schweiz?
Kap Horn
Quellenangaben
Werke von Nicolas Lindt
ORWELLS EINSAMKEIT
EIN REISEBERICHT AUS DEM JAHRE 1984
Die Anreise
Schottland im Winter – ein Winter der milden Sorte, weder Eis noch Schnee im Land. Aber es fängt an zu regnen und der Wind bläst hart, als ich an der Pier unten ankomme, er zupft und zaust mich, und die Regentropfen wirft er mir ins Gesicht. Port Askaig auf der Insel Islay ist ein verlorenes Nest. Ein Bootshafen, ein Hafenhotel, eine Bar, ein paar Häuser, mehr gibt es nicht. Der Ort liegt an einer Meerenge. Gegenüber ist ein verschwommener dunkler Streifen Land zu erkennen: Das muss Jura sein! Ein grauschwarzer Himmel liegt über Jura und davor, einer unüberwindbaren Grenze gleich, schäumt die unruhige See. Hohe Wellen klatschen gegen die Hafenmauer, die Fähre bäumt sich wie ein scheu gewordenes Pferd.
«No boat today», sagt der Fährmann. Das Boot schaffe es nicht bei diesem Seegang. Drüben auf Jura könne man nur bei ruhiger See anlegen. «We’ll try tomorrow», beschliesst der Mann.
Damit müsse man hier rechnen, sagt ein junger Typ zu mir, der mit seinem Motorrad nach Jura hinüber will. Die Insel sei im Winter nicht leicht erreichbar, manchmal sei man tagelang abgeschnitten vom Festland. Wir kommen ins Gespräch. Der junge Mann heisst Roddy, und er will wissen, was mich hierher verschlägt, in dieser Jahreszeit. Die Touristen, sagt er, kommen nur im Sommer. Als ich Orwell erwähne, weiss Roddy Bescheid. Er wohne ganz in der Nähe von Orwells Haus, fünf Meilen südlich. Du bist nicht der erste, der das Haus sehen will, sagt Roddy, es waren sogar schon Japaner da. Das hätte er mir besser nicht erzählt. Aber dann schaue ich wieder hinaus in die Meerenge, sehe hinter Regenschleiern die geheimnisvollen dunklen Umrisse der Insel und finde Jura doch eine Reise wert. Wer weiss, was mich erwartet.
Orwells Sehnsucht
Eine Familie zu gründen und sich auf eine einsame Insel zurückzuziehen, das war schon lange Orwells Wunsch gewesen. Einmal notierte er in sein Tagebuch: «Ich denke oft an meine Insel in den Hebriden, aber ich zweifle, ob mein Wunsch je in Erfüllung geht.» Orwell war mit Eileen verheiratet und arbeitete während des Krieges für die BBC. Sie hatten davor auf dem Land gewohnt, waren aber wegen Orwells neuer Tätigkeit nach London gezogen.
Eines Tages im Jahre 1944 erzählte ihm ein Freund von einer schottischen Insel. Sie hiess Jura. Der Freund, David Astor, besass Land auf Jura und wusste von einem leerstehenden Farmhaus. Das Cottage konnte billig gemietet werden, denn es war eines der abgelegensten Häuser und arg vernachlässigt. Orwell war begeistert. Während Eileen noch zögerte, hätte er am liebsten auf der Stelle hinfahren wollen. Es zog ihn hinaus in die Einsamkeit.
*
Draussen regnet es noch immer. Wir haben uns in die Bar verzogen. Die Frau hinter der Theke legt neue Torfstücke ins Kaminfeuer, der Geruch von verbranntem Torf durchzieht den Raum. Wir trinken Glühwein. Jetzt muss Roddy erzählen. Er ist Lehrer, einer der beiden Lehrer auf Jura. Ein knappes Jahr ist er hier, vorher lebte er mitten in Glasgow, wo er jahrelang politisch aktiv war, Mitglied der «Socialist Workers Party» – die englischen Trotzkisten.
Das jahrelange Engagement habe ihn müde gemacht, sagt Roddy, er habe das Bedürfnis verspürt, sich zurückzuziehen. Die Lehrerstelle hier draussen auf der Insel kam ihm deshalb gerade recht.
Ich frage den ehemaligen Aktivisten, ob er inzwischen aus der Partei ausgetreten sei. Nein, nein, erwidert Roddy fast schon entrüstet, er zahle nach wie vor seine Beiträge. Nur politisch könne er für die Partei im Moment nichts mehr tun. Als Schullehrer käme er in Schwierigkeiten. Er wohnt mit seiner Familie auf Jura, seine Frau erwartet das zweite Kind. Später, sagt er, wolle er vielleicht in die Stadt zurückkehren. Glasgow sei politisch interessanter als eine Insel wie Jura. Hier draussen gebe es praktisch keine Arbeiter.
Die Arbeiterklasse ist die Haupttriebkraft der Revolution, sage ich, und Roddy stimmt mir zu. Dann erst merkt er den Unterton in meiner Stimme. Wir geraten in ein kleineres Wortgefecht über den Stellenwert der Arbeiterklasse in der heutigen Zeit. Roddy kommt auf Orwell zu sprechen. Für Orwell, sagt er, war die Arbeiterklasse stets von grosser Bedeutung. Ich widerspreche ihm – denn soviel weiss ich nach all der Lektüre, dass Orwells Verhältnis zum Proletariat zwiespältig war.
Aber da kommt der Fährmann zur Tür herein und verkündet, das Boot fahre definitiv erst morgen. Roddy ist ungehalten. Es sei nicht das erste Mal, sagt er, dass er im Askaig Port Hotel übernachten müsse. Wir beschliessen, zusammen ein Zimmer zu nehmen. Aber das hat Zeit. Erst noch ein Glühwein.
Orwell findet, die Arbeiter stinken
Eric Blair, der sich als Autor das Pseudonym George Orwell zulegte, stammte nicht aus Arbeiterverhältnissen. Das war sein Problem. Fast bedauernd sagte er von sich selber, er sei ein Angehöriger des «unteren oberen Mittelstandes». Er hatte Internatserziehung genossen und sprach ein gepflegtes Englisch. Als junger Mann ging er nach Burma, wurde dort Polizeioffizier und repräsentierte britische Kolonialinteressen. Irgendwann hielt er das nicht mehr aus, und er kam zurück, trampte kurzentschlossen hinüber nach Frankreich, arbeitete in Paris zeitweise als Tellerwäscher und zeitweise gar nicht, hatte kaum Geld, lebte am Rand der Gosse. Als er die Nase voll hatte vom üblen Geruch der Armut, kehrte er – total abgebrannt – nach England zurück und begann zu schreiben. Schreibend verarbeitete er, was er in Paris und Burma erlebt hatte, schrieb an einem Roman, suchte lange Zeit vergeblich einen Verleger und fristete das Leben einer armen Dichtermaus.
Orwell begann sich für die Ideen der Linken zu interessieren. 1936 reiste er im Auftrag einer linken Zeitschrift in die englischen Bergbaugebiete, um über das Leben der Arbeiter zu berichten. Wieder lebte er unter Proleten, wohnte in ihren schäbigen Häusern, verkehrte in ihren Kneipen. Doch in sein Tagebuch schrieb er: «Es will mir nicht gelingen, von den Leuten als einer der ihren behandelt zu werden. Sie sagen entweder Sir oder Genosse zu mir. Obwohl ich mich unter ihnen aufhalte, gehöre ich nicht zu ihnen, und das wissen sie besser als ich.»
Orwell hatte grossen Respekt vor der Arbeiterklasse – vor ihrer Ausdauer, ihrer Bescheidenheit, ihrer «Anständigkeit», wie er es nannte. Doch manchmal schlug der Respekt ins pure Gegenteil um, zum Beispiel, wenn sich Orwell entsetzte über die Essgewohnheiten der Arbeiter, über ihre Manieren oder den Gestank in ihren Behausungen. Immer wieder, schrieb er in seiner Reportage «Road to Wigan Pier», habe er sich an einen Satz aus seiner Kindheit erinnert gefühlt: «Die unteren Klassen stinken.» Der Abschnitt über die stinkenden Arbeiter provozierte nach Erscheinen der Reportage eine Flut entrüsteter Leserbriefe. Selbst der Herausgeber distanzierte sich in einem Vorwort von Orwell und bezeichnete ihn als «schrecklichen Snob».
*
Roddy ist telefonieren gegangen, ich sitze allein in der Bar, nur die Frau hinter der Theke ist noch da und löst Kreuzworträtsel. Draussen wird es dunkel. Unser Gespräch über Orwell und die Arbeiterklasse geht mir durch den Kopf. Ich kann Orwells damalige Zwiespältigkeit gegenüber dem arbeitenden Volk gut begreifen, und ich würde Roddy gern die Geschichte erzählen, die ich am Vortag in Glasgow erlebte.
Die Proletin
Der Bus an die Küste fuhr erst in zwei Stunden, ich schlenderte durch die Glasgower City, einer belebten Geschäftsstrasse entlang und fand endlich ein Tea-room, das mich zum Bleiben verlockte. Im Lokal herrschte gerade Hochbetrieb. Und während die Serviertöchter mit ihren Tabletts von Tisch zu Tisch eilten, war inmitten der Gäste eine Frau mit dem Abräumen und Reinigen der Tische beschäftigt.
Ich schaute ihr zu. Sie war eine jüngere Frau, vielleicht 40, und so, wie sie ihre Arbeit verrichtete, hatte ich den Eindruck, sie mache das bereits jahrelang. Jahrelang. Ich fragte mich, wie sie das aushält, diese Arbeit, die doch so stumpfsinnig ist, wie sie das ein Leben lang auf sich nimmt. Und wäre es nur die Arbeit; ich war sicher, dass dieselbe Frau in einem der Wohnblöcke am Stadtrand von Glasgow wohnte, die ich vom Zug aus gesehen hatte, eingekeilt zwischen Fabrikschloten und Autobahnkreuzen, niedergedrückt von einer Luft, die kaum zum Atmen ausreicht. Ich stellte mir vor, wie dieselbe Frau nach getaner Arbeit zuhause ihre schmuddeligen, quäkenden Kinder besorgen, ihrem Mann die bacon and eggs zubereiten und wie sie nachher den Küchentisch abräumen und reinigen muss, so wie sie vorher die Tische im Tea-room sauberzumachen hatte.
Immer muss diese Frau aufräumen und reinigen, sonst wird sie nicht viel erleben. Wenn es hochkommt, irgendwann zwei Ferienwochen in Brighton. Und irgendwann werden ihre Kinder erwachsen sein, und irgendwann wird sie sterben, und niemand ausser den nächsten Angehörigen wird sich jemals an sie erinnern, niemand wird sie vermissen. Sie ist in dieses Leben gekommen, um zu reinigen und aufzuräumen, und sie wird keine Spuren hinterlassen. Es deprimierte mich, der Frau bei ihrem Tun zuzusehen, und es deprimierte mich jetzt noch viel mehr, wo ich mir ihr schäbiges Leben ausgemalt hatte.
Dann, ganz plötzlich, war mir die Frau gleichgültig. Sie ist selber schuld, dachte ich, dass sie dieses Leben auf sich genommen hat. Sie hätte ausbrechen können, sie hätte es wenigstens versuchen können! Ich beobachtete, wie gewissenhaft sie ihre Arbeit machte. Nach dem Abräumen des Geschirrs putzte sie den Tisch sauber mit einem Lappen, ribbelte und rubbelte, bis die Tischplatte glänzte, säuberte den Tisch noch ein zweitesmal, obwohl es nichts mehr zu säubern gab, wandte sich dann endlich dem nächsten Tisch zu und begann ihr Werk von vorn.
Ich empfand für die Frau beinahe Verachtung. Wie hatte ich noch vor wenigen Jahren für die Arbeiterklasse geschwärmt – da stand sie nun vor mir, die Proletarierin, und räumte still und ordentlich meinen Tisch ab, ohne aufzublicken. Es hätte mir nicht schlecht gefallen, wenn sie mich vor dem Abräumen um Erlaubnis gebeten hätte. Ich verfolgte ihre Hand, die mit dem Lappen die Kaffeeflecken auf meinem Tisch wegwischte, und ich fragte mich, ob sich die Frau ihrer Situation überhaupt bewusst ist. Nein, ist sie nicht, sonst würde sie mit diesem Leben gleich Schluss machen. Sie hält das alles nur aus, dachte ich, weil sie nichts davon weiss, weil sie ihre Tische abräumt und reinigt, ohne darüber nachzudenken.
Als sie meine Tischplatte sauber hatte, griff sie zu ihrem Geschirrwagen und manövrierte an mir vorbei auf den nächsten Tisch zu. Ich beobachtete sie, beobachtete ihren Gang, ihre Hände, ihr zu Boden gesenktes Gesicht, beobachtete, wie sie auf einmal aufblickte – und mich anschaute, mir direkt in die Augen sah, mit einem Blick, der unmissverständlich war:
Ich weiss, was du von mir denkst.
Orwell wird Parteimitglied und tritt wieder aus
1938, nach seiner Rückkehr aus dem Spanischen Bürgerkrieg, hatte Orwell beschlossen, der «Independent Labour Party» beizutreten. Die ILP, eine eher kleine Gruppierung war damals das «linke Gewissen» der grossen Labour Party. In der ILP sah Orwell die einzige Kraft, die die Prinzipien des Sozialismus aufrechterhielt, denn sowohl die Sozialdemokraten wie auch die moskautreuen Kommunisten hatten nach Orwells Ansicht der Idee des Sozialismus schweren Schaden zugefügt.
Nachdem in Deutschland die Nationalsozialisten und in Italien die Faschisten die Macht übernommen hatten, befürchtete Orwell auch in England eine Entwicklung hin zum Faschismus. Die bürgerliche englische Demokratie werde dies nicht verhindern können, argumentierte er in seinem Beitrittsschreiben zur ILP. «Nur ein sozialistisches Regime wird es auf die Dauer wagen, die Meinungsfreiheit zu dulden», schrieb Orwell. Das war die politische Begründung.
Orwell wollte aber auch deshalb ILP-Mitglied werden, weil er sich in seiner Rolle als Schriftsteller unausgefüllt fühlte. Er wollte nicht nur schreiben, er wollte handeln, er wollte an die Front, an die Front des unmittelbaren Lebens: So wie er in Paris in der Gosse gehaust, bei den englischen Bergarbeitern gelebt und als Freiwilliger am Spanischen Bürgerkrieg teilgenommen hatte, so zog es ihn jetzt an die Front der Politik.
Doch seine Mitgliedschaft blieb ein kurzes Gastspiel. Kaum zwei Jahre später trat er aus der ILP wieder aus. In seinen Augen war sie nicht besser als die anderen linken Parteien. Orwell war enttäuscht, und seine Enttäuschung wurde grundsätzlich:
«Was ich in Spanien erlebte und seither vom inneren Funktionieren linker politischer Parteien erfuhr, weckte in mir tiefen Abscheu vor der Politik», schrieb er in einer autobiografischen Notiz kurz nach Kriegsbeginn. Der Sozialist Orwell wurde zu einem scharfen, polemischen Kritiker der Linken. Er warf ihnen vor, die britischen Traditionen und die patriotischen Gefühle im Volk zu missachten. Die Linke sei anti-britisch, fand er, durch ihre dogmatische Politik nütze sie nur der Gegenseite und erleichtere es dem Faschismus, sich auch in England auszubreiten. Orwells Hauptvorwurf an die Linke war, dass sie, anstatt totalitäre Tendenzen zu bekämpfen, selber totalitär sei.
*
Es ist Abend geworden in Port Askaig. Wir bezogen im Hotel unser Zimmer. Im Dining Room waren wir die einzigen Gäste. Lammfleisch mit Kartoffeln gab es, dazu bestellten wir französischen Rotwein. Wir prosteten auf Orwell – und auf den Sozialismus! rief Roddy. Auf die Ungewissheit der Zukunft! gab ich zurück, und wir liessen die Gläser klingen. Jetzt sitzen wir in der Hotelbar beim Kaffee. Die Debatte nimmt ihren Fortgang. Roddy sagt, Orwells Kritik an der Linken war damals sicher berechtigt, aber heute nicht mehr. Die Neue Linke ist toleranter. Und die alten Stalinisten, die es noch gibt, werden längst nicht mehr ernst genommen. Ich weiss nicht, entgegne ich, ob sich tatsächlich soviel geändert hat seither. Ich stehe noch immer unter dem Eindruck eines Erlebnisses am Abend meiner Ankunft in London. Ich wünschte mir, sage ich zu Roddy, Orwell wäre dabeigewesen...
Die Revolutionäre
Am Eingang zur U-Bahn drückte mir ein junger Mann ein Flugblatt in die Hand. Es war die Einladung für eine Veranstaltung der Workers Revolutionary Party: «What the anti unionlaws mean and how to fight them» – ein Meeting gegen die gewerkschaftsfeindliche Politik der konservativen Regierung Thatcher. Beginn 8 p.m., Brixton Town Hall, London SW 2. «Alle Gewerkschafter, Arbeitslosen und Jugendlichen sind herzlich willkommen.» Ich beschloss hinzugehen.
Etwa hundert Personen waren im Saal schon versammelt, meist jüngere Leute, Jugendliche und einige Schwarze. Auf dem Podium vorne Vertreter der Partei und Gewerkschaftsaktivisten. Die Referate, die nun folgten, unterschieden sich nicht stark voneinander, und sie mündeten alle in die gleiche Schlussfolgerung: Dass an der Krise das kapitalistische System schuld sei und der Sozialismus auf der Tagesordnung stehe.
Höhepunkt des Meetings war die abschliessende Rede von Gerry Healy, Mitglied des ZK’s der Workers Revolutionary Party, ein alter Kämpfer, das sah man ihm an, das hörte man schon nach den ersten Sätzen. Ganz sachlich, gelassen begann er sein Referat, dann steigerte er sich mit jedem Satz, und als er schliesslich beim Punkt angelangt war, wo es nicht mehr genügt, gegen Symptome zu kämpfen, wo das System selbst bekämpft werden muss, liess er seine Stimme in den Saal hineindonnern, als müsste sich jeder Einzelne auf der Stelle entscheiden:
«Wenn die Arbeiterklasse jetzt ihre Kraft nicht braucht», schrie der Mann ins Mikrophon, «dann, ja dann», fuhr er ganz leise fort, «hat die Arbeiterklasse keine Zukunft».
Es herrschte Totenstille im Saal. Mit drohender Gebärde fuhr Healy fort, das gegenwärtige Klima sei reif für ein Wiedererwachen des Faschismus: «Eines Tages werden sie die Konzentrationslager wieder aufbauen» erklärte er, «deshalb müssen wir kämpfen, kämpfen bis zur endgültigen Zerschlagung des Kapitalismus!» Er hielt inne, ordnete sein Manuskript und wandte sich dann wieder dem Publikum zu mit der Aufforderung, am Ende der Veranstaltung der Partei beizutreten.
Ich fühlte mich fehl am Platz. Zu meiner Linken und Rechten beeindruckte Zuhörer und niemand darunter, dem ich angesehen hätte, dass er ähnlich empfand wie ich. Bei einigen war der Gesichtsausdruck eher abgeklärt oder ausdruckslos – das waren wohl die Parteimitglieder.
Die Frau neben mir hatte wahrend Healys Referat immer wieder zu mir geschaut. Sie sah, dass ich Notizen machte. Am Ende der Veranstaltung stellte sie mich zur Rede. Ich sagte, Schreiben sei mein Beruf. Die Presse sei an dieser Veranstaltung nicht erwünscht, erwiderte die Genossin. Sie erklärte es so laut, dass andere Parteimitglieder aufmerksam wurden und sich ebenfalls mir zuwandten. Ich wurde nach dem Zweck meiner Notizen gefragt, worauf ich wahrheitsgemäss entgegnete, dass ich mich auf den Spuren George Orwells befände und dass ich alles, was ich mir überlegte, aufschreiben würde.
Die Genossen glaubten mir nicht. Diese Veranstaltung habe nichts mit Orwell zu tun. Ich solle ihnen meine Notizen herausgeben. Ich weigerte mich. Sie umringten mich, und die Genossin, die mich beobachtet hatte, schaute mich jetzt mit überlegenem Lächeln an. Sie streckte die Hand aus und forderte mich erneut auf, meine Notizen herauszugeben. Ich wollte nicht. Ich wurde nervös.
Bis ich auf die Idee kam, der Genossin meinen Schweizer Pass zu zeigen. Da liess sie von mir ab, und ich konnte endlich gehen. Meine Schritte verlangsamte ich erst, als ich den Eingang zur U-Bahn-Station erreicht hatte.
Orwell schreibt eine Fabel, die niemand will
Eines Tages, kurz nach Kriegsbeginn, sah Orwell unterwegs auf dem Land einen kleinen Jungen, vielleicht zehn Jahre alt, der einen Ackergaul vor sich her trieb und ihn jedesmal, wenn er stehenblieb, mit der Peitsche schlug. Das brachte Orwell auf die Idee, eine Fabel zu schreiben – über Tiere, die sich von den Menschen nichts mehr gefallen lassen und die Macht an sich reissen. Orwell spann den Faden weiter und stellte sich vor, was herauskommt, wenn die Ohnmächtigen selber mächtig sind. 1943 begann er die Fabel niederzuschreiben. Er nannte sie «Animal Farm».
Die politische Absicht war offensichtlich. In einem Vorwort schrieb er: «Bis 1939 und sogar später war die Mehrheit der Engländer nicht imstande, das wahre Wesen des Nazi-Regimes einzuschätzen. Jetzt, beim sowjetischen Regime, unterliegt sie in hohem Masse der gleichen Täuschung.»
Orwell, der sich nach wie vor «gefühlsmässig» als Linker verstand, fand es wichtig, den «sowjetischen Mythos» der englischen Linken in Frage zu stellen. «Meiner Ansicht nach», schrieb er, «hat nichts so sehr zur Verfälschung der ursprünglichen Idee des Sozialismus beigetragen wie der Glaube, dass die Sowjetunion ein sozialistisches Land sei und dass jeder Akt seiner Herrscher entschuldigt, wenn nicht sogar imitiert werden müsse.»
Niemand wollte die Fabel veröffentlichen. Die linksorientierten Verleger waren mit dem Inhalt nicht einverstanden, und die eher bürgerlichen Verleger fanden den Zeitpunkt nicht günstig. Das Jahr 1944 hatte begonnen, und die Rote Armee, mit der die Alliierten inzwischen verbündet waren, feierte einen Sieg nach dem andern. Grossbritannien konnte aufatmen: Wer wollte in dieser Situation das englisch-sowjetische Verhältnis trüben? – Orwell entschloss sich, das Buch in einem kleinen anarchistischen Verlag zu veröffentlichen und eigenhändig zu vertreiben. Ein gesalzenes Vorwort zum Thema Pressefreiheit hatte er schon verfasst – da fand sich unverhofft doch ein Verleger: Frederic Warburg wollte das Buch herausgeben, aber auch er zögerte, und das Manuskript blieb, nicht ganz unabsichtlich, fast ein Jahr in Warburgs Schublade liegen.
Orwell machte das alles schwer zu schaffen, denn er fühlte sich nicht nur politisch isoliert, er hatte auch kein Geld. Obwohl er bereits über 40 war, konnte er vom Schreiben noch immer kaum leben. Die Tätigkeit bei der BBC, wo er britische Propagandasendungen machen musste, hatte er nicht mehr ausgehalten, er kündigte und fand mit Glück eine schlecht bezahlte Halbtagsstelle als Kulturredaktor bei der Wochenzeitung «Tribune». Das war fast die einzige linke Zeitung, die mit Orwell überhaupt noch zu tun haben wollte.
Eileen, seine Frau, arbeitete auch, und zusammen verdienten sie gerade genug. Doch dann, im Sommer 1944, regte sich bei Orwell immer stärker der Wunsch nach einem Kind. Da er – nach eigener Aussage – «steril» war, blieb nur die Möglichkeit der Adoption. Es war ein Junge, den sie schliesslich adoptierten, und sie nannten ihn Richard. Eileen gab ihre Stelle auf und blieb zuhause, um für das Kind zu sorgen – so wie es sich Orwell immer gewünscht hatte. Doch wie wollte er seine Familie ernähren?
Oft sass er bis spät in die Nacht an der Schreibmaschine und arbeitete buchstäblich bis zur Erschöpfung. Er rauchte beim Schreiben fast pausenlos, und der Tee, den er trank, war so stark, dass der Löffel im Tee fast steckenblieb. Orwell spürte, dass er krank wurde. Seine Lunge schmerzte, Bronchitis, stellte der Arzt fest, Orwell sollte sich schonen. Aber das war nicht seine Art.
1945 bekam er das unverhoffte Angebot, als Berichterstatter des «Observer» nach Deutschland zu reisen, das kurz vor der Kapitulation stand. Trotz seines Gesundheitszustandes liess Orwell alles stehen und liegen und reiste ab. Als er im soeben befreiten Köln ankam, war er so krank, dass er in ein amerikanisches Militärspital eingeliefert werden musste. Dort erhielt er ein erschütterndes Telegramm: Eileen war tot. Sie hatte ein Gebärmuttergeschwür gehabt und war während der Operation unerwartet gestorben. Schon längere Zeit hatte sie sich nicht wohl gefühlt, aber Orwell hatte wohl nicht erkannt, wie krank sie war, als er abreiste. Vielleicht wollte er es auch nicht wahrhaben, denn die Arbeit – nach dem Urteil seiner Freunde zu schliessen – war ihm offenbar wichtiger als alles andere, wichtiger selbst als seine Frau, die ihm doch so viel bedeutete.
Er kehrte sofort nach London zurück, obwohl er noch immer krank war. In seiner Umgebung spürten alle, wie schwer ihn Eileens Tod getroffen hatte, doch er sprach mit fast niemandem über seine Gefühle. Das war bei ihm immer schon so gewesen.
Als er Monate später bei seinem guten Freund, dem Schriftsteller Arthur Koestler zu Besuch war, habe er einmal über Eileen gesprochen und sich gefragt, warum «soviele Dinge zwischen zwei Menschen unausgesprochen bleiben müssen».
Orwell ist allein
In einem Essay mit dem Titel «Wir und die Atombombe» schrieb der Autor im Oktober 1945: «Wenn man bedenkt, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir alle innerhalb der nächsten fünf Jahre von ihr in die Luft gesprengt werden könnten, hat die Atombombe eigentlich nicht so viele Diskussionen entfacht, wie man es von ihr erwarten müsste.»
Der Autor zeichnete ein pessimistisches, düsteres Zukunftsbild und prophezeite die Aufteilung der Welt in drei Supermächte – USA, UdSSR und China –, die als einzige über Atomwaffen verfügen. Orwell schien jede Hoffnung auf eine Wende zum Besseren verloren zu haben, obwohl doch der Krieg gerade vorbei war. Eine gewisse Chance sah er noch in einem sozialistischen Westeuropa, das als gutes Beispiel ansteckend wirken könnte – doch fast im gleichen Atemzug winkte er ab.
«Ein Sozialist», schrieb er in einem seiner Essays, «ist heutzutage in der gleichen Lage wie ein Arzt, der einen beinahe hoffnungslosen Fall behandelt. Wenn ich ein Buchmacher wäre, der bloss die Wahrscheinlichkeit berechnet und seine eigenen Wünsche ausser Betracht lässt, würde ich darauf setzen, dass die menschliche Zivilisation innerhalb der nächsten paar hundert Jahre zugrunde geht.» Orwells Entschluss, sich nach Jura zurückzuziehen, stand nun fest. Richard, sein kleiner Sohn, würde mit ihm gehen, und er wollte ihm der beste Vater sein. Alle, die ihn Ende 1945 in London mit Richard zusammen erlebten, bestätigen, wie einfühlsam Orwell für das Kind sorgte. Aber Orwell wollte nicht allein mit Richard nach Jura. Er wünschte sich wieder eine Beziehung und machte in kurzen Abständen mehreren Frauen Heiratsanträge. Einer von ihnen schrieb er:
«Ich frage Sie, ob Sie die Witwe eines Schriftstellers werden wollen. Sie sind jung und gesund und verdienen einen besseren als mich. Wenn Sie sich aber ein Leben als Witwe vorstellen können, dann gäbe es Schlechteres. Falls ich noch zehn Jahre habe, könnte ich wohl noch drei gute Bücher schreiben. Ich wünsche mir vor allem Frieden, Ruhe und jemanden, der mich mag. Zurzeit gibt es in meinem Leben nur noch die Arbeit und Richard. Manchmal fühle ich mich verdammt einsam. Ich habe genug Freunde, aber keine Frau, der ich wichtig bin und die mich anspornen kann.»
So offen war Orwell selten gewesen. Er schrieb wie einer, der nichts mehr verlieren kann. Doch in seinen Heiratsanträgen war die Absage eigentlich schon enthalten – und tatsächlich wollte keine Frau mit ihm nach Jura kommen. Orwell musste allein gehen, allein mit seinem Kind, allein mit einer Tätigkeit, die ihn noch einsamer machte, als er schon war, die ihn aber nicht losliess und am Leben erhielt.
Der Mann an der Bar
In der Hotelbar von Port Askaig herrscht noch immer Betrieb. Unter die paar wenigen Hotelgäste haben sich die Farmer der Gegend gemischt. Es geht laut zu und her an diesem Freitagabend. Roddy, der Schullehrer von Jura, ist schlafen gegangen, ich bin noch hellwach, sitze an der Theke, bestelle ein letztes Glas Glühwein und hoffe, dass es mich endlich müde macht.
Der Mann neben mir, schon ziemlich angeheitert, redet mich an. Er ist Elektriker, erzählt er, und auf Montage von Insel zu Insel.
«Morgen geht’s nach Jura, ans Ende der Welt!» sagt er und grinst. «Und du?»
Ich erzähle von Orwell. «Nineteeneightyfour», sagt der Schotte, mehr weiss er nicht darüber. «Willst du auch so ein Buch schreiben», fragt er mich, «vielleicht über das Jahr 2000?» Dann schaut er mich an, schaut, als ob er etwas über mich herausfinden müsste, und stellt sein Bierglas hin.
«Wenn du schreibst», meint er dann, «darfst du dich von niemandem beirren lassen, verstehst du? Schreib’ genau das, was du da drin in dir fühlst». Und er legt seine Hand auf meine Brust, genau da, wo das Herz ist. Dann nimmt er wieder einen Schluck. Und während er das Glas hebt, nickt er mir zu wie einer, der weiss, dass er recht hat.
Etwas später, im Hotelzimmer, suche ich aus dem Rucksack ein Buch von Orwell heraus, das ich mit mir nahm. Einen Essayband. «Der Schriftsteller und sein Leviathan» heisst der Text, den ich suche. Ich blättere nach der Stelle, die ich rot unterstrichen habe:
«Müssen wir aus alledem folgern, dass der Schriftsteller die Pflicht hat, sich aus der Politik herauszuhalten? Gewiss nicht! Kein denkender Mensch in unserer Zeit kann die Politik ignorieren. Aber wenn ein Schriftsteller sich auf Politik einlässt, sollte er das als Mensch und Bürger seines Landes tun, nicht als Schriftsteller. Was er auch immer im Dienste der Sache tun mag – als Schriftsteller sollte er nie seine Gedanken opfern, auch wenn sie zu einer Abweichung der vorgeschriebenen Linie führen; und er sollte sich nicht allzusehr darum kümmern, ob ihm jemand sein unorthodoxes Denken zum Vorwurf macht. Vielleicht ist es für einen Schriftsteller heute nicht einmal ein schlechtes Zeichen, wenn er reaktionärer Tendenzen verdächtigt wird – so wie es noch vor einigen Jahrzehnten ein schlechtes Zeichen gewesen wäre, nicht der Sympathie für die Kommunisten verdächtigt zu werden.»
Der Weg nach Barnhill
Roddy nimmt mich auf dem Motorrad mit, bis nach Craighouse vorerst, zum Hauptort der Insel. Von dort will ich zu Fuss weiter. Ein frischer Februarmorgen, der Wind, der vom Meer kommt, das schottische Wolkenschauspiel über unseren Köpfen und vereinzelte Sonnenstrahlen: Die Fahrt durch die Insel wird ein Erlebnis. Motorräder haben leichtes Spiel auf Jura, denn die langgestreckte Landstrasse, die sich einsam durch die Hochmoorlandschaft zieht, steht zu unserer freien Verfügung. Gegenverkehr gibt es nicht. Weit vorne am Horizont verliert sich die Strasse in den Hügeln der Insel.
Dort, irgendwo, muss das Ende der Welt sein. Ich rufe es Roddy ins Ohr. Er ruft zurück: «Man lebt nicht schlecht am Ende der Welt!» Wir fahren dahin.
Orwell zieht sich zurück
Im Januar 1946, noch immer in London, schrieb Orwell an einen Freund: «Ich habe jetzt auch noch mit wöchentlichen Beiträgen für den «Evening Standard» angefangen. Aber ich werde damit wieder aufhören und überhaupt mit Journalismus vorübergehend Schluss machen, denn ich brauche jetzt ein halbes Jahr Zeit, um einen Roman zu schreiben.»
Orwell plante zunächst, auf Jura den Sommer zu verbringen und im Winter jeweils wieder in seine kleine Londoner Wohnung zurückzukehren. Für die Miete des Hauses und den Transport der Möbel hatte er jetzt endlich genug Geld, denn «Animal Farm», kaum erschienen, war ein Bestseller. Sogar Queen Elizabeth liess sich ein Exemplar besorgen. Und weil das Büchlein in den grossen Londoner Buchhandlungen ausverkauft war, blieb dem Einkäufer der Königin nichts anderes übrig, als mit seiner Kutsche eine windige anarchistische Bücherei aufzusuchen, wo «Animal Farm» noch vorrätig war.
Das Blatt hatte sich gewendet, Orwell war nicht länger nur ein umstrittener Autor, er fand Anerkennung, er wurde bekannt. Doch als er im Mai endlich auf der Insel ankam, kannte ihn dort niemand. Er kam als alleinstehender, verwitweter Mann, und er kam als Fremder. Nur sein Sohn Richard war bei ihm, und später reiste ihm seine Schwester Avril nach, die beschlossen hatte, mit ihrem Bruder zu leben und ihm den Haushalt zu besorgen. Orwell war fast der einzige Nicht-Einheimische auf Jura.
Die Landlords, denen die Ländereien auf Jura gehörten und noch heute gehören, lebten nur teilweise hier. Die meisten der damals rund 200 Inselbewohner waren arm und wenig gebildet. Sie bestellten das Land für die Landeigentümer, hüteten Schafe, lebten vom Fischfang und gingen ins Moor, um den Torf zu stechen. Orwell, der Intellektuelle aus London, war anders als sie. Sie fanden ihn nett und hilfsbereit, aber «ein wenig sonderbar», wie sich später ein ansässiger Bauer über den Schriftsteller äusserte. Sie konnten nicht recht verstehen, warum sich ein gebildeter Mann aus London ausgerechnet in die einsamste Ecke Schottlands verzog.
Barnhill, das Haus, das Orwell gemietet hatte, lag an der Nordspitze der langgezogenen Insel, acht Kilometer von der letzten grösseren Siedlung, Ardlussa, entfernt. Auf Barnhill gab es kein Elektrisch, und bis zum nächsten Telefon waren es 20 Kilometer. Der einzige Arzt auf der Insel wohnte in Craighouse, fast 40 Kilometer von Barnhill entfernt. Hätte Orwell wenigstens ein Haus im Hauptort der Insel gemietet – dort, wo die Verbindung zum Festland war, dort, wo der einzige Laden war, die einzige Post, die einzige Bar!
Orwell wählte die Einsamkeit in der Einsamkeit. So, wie er in seinen Essays und Polemiken immer wieder sehr weit ging, so ging er auch hier auf Jura so weit er konnte und suchte sich ausgerechnet das abgelegenste aller Häuser aus.
*
Einen langen Weg habe ich vor mir. Zu Fuss bis zur Nordspitze der Insel. Kaum habe ich Craighouse verlassen, scheint es nur noch mich und diese Strasse und diese Landschaft zu geben: Kein Haus in Sicht, kein Verkehr, kein Mensch.
Ich entdecke die Tiere. Es werden immer mehr, je weiter ich vordringe. In den Tümpeln abseits der Strasse schwimmen Enten und Schwäne. Schafe weiden in den moorigen Wiesen, Rehe und Hirsche grasen unweit der Strasse, ganze Rudel entdecke ich jetzt. Hoch über ihnen kreisen grosse Vögel. Ob es Adler sind? Ein dunkles Etwas hoppelt auf der Strasse davon und verschwindet in einem Tümpel. Ich bleibe stehen und warte, bis es wieder hervorkommt: Ein Fischotter? Ganz behutsam gehe ich weiter, ich möchte nicht stören. Aber der Fischotter watschelt so eilig davon, als renne er um sein Leben, und die Schafe am Wegrand stieben sogleich auseinander, als sie mich kommen hören.
Orwells Schatten wächst
Orwell war in seinem Element. Kaum hatte er das Haus auf der Insel bezogen, begann er ein Tagebuch. Aber es war ein ganz besonderes Tagebuch, ein «Naturtagebuch», und auch Orwell schrieb darin über die Tiere, Er beobachtete das Verhalten der Vögel, er beschrieb seine erste Kaninchenjagd, wie er die Hummerkörbe im Meer aussetzte und was er auf seinen Rundgängen alles entdeckte. Er schrieb über die Arbeit im Garten, über das Gemüse, über die Blumen, und er notierte täglich das Wetter.
Sonst setzte er sich in dieser ersten Zeit auf Jura nur selten an seine Schreibmaschine. Die Tage vergingen mit Gartenarbeit, Arbeit im Haus, Jagd und Fischfang. Oft spielte er stundenlang mit dem kleinen Richard, nahm ihn auf seine Spaziergänge mit und zeigte ihm alles. Er nahm sich Zeit, zum erstenmal seit Jahren, und es tat ihm gut.
Orwell hatte seine Freunde eingeladen, ihn zu besuchen. Nun erschienen sie alle, und es kam der Moment, wo es ihm zuviel wurde. Er sehnte sich plötzlich nach Ruhe. Das Buchprojekt, das er mit sich herum trug, drängte zur Realisierung – und endlich, Ende August 1946 begann Orwell zu schreiben.
Noch war Sommer auf Jura, aber das Buch beginnt «an einem kalten, windigen Apriltag». Über das Haus auf der schottischen Insel legte sich fast unbemerkt ein Schatten. Ahnte Orwell schon, was er da heraufbeschwor, als er die ersten Seiten von «1984» schrieb? Und wusste er damals schon, wie sein Roman enden würde? «1984» besteht aus drei Teilen, und der zweite Teil endet damit, dass Winston und Julia verhaftet werden. Sah Orwell für die beiden noch einen Ausweg? Sah er für sich einen Ausweg? Noch lebte er, als wäre der Schatten über seinem Leben nur vorübergehend.
Als er im Herbst 1946 in seine Londoner Wohnung zurückkehrte, hatte er erst etwa fünfzig Seiten geschrieben. Er liess das Manuskript liegen und war den Winter über wieder journalistisch tätig. Es war ein harter Winter, ein Nachkriegswinter. Lebensmittel waren rationiert, es fehlte an Kohle und dauernd gab es Stromausfälle. Orwell spürte seine Lunge heftiger denn je. Von der Rückkehr nach Jura erhoffte er sich Besserung, aber als er dann im April wieder dort ankam, war er so krank, dass er einen ganzen Monat im Haus bleiben musste, um sich zu erholen.
Ein Kindermädchen, das vorübergehend den Haushalt und den kleinen Richard besorgt hatte, erzählte später über Orwells damaligen Gesundheitszustand:
«Ich wusste nicht, dass er eigentlich Tuberkulose hatte, bis ich ihn eines Nachts bei einem Anfall ertappte. Blut schoss aus Mund und Nase, er quälte sich schrecklich. Aber am nächsten Morgen war es vergessen, er arbeitete wieder, als wäre nichts geschehen. Er klagte nie.»
Auf Jura setzte Orwell die Arbeit an seinem Roman fort. Ende Mai 1947 schrieb er seinem Verleger: «Ich habe jetzt ungefähr ein Drittel. Ich bin nicht ganz so weit, wie ich gehofft hatte, weil es um meine Gesundheit recht elend steht. Anfang 1948 könnte das Buch vollendet sein – wenn nicht wieder die Krankheit dazwischenkommt. Ich rede nicht gern über Bücher, bevor sie geschrieben sind. Es ist eine Art Phantasie, aber in Form eines naturalistischen Romans.»
Im Sommer ging es ihm besser. Aber er fühlte sich einsam, darin hatte sich nichts geändert. Er bekam oft Besuch, doch die Frau, die er liebte, besuchte ihn nicht. Sie hiess Sonja Brownell, und schon im April, kurz nach seiner Ankunft, hatte er ihr geschrieben und sie vergeblich gebeten, zu kommen:
«Das Zimmer, das du hier hättest, ist zwar sehr klein, aber du hättest Aussicht aufs Meer. Das Haus ist jetzt recht komfortabel. Bei gutem Wetter könnten wir mit dem Motorboot zu den unbewohnten Buchten an der Westküste von Jura fahren, wo es wunderbar weissen Sand hat und klares Wasser und Seehunde, die sich darin tummeln. In einer der Buchten gibt es eine Höhle, wo wir bei Regen Schutz finden würden... Jedenfalls komm, wann immer du willst und solange du willst. Ich wünsche mir so sehr, dass du da wärst.»
Ende Oktober hatte er die Rohfassung von «1984» beendet – bis auf das letzte Kapitel. Wollte er den Schluss noch offenlassen? Gab er Winston und Julia trotz allem noch eine Chance? – Zuletzt hatte Orwell im Bett schreiben müssen, so krank war er schon. Er fühlte sich nicht einmal mehr imstande, nach Glasgow zu einem Lungenspezialisten zu reisen. Dennoch beschloss er, diesmal den Winter auf Jura zu verbringen. Einem Freund schrieb er: «Ich kann hier ungestörter arbeiten, und ich glaube, das Klima ist milder als in England. Es ist hier oben auch einfacher, Heizöl zu bekommen.»
Noch im November erwog er ernsthaft, ein Angebot der Zeitung «Observer» anzunehmen und nach Südafrika zu reisen, um über die dortigen Wahlen zu berichten. Einen Monat später, am Heiligen Abend 1947 wurde er in eine Klinik in Glasgow eingeliefert. «1984» war unvollendet. In einem seiner ersten Briefe aus der Klinik gestand Orwell:
«Ich wusste schon lange, wie krank ich war, aber ich suchte nie einen Arzt auf, weil ich mit meinem Roman vorankommen wollte. Und jetzt sitze ich im Spital und habe erst die Rohfassung des Romans, was bei mir etwa dasselbe ist, als hatte ich noch nicht einmal angefangen.»
*
Der Weg will kein Ende nehmen, die Füsse tun mir weh, die Knie werden weich. Mindestens 30 Kilometer bin ich schon gelaufen. Der Karte nach zu schliessen, sind es noch sechs Kilometer bis Barnhill. Den letzten Bauernhof, Kinuachdrach, habe ich hinter mir gelassen. Dort holte Orwell jeweils die Milch, Käse und Brot. Den Weg bewältigte er mit einem Motorrad, später mit seinem Jeep. Die Fahrt muss beschwerlich gewesen sein. Der Weg ist schmal, uneben, mit groben Steinen und Wurzeln durchsetzt, er führt durch unwegsamen, verwilderten Wald, und ich muss daran denken, dass ein Tier, wenn es todkrank ist, sich in die dunkelste Ecke des Waldes zurückzieht.
Einmal bleibe ich stehen und überlege, ob ich umkehren soll. Doch etwas in mir treibt mich weiter.
Orwell kämpft um sein Leben
Als sie ihm die Schreibmaschine wegnahmen, begann er von Hand zu schreiben. Doch er merkte bald, dass er zu krank war, um an seinem Roman weiterzuarbeiten. Mehr als ein paar kurze Zeitungsartikel lagen nicht drin. Seinem Verleger meldete er: «Vielleicht bringe ich den Roman doch noch bis Ende des Jahres fertig. Im jetzigen Zustand ist er ein grässliches Gewurstel, aber die Idee ist so gut, dass ich sie nicht fallenlassen kann. Falls mir etwas zustossen sollte, habe ich meinen Nachlassverwalter gebeten, das Manuskript zu vernichten, aber ich glaube nicht, dass es soweit kommen wird. In meinem Alter ist Tuberkulose nicht so gefährlich, und die Ärzte sagen, die Heilung gehe gut voran, wenn auch langsam.»
Orwell schien zuversichtlich, und vielleicht liess er das Ende des Romans immer noch offen. Die Ärzte probierten ein neues Medikament aus den USA an ihm aus, Streptomycin, und Orwell fühlte sich tatsächlich besser. Doch dann traten unerwartet starke Nebenwirkungen auf: Die Haare und Nägel fielen ihm aus, er bekam einen Ausschlag am ganzen Körper, der Hals schwoll an, und in der Rachenpartie entstanden kleine Geschwüre. An der Stelle in «1984», wo Orwell beschreibt, wie sein Romanheld Winston nach der Folter aussieht, beschrieb er sich selbst: «Die Wangen waren zerschunden, der Mund eingefallen, die Rippen seines Brustkorbes zeichneten sich so deutlich ab wie bei einem Skelett...»
Das einzige, was Orwell schliesslich noch fertigbrachte, war ein Tagebuch mit exakten Beschreibungen seiner Krankheitssymptome. Aber in den wenigen kurzen Briefen, die er an Freunde schrieb, erwähnte er die Nebenwirkungen nicht. Und als er wegen einer Infektion mit der rechten Hand nicht mehr schreiben konnte, lernte er sofort mit der linken Hand schreiben. Er konnte es nicht lassen. Er durfte es auch nicht lassen. Als hätte er längst gespürt, dass er an einem Vermächtnis schrieb.
Im Mai 1948 ging es ihm etwas besser, und er erhielt seine Schreibmaschine zurück. Ende Juli wurde er aus der Klinik entlassen und konnte nach Barnhill zurückkehren – mit der ärztlichen Auflage, ein Leben als Invalider zu führen. In einem Brief an einen Freund erzählte er: «Ich habe mich daran gewöhnt, mit der Schreibmaschine im Bett zu schreiben, obwohl es eigentlich völlig unbequem ist. Ich kämpfe noch immer mit den letzten Abschnitten meines verdammten Buches...»
Den ganzen Oktober schrieb und korrigierte er, arbeitete konzentrierter denn je und dachte nicht daran, sich wieder in ärztliche Behandlung zu begeben. Wenn ihn die Schmerzen zu sehr peinigten, legte er sich in seinem Bett zurück, verharrte so einen Moment, um sich dann wieder aufzurichten und weiterzumachen. Ende Oktober kam das Ende in Sicht – endlich schrieb Orwell die letzten Abschnitte des Buches, die er doch so lange vor sich hergeschoben hatte: Das Schicksal seines Romanhelden Winston war besiegelt.
An einem der ersten Novemberabende sassen Orwells Schwester Avril und ihr Ehemann Bill, ein Bauer, den sie auf der Insel kennengelernt hatte, unten in der Stube, als sie Orwell die Treppe herabkommen hörten. Er trat ein, erschöpft, hohlwangig, ein Totenkopf, ging zum Schrank und holte die letzte Flasche Wein hervor.
«Ich hab’s geschafft», sagte er und entkorkte die Flasche.
Er füllte die Gläser, und sie tranken auf «1984». Avril und Bill wussten so gut wie nichts über das Buch, denn Orwell hatte mit ihnen kaum je darüber gesprochen. Aber das war jetzt unwichtig. Sie feierten. Nach den ersten Schlucken stand Orwell plötzlich wieder auf. Er zitterte und musste sich hinlegen. Das Buch hatte ihn fertiggemacht.
«Ich kann das Manuskript so nicht abschicken», schrieb er an seinen Verleger, «es ist in einem unglaublich schliechten Zustand. Man muss es ins Reine schreiben, aber ich muss dabei sein. Weisst Du nicht eine Sekretärin, die bereit wäre, für vierzehn Tage hierherzukommen?»
Fred Warburg, der Verleger, suchte vergeblich. Niemand schien bereit zu sein, die beschwerliche Reise nach Jura in Kauf zu nehmen. Während Warburg noch weitersuchte, hatte Orwell bereits beschlossen, das ganze Manuskript selber abzutippen.
Den ganzen Monat November tippte er, manchmal am Tisch, meistens im Bett. Er benützte einen schlecht isolierten Ölofen, der das ganze Zimmer verqualmte, und er begann wieder Zigaretten zu rauchen, eine nach der anderen. Für das Abtippen brauchte er fast einen Monat. Am 4. Dezember schickte er die Reinschrift nach London. Gleichzeitig sandte er einen Brief an einen Freund mit der dringenden Bitte, ein Sanatorium für ihn zu finden.
«Es freut mich, dass dir das Buch gefällt», schrieb Orwell später an seinen Verleger, «ich selber bin nicht zufrieden mit dem Resultat, aber auch nicht völlig unzufrieden. Ich glaube, die Idee ist gut, doch die Ausführung wäre besser herausgekommen, wenn ich nicht TB hätte. Ich würde nicht auf eine hohe Auflage wetten, aber ich nehme an, 10’000 Exemplare könnten wir verkaufen... Über den Titel bin ich mir noch unschlüssig. Ich schwanke zwischen ‹The last man in Europe› und ‹1984›.»
Warburg, der Verleger, zögerte keinen Moment: «1984» sollte der Titel des Buches sein. «1984» war die Umkehrung der Jahreszahl 1948. Die ganze Stimmung in Orwells Roman, die ganzen Beschreibungen und Details, dies alles war geprägt vom England der ersten Nachkriegsjahre.
«1984» und 1948
Anthony Burgess, ein englischer Schriftsteller, der Autor von «Clockwork Orange», war damals ein junger Mann. In seinem späteren Buch «1985 – eine kritische Auseinandersetzung mit Orwells ‹1984›» schreibt Burgess: Um «1984» zu würdigen, müsse man sich daran erinnern, wie es 1948 gewesen war. In Grossbritannien regierten erstmals die Sozialdemokraten. Aber die Stimmung im Volk war gedämpft.
«Es herrschte», so schreibt Burgess, «ein Gefühl von schmieriger Unsauberkeit, von Überdruss und Mangel. Der Krieg war seit drei Jahren zu Ende, und wir vermissten die Gefahren – zum Beispiel die deutschen V-Waffen. Man kann Entbehrungen ertragen, wenn man den Luxus der Gefahr hat. Aber nun litten wir grösseren Mangel als während des Krieges, und es schien von Woche zu Woche schlimmer zu werden. Die wöchentliche Fleischration war auf ein paar fettige Schnitten Corned Beef zusammengeschrumpft. Gekochter Kohl war das Hauptnahrungsmittel. Zigaretten waren nur beschränkt erhältlich und immer nur die gleiche Marke. Rasierklingen waren vom Markt verschwunden.
In Orwells Roman kann Winston den Lift zu seiner Wohnung nicht nehmen, weil der Strom abgeschaltet wurde – das waren wir damals alle gewohnt. Und überall sah man noch die Auswirkungen der deutschen Bombardierungen. London war eine heruntergekommene, müde Stadt am Ende eines langen Krieges... All das lässt sich bei Orwell nachlesen. Winstons Frustrationen waren auch die unsrigen – schmutzige Strassen, verfallende Gebäude, widerwärtiges Essen in Kantinen, und die Schlagworte der Regierung an den Wänden.»
Orwell wünscht sich starken englischen Tee
«1984» erschien im Juni 1949 und war sofort ein Bestseller, in Grossbritannien, in den USA und später auch in Westeuropa. Vor allem in den USA wurde das Buch als anti-sozialistisches Werk gefeiert. Orwell, der diese Interpretation nie gewollt hatte, sah sich zu einer Stellungnahme gezwungen. Von seinem Krankenbett in einem südenglischen Sanatorium schrieb er:
«Mein Roman darf nicht verstanden werden als genereller Angriff auf den Sozialismus oder auf die britische Labour-Party (die ich unterstütze), sondern ich wollte aufzeigen, zu welchen Perversionen ein zentralistisches System führen kann, wie es teilweise schon verwirklicht wurde im Kommunismus und im Faschismus. Ich glaube nicht, dass es die Gesellschaft, die ich beschreibe, eines Tages geben wird, aber ich glaube, dass es etwas Vergleichbares geben könnte. Überall auf der Welt haben sich totalitäre Ideen in den Köpfen von Intellektuellen festgesetzt, und ich habe versucht, diese Ideen logisch zu Ende zu denken...»
Orwell begann auch sein eigenes Leben bis zum Ende zu denken. Er hatte die Idee für ein neues Buch, aber er wusste, er würde es nicht mehr schreiben können. «Ich habe höchstens dann noch eine Überlebenschance», schrieb er in einem Brief im Mai 1949, «wenn ich mich während längerer Zeit jeder Arbeit enthalte. Ich würde das in Kauf nehmen, wenn ich dafür nachher noch einige Jahre schreiben könnte.»
Einige Jahre. Mehr gab er sich nicht mehr.
Bereits im Januar 1949 war er ins Sanatorium eingeliefert worden. Im Juli verschlechterte sich sein Zustand derart, dass er in eine Londoner Klinik überführt werden musste. Er sorgte sich um seinen Sohn Richard. Er hätte ihn so gern bei sich gehabt, aber er wusste, dass es nicht ging. Zu einem Freund sagte er: «Kinder können Krankheiten nicht verstehen. Einmal fragte mich Richard, als er bei mir war: Wo hast du dich denn verletzt?»
Sonja Brownell, die Frau, für die Orwell soviel empfand, besuchte ihn immer häufiger im Spital. Er wollte sie heiraten. An seinen Verleger schrieb er im August: «Ich glaube, ich könnte länger leben, wenn ich wieder verheiratet wäre.» Sonja, damals 31-jährig, willigte unverhofft ein, und am 13. Oktober wurde das Paar im Krankenzimmer getraut. Die ungewöhnliche Trauzeremonie wurde kurz gehalten, um Orwell nicht zu ermüden. Die Flitterwochen wollte das Ehepaar in einem Sanatorium in der Schweiz verbringen. Die Höhenluft würde dem Schwerkranken vielleicht helfen. Orwell freute sich auf die Reise:
Am 22.Januar 1950 war der Flug gebucht.
In den letzten Tagen vor der Abreise wurde Orwell von vielen seiner Freunde besucht. Sie wünschten ihm gute Reise und gute Besserung. Orwells Schwester Avril, die jetzt mit ihrem Ehemann und dem kleinen Richard ständig auf Jura lebte, kam extra nach London, damit Richard sich von seinem Vater verabschieden konnte. Der Kleine redete bereits im Dialekt der Inselbewohner. Orwell hörte das nicht unbedingt gerne, denn er legte nach wie vor Wert auf eine gute, englische Aussprache. Einen seiner Freunde fragte er mit gespielter Besorgtheit, ob es auch in der Schweiz starken englischen Tee gebe? – Ohne starken englischen Tee hätte sich Orwell das Leben nicht vorstellen können. In der Nacht vor seiner Abreise in die Schweiz erlitt er eine Lungenblutung. Niemand war bei ihm, als der Tod eintrat. Er starb allein.
Bis zuletzt hatte Orwell geglaubt, sein Verleger, Fred Warburg, finde «1984» ein aussergewöhnliches Buch. Das war nur die halbe Wahrheit. Unmittelbar nach der ersten Lektüre des Romans, im Dezember 1948, hatte Warburg für seine Verlagsmitarbeiter einen internen Kommentar verfasst, den Orwell nie zu Gesicht bekommen sollte. Warburg schrieb:
«Dieses Buch gehört zu den grauenhaftesten Büchern, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Orwell erlaubt dem Leser nicht das geringste Kerzenlicht von Hoffnung. Das ganze Werk ist geprägt von einem uneingeschränkten Pessimismus. Es ist eine bewusste und böswillige Attacke auf den Sozialismus und die sozialistischen Parteien. Orwell scheint mit dem Sozialismus, wie man ihn kennt, endgültig gebrochen zu haben.»
«So ein Buch kann nur jemand geschrieben haben, der jede Zuversicht verloren hat. Es ist ein starkes Buch, und es sollte so rasch wie möglich veröffentlicht werden. Aber ich persönlich hoffe, nie mehr ein solches Buch lesen zu müssen.»
Die Begegnung
Der Wald lichtet sich, ich trete auf eine Weide hinaus. Auf dem Weg kommt mir ein Pferd entgegen, geht an mir vorüber, schaut mich an, ein zweites Pferd steht am Wegrand, ein drittes und viertes stehen abseits, und sie alle gucken, wie ich des Weges komme, an all diesen Pferden und Schafen und Ziegen vorbeikomme, die da friedfertig und selbstverständlich beisammen stehen, als gehörten sie niemandem ausser sich selbst. Wo gibt es hier Menschen? Ich setze meinen seltsamen Weg fort, spüre den Wind auf der Haut, spüre das Salz auf den Lippen und entdecke endlich das Meer zwischen den Hügeln: die Nordspitze der Insel ist nicht mehr weit. Der Weg beschreibt eine Kurve und dahinter, da ist es. Barnhill, Orwells Haus.
Ganz allein für sich liegt es da, ein ansehnlicher, weissgestrichener Bau mit angebauter Scheune, mit einem steilen Giebeldach und drei Schornsteinen. Jetzt, wo ich näherkomme, sehe ich auch den Garten vor dem Haus. Hier, wo heute das Unkraut wuchert, hat Orwell sein Gemüse angepflanzt, in diesem Haus hat er gelebt, geschrieben, gelitten: Ich bleibe stehen, respektvoll, fast etwas ehrfürchtig, höre nichts als den Wind und bin allein mit diesem schweigsamen, einsamen Haus, das schon lange nicht mehr bewohnt wird.
Orwells Schwester und ihr Mann, die nach Orwells Tod in Barnhill wohnten, sind längst auf das Festland gezogen, zusammen mit Orwells Adoptivsohn Richard, der heute in Birmingham lebt und Traktoren verkauft. Orwells Haus, erzählte mir Roddy, der Schullehrer, wird heute nur noch als Jagdhaus benutzt, als gelegentliche Absteige für Rotwildjäger. Die meiste Zeit steht das Haus leer.
Ich trete näher, schaue durch die spinnwebenverhängten Fenster ins Innere: Alles noch wie früher, so scheint es, alte Möbel, ein alter Kochherd, eine Petroleumlampe auf dem Küchentisch. Ich gehe von Fenster zu Fenster, drücke meine Nase platt, aber mehr gibt es nicht zu entdecken, nichts Auffälliges, nichts Lebendiges. Mir kommt ein Lied in den Sinn: Das alte Haus von Rocky Docky hat vieles schon erlebt... Ich singe das Lied leise vor mich hin, während ich meinen Rundgang fortsetze. Doch ganz geheuer ist mir nicht mehr zumute. Der Wind pfeift, jeder Windstoss macht die Fensterscheiben zittern, und irgendwo hinter dem Haus schlägt eine Türe auf und zu. Bald wird es dunkel werden.
Die Haustür ist geschlossen, aber ich entdecke einen Hintereingang, der sich öffnen lässt. Erstaunt, unsicher trete ich ein, taste mich im trüben Licht langsam vor, bis ich die Küche finde. Ich bleibe stehen, ich horche, und wieder höre ich nichts als den Wind, der dem alten Haus bis ins Innerste fährt. Im Wohnzimmer stehen noch immer die Betten, die Orwell im Sommer für seine Gäste bereithielt; im Winter wurde der Raum wenig benutzt, da er nur notdürftig heizbar war. Das Leben spielte sich vorwiegend in der Küche ab. Aber nirgends sind Spuren von Orwell zu finden, kein Buch im Gestell, kein Bild an der Wand, kein einziges Lebenszeichen von ihm.
Im ersten Stock sind die Schlafkammern, eine steile Holztreppe führt hinauf: Wann ist sie wohl das letztemal begangen worden? Ich steige nach oben, immer noch vorsichtig, leise, als könnte ich jemanden stören. Die erste Türe rechts. Ein winziges Zimmer, ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl und das Fenster. Das zweite Zimmer nicht grösser, das dritte auch nicht. Vorne, am Ende des Gangs, eine vierte Tür.
Ich trete in einen etwas grösseren Raum mit einem breiten Tisch und zwei Stühlen. In der Ecke beim Fenster ein Ölofen. Das Bett hinter der Türe sehe ich nicht sofort. Orwell schaut mich an, als habe er mich erwartet. Er sitzt aufrecht im Bett, so wie ich ihn mir vorgestellt habe, auf den Knien die Schreibmaschine, das Blatt immer noch eingespannt. Er wirkt krank und abgezehrt, aber zu meinem Erstaunen stelle ich fest, dass er nicht viel älter