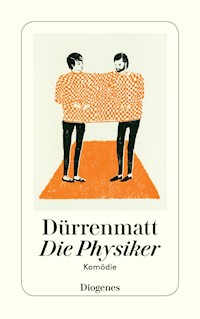Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: net-Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die deutsche Teilung hat im Osten einen besonderen kulturellen Ort mit ihm eigenen Tönen geschaffen; Tönen der Anpassung, des Widerstands, Durchblicks, der Vorausschau. Sie sind nicht verklungen. Wer sie aufnimmt, spürt heute vor allem den beklommenen Atem einer gefährdeten Gemeinschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 94
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
OST-TON
Bernd Rößger
OST-TON
Bernd Rößger
Ostdeutsches Sein in Prosa und Vers
(1961 – 2023)
Alle Rechte, insbesondere auf digitale Vervielfältigung, vorbehalten.
Keine Übernahme des Buchblocks in digitale Verzeichnisse, keine analoge Kopie ohne Zustimmung des Verlages.
Das Buchcover darf zur Darstellung des Buches unter Hinweis auf den Verlag jederzeit frei verwendet werden.
Eine anderweitige Vervielfältigung des Coverbildes ist nur mit Zustimmung des Verlages möglich.
Alle im Buch vorkommenden Personen, Schauplätze, Ereignisse und Handlungen sind frei erfunden.
Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Ereignissen sind rein zufällig.
www.net-verlag.de
Erste Auflage 2023
© Text: Bernd Rößger
© net-Verlag, 09117 Chemnitz
© Coverbild: Jenny Kaya-Schneider
Covergestaltung: net-Verlag
Illustationen: Pixabay
Fotos: Bernd Rößger
printed in the EU
ISBN 978-3-95720-386-1
eISBN 978-3-95720-387-8
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Erinnern
Janusz Korczak
Die Dresdner Niobe
Tantalos
Madonnenlächeln
Die abendlichen Julihimmel tun in Städten
An dich
Bevor ihr eure Rosen …
Komm
Der späte Abendwind, der Hund …
Wie sind deine Wimpern verhangen …
Rastlos sein bot manches Glück mir, …
Deiner Brüste weiße Firnen
Herbstes Kühle ging durch meine Jahre, …
Karl-Marx-Städter Frühling 72
Reicht ins Dunkel Hände, …
Vorahnung 61
Billigung des sich Begnügens
Aus Zweifel am Zweifel
Aufbruch – Legende
Odysseus’ Irrfahrt zu den Sirenen
Ophelia
Hölderlin
Fatales Quartier
Die duldsamen Schläfer
Frühe Muster
Kain
Vorläufige Bilanz
Da sein
Ahrenshoop
Für Jutta
Spätes Radebeul
Wollet nicht verzagen, …
Anhang 1: Morus und Francis
Anhang 2: Dresdener Thesen zur demokratischen Selbstermächtigung (2017)
Dank
Über den Autor
Vorwort
Das poetische Verständnis der Welt schaut mit seinen eigenen Augen und geht seine eigenen Wege. Mit dem Politischen und seinen oft ausschließenden Erzählungen verbindet es eine anhaltende Skepsis. Nicht, dass es so dem Politischen auswiche. Im Gegenteil.
Aber das Poetische, will es selbst ein Schöpferisches sein, braucht einen weiten und offenen Raum. Von da aus stellt es seine Fragen. Und immer geht es ihm dabei um ein Verbundensein, um gemeinsam Gewolltes und Erlittenes, um zu Teilendes und zu Heilendes. Es stemmt sich gegen das immer wieder in uns aufgerufene Wölfische wie auch gegen jedwede blinde Hingabe an fragwürdige Erneuerer, sondern verlässt sich vielmehr auf unseren wachen Geist und ein Ur-Menschliches, nämlich das tief in uns verankerte Vermögen zu sinnvollem gemeinschaftlichem Tun.
Das Leben der Ostdeutschen wird seit ihrer politisch verfügten Separation von den widersprüchlichen Sehnsüchten sowohl des Realen als auch des Möglichen geprägt, von ihrer Vergeblichkeit und immer auch von ihren Verheißungen. Die folgenden Texte könnten ein Beleg dafür sein.
Erinnern
Es sind die Lieder all
die früh gesungenen
und längst verklungenen,
die ferne steigen in den
Sommertag;
die bunten Bänder,
wehenden Gewänder,
die weithin mit uns flogen
durch die Blütenauen
unterm Finkenschlag.
Es sind die Lasten,
die so ungelenk gefassten
und doch getrag’nen
durch die Zeiten
fern und rar.
Die einstens kühnen Lüste,
nach denen keiner fragt mehr,
wer sie denn noch wüsste,
wohin sie schwanden.
Ob sie jemals wahr?
Wie wir auch wenden
mit erkaltenden Händen
der Gluten Fülle:
Alles wird Stille.
Aber auch
ein währendes Raunen
aus stummen Stimmen,
im gehenden Licht
ein funkelndes Glimmen,
so wie ein allerletzter
Abendhauch.
Janusz Korczak
Einst waren zweihundert Waisen
im Warschauer Ghetto daheim,
die hatten Jan Korczak zum Vater
und waren seitdem nicht allein.
Er lebte mit ihnen ein Leben,
das voll Mut und Liebe war.
So brauchten sie nichts entbehren,
denn Brot war zu jener Zeit rar.
Am fünften August zweiundvierzig
kam der Marschbefehl ins Gas.
Jan war Empfänger und Bote:
Wie sag ich es ihnen? Und was?
Er sprach von einer Reise
aus des Ghettos karger Zeit
und deren schönem Ende,
dem Ende fast allen Leids.
Sie gaben ihm all ihr Vertrauen
wie sie’s taten all die Tage zuvor
und standen im Morgengrauen
in Viererreihen am Tor
und gingen voll Gottvertrauen
den Weg, den der Henker wies,
und all ihre letzten Stunden,
die der Herrgott ihnen noch ließ.
Da war ein kleiner Junge,
der den Schlaf schwer überwand,
lief immer noch trunken und stolpernd
ganz sicher an Janucz’ Hand.
Da drängte sich eine Mutter
ganz wichtig nehmend ins Glied:
Fast hätte ich sie vergessen,
meine Puppe, die muss doch mit!
Sie wurden getrieben durch Warschau
zum Umschlagplatz voran,
vorweg ihre Fahne der Hoffnung,
dahinter Stefania und Jan.
Am Umschlagplatz aber hieß es
beim Einsteigen in den Waggon:
Wir wollen nur deine Kinder,
dir geben wir noch Pardon.
Wie könnt’ ich sie von mir lassen?
Wie könnte ich stehen und sehn?
Wie könnten sie je auf mich bauen?
Wie könnte ich fortbestehn?
Wie mag er gesprochen haben
in die Herzen so schwer wie Stein,
wie viele Tränen getrocknet
bis in das Gas hinein?
Im Sommerblau über Treblinka
steht manchmal ein Gesicht,
das eines lieben Vaters.
Die meisten sehen es nicht.
Die Dresdner Niobe
Da, wo längs der geräumigen Flussaue gefällig ein Hang ansteigt und sich in sanfter Rundung zu einem kaum beachteten Hügel hinaufzieht, der dann jedoch ganz überraschend, gerade so, als müsse einem der Atem stocken, den Blick auf die herrliche Stadt freigibt, an diesem nämlichen Ort waren die beiden zusammengetroffen; die Mutter und jene Frau, deren seltsame Verwandlungen der Mutter lange Zeit nicht aus dem Kopf gehen wollten.
Dabei konnte zumindest von Seiten der Frau nicht gesagt werden, dass sie die Begegnung mit der anderen gesucht hätte.
Nein, sie allein, die ermattete Mutter, hatte diese Begegnung gesucht, ja, geradezu gebieterisch gefordert; angefangen mit einem energischen Läuten am Tor einer großzügig angelegten Villa. Schon als sie diese zum ersten Mal erblickt hatte, eindrucksvoll auf dem Scheitel des Hangs platziert, mit einer breit nach oben führenden Treppe, einem geradezu pompösen Säulenportal und einladenden seitlichen Balkonen, gleichsam über allem stehend und wohl für vieles nicht ohne Weiteres erreichbar, war ihr sekundenschnell der Gedanke gekommen, hier müsse er zu finden sein, jener Ort, nach dem sie bisher vergeblich gesucht hatte. Könnte er sie bergen? Könnte sie hier endlich ruhen? Und schon stockte ihr Schritt.
Als ihr vor Wochen in ihrem fern im Osten gelegenen Dorf zum ersten Mal zu Ohren gekommen war, dass der im gegenwärtigen Krieg von allen herbeigesehnte Sieg sich noch etwas hinausschieben würde; neue Fronten, nun ganz in ihrer Nähe, seien unumgänglich, dazu bedürfe es eines freien Kampffeldes, sie müssten unverzüglich gehen, hatte sich mitten in ihrem tiefen Erschrecken eine schwer erklärbare Hoffnung breitgemacht, nämlich auf einen Ort gerichtet, den sie nicht kannte, aber an dem wohl alles gut werden würde.
Plötzlich war unter ihnen, die da erregt und verängstigt durcheinandersprachen, der Name jener Stadt aufgekommen, deutlich bevorzugt vor anderen Städten, überhäuft sogleich von fantastischen Zuversichten. Die Stadt sei so unsagbar schön, dass man sie wohl nicht angreifen würde, nicht angreifen könne; ihre Anmut und Schönheit verböten dies einfach. Ja, dort würden sie sicher sein.
Und so war in ihr eine unerschütterliche Hoffnung gewachsen und hatte so stark von ihr Besitz ergriffen, dass sie geradezu leichten Herzens zu gehen vermochte, und aufbrach mit ihrem halbwüchsigen Sohn. Das war, wie gesagt, vor Wochen gewesen. Nun standen sie hier.
Doch als sich nach ihrem energischen Läuten weit oben überaus zögernd eine Tür auftat und jene Frau sehr langsam heraustrat, zunächst, um sich fröstelnd zu schütteln und umständlich in einen weiten, karierten Mantel zu werfen, und sich dann ganz ohne Eile die lange Treppe herabließ, eben zu ihr, der geduldig Wartenden, da befiel die Mutter ein erster Zweifel, ob ihr energisches Läuten ihren Erwartungen überhaupt dienlich gewesen sein könnte. Doch es ging ja nicht anders.
Und wie war sie doch, das spürte sie bei jedem Schritt, unendlich müde geworden. Und hinzu waren jene Wellen von siedender Angst um den Sohn gekommen, den ein tagelanges hohes Fieber niedergestreckt hatte.
Nun sprach er nicht mehr, vermochte nicht zu gehen. Ganz dringend brauchte er Ruhe. Da saß er, unruhig und seltsam verkrampft in dem klapperigen Wägelchen, ihr Bündel zwischen den leblosen Beinen. Das alles zog sie hinter sich her.
Die Frau aber dachte beim Abwärtssteigen: Fast eine Ewigkeit ist es her, dass ich hier hinuntergestiegen bin. Das spüre ich. Gewiss, meine Söhne, sie haben es gut gemeint, als sie mir sagten, ich solle oben bleiben, ich solle mich nicht darum kümmern, was sich seit Wochen vor meinem Haus tut, hier unten auf dieser Straße, was sich da vorbeischiebt, der Treck, wie sie ihn nennen; es würde meinem Alter nicht zuträglich sein.
Meinem Alter!
Aber meiner Stadt?! Überhaupt verstehe ich nicht, was diese Leute antreibt. Dass sie in Scharen davonlaufen, wo doch so heldenhaft gekämpft wird. Wie aus einem Guss, heißt es doch, sollen wir zusammenstehen. An jedem Ort. Dass sie sich nicht schämen.
Endlich ist die Frau unten angekommen; auf den näheren Blick eine ältliche, strenge Matrone, möglicherweise etwas herrisch, so scheinen es ihre schmalen, entschlossenen Lippen zu verheißen.
Sie nimmt die Mutter in den Blick. Was sie denn wolle?
»Einen Platz …«, hebt die Mutter zu sprechen an, erschrickt aber sogleich über ihre demütige, fast fremde Stimme, die sich ihrer in den letzten Tagen schon mehrfach bemächtigt hatte, und verstummt beschämt.
Ohnehin hätte sie nicht weitersprechen können, denn die Frau schneidet ihr brüsk jedes weitere Wort ab: »Ich habe schon eine Einquartierung.«
Und wie zu deren Bestätigung erscheint weit oben auf dem wohl obersten Treppenabsatz ein scheinbar mit sich ganz allein beschäftigtes, ganz nach mutwilligen Wechseln tanzendes und zappelndes Mädchen in einem viel zu dünnem Mäntelchen, blickt mit einem Mal überrascht und neugierig herunter, übersieht die unwirschen Gesten der Frau, sie solle sich gefälligst ins Haus begeben, und kommt die Treppe herabgesprungen. Sogleich nähert es sich dem Jungen und kniet bei ihm nieder. Der Junge, in offener Freude an ihrer Begegnung, begrüßt sie ungestüm mit gurgelnden Lauten.
»Kann er nicht sprechen?«, wendet sich das Mädchen verwundert an die Mutter.
»So war er nicht immer«, entgegnet ihr die Mutter, »erst seit Kurzem, seit einem Fieber. Auf dem Weg hierher.«
Das Mädchen fasst seine Hand.
Hierher! Auf dem Weg hierher!, empört sich im Innersten die Frau und denkt: als seien sie nun da! Es ist eine Schande. Und verärgert spricht sie: »Geh ins Haus, Aloisia!«
»Ich hole ihm einen Apfel«, sagt das offensichtlich schwerhörige Mädchen, und schon springt es die Treppe hinauf.
Wie zu erwarten, richtet die Mutter nun einen fragenden Blick auf die Frau.
»Meine Nichte«, fängt sie den Blick auf.
Das nennt die Einquartierung, denkt die Mutter; die eigene Familie. Aber gut, das hier ist nichts als ein Versuch. Soll der Junge den Apfel haben. Was dann noch wird? Sonst gehen wir einfach. Da kommt bereits das spillrige Mädchen mit gewagten Sprüngen wieder nach unten gestürmt. Seine wilde Rückkehr versetzt den Körper des Jungen in heftige, pendelnde Schwünge und schraubende Bewegungen, und als ihm Aloisia nun den Apfel reicht, greift er mit einer überstürzten Armbewegung grob daran vorbei.
Die Mutter sieht es voll Kummer.
Doch Aloisia hält ihm nun geduldig den Apfel vor den Mund.
Vom Kinn des Jungen tropft es. Immerhin vermag er ihn nun, mit den Zähnen zu fassen.
»So ist es gut«, flüstert Aloisia.
Wie widerlich, wie tierisch, denkt die Frau und wendet sich ab. Wenn ich mir meine gelungenen Söhne vorstelle, keiner von ihnen hat das. Sie blickt mit unverhohlenem Abscheu auf den geifernden, sabbernden Idioten.
Und als gerade jetzt die Mutter diesen Blick bemerkt, springt er sie ungestüm an.
»Geh in die Stadt«, spricht die Frau, »zum Bahnhof! Frage dich durch! Dort stehen Züge für euch bereit.«
»Züge? Welche Züge?«, stammelt die Mutter. »Weshalb?«
»Dass ihr weiterkommt!«