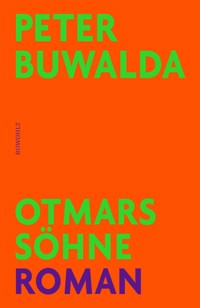
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Mit dem, was Psychiater für ein stattliches Honorar Vatersuche nennen, hat es nichts zu tun" – so beginnt dieser Roman, und tatsächlich: Ludwig Smit, Stiefbruder eines genialen, aber wunderlichen Klaviervirtuosen und Beethoven-Interpreten, dessen Vater Otmar auch ihn großgezogen hat, sucht seinen leiblichen Vater nicht. Aber als der junge Shell-Angestellte, zuständig für die umstrittene Vermessung von Erdölfeldern per Dynamit, auf die sibirische Insel Sachalin reist, um dort den Geschäftsführer der Firma Sakhalin Energy zu treffen, kommt ihm der Verdacht, dass dieser Johan Tromp möglicherweise sein Vater ist, der ihn schon im Stich gelassen hat, als er noch gar nicht geboren war. Völlig unverhofft, nämlich in einem Schneesturm, begegnet er in diesem fernen Winkel Russlands einer früheren Mitbewohnerin wieder, der Journalistin Isabelle Orthel, die, wie sich herausstellt, mit Tromp vor Jahren in Nigeria eine Affäre hatte und nun den Plan verfolgt, diverses Dunkle ans Licht zu zerren. Bislang kam Tromp – Hedonist, Alpha-Mann, Kronprinz von Shell – immer einfach so davon. Nach seinem fulminanten Debütroman "Bonita Avenue", von der ZEIT als "große europäische Kunst" (DIE ZEIT) gefeiert, schreibt Peter Buwalda nun also weiter an seinem stilistisch meisterhaften literarischen Universum – mit nicht weniger als einer Trilogie, deren erster Teil "Otmars Söhne" ist. Wieder geht es um Familie und die Bruchstücke davon, um abwesende Väter und Stiefväter, um Identität und Verantwortung, um persönliche Versäumnisse, Sexualität und Schuld – das unübersichtlich gewordene Leben in heutiger Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 819
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Peter Buwalda
Otmars Söhne
Roman
Über dieses Buch
«Ungeheuer fesselnd, handwerklich grandios und verblüffend. Ein Wunder der Erzählkunst.» NRC Handelsblad
«Mit dem, was Psychiater für ein stattliches Honorar Vatersuche nennen, hat es nichts zu tun» – so beginnt dieser Roman, und tatsächlich: Ludwig Smit, Stiefbruder eines genialen, aber wunderlichen Klavier- und Beethoven-Virtuosen, dessen Vater Otmar auch ihn großgezogen hat, sucht seinen leiblichen Vater nicht. Aber als der junge Shell-Angestellte, zuständig für die umstrittene Vermessung von Erdölfeldern per Dynamit, auf die sibirische Insel Sachalin reist, um dort den Geschäftsführer der Firma Sakhalin Energy zu treffen, kommt ihm der Verdacht, dass dieser Johan Tromp möglicherweise sein Vater ist, der ihn schon im Stich gelassen hat, als er noch gar nicht geboren war. Völlig unverhofft, nämlich in einem Schneesturm, begegnet er in diesem fernen Winkel Russlands einer früheren Mitbewohnerin wieder, der Journalistin Isabelle Orthel, die, wie sich herausstellt, mit Tromp vor Jahren in Nigeria eine Affäre hatte und nun den Plan verfolgt, diverses Dunkle ans Licht zu zerren. Bislang kam Tromp – Hedonist, Alpha-Mann, Kronprinz von Shell – immer einfach so davon.
Nach seinem fulminanten Debütroman "Bonita Avenue", von der ZEIT als „große europäische Kunst“ gefeiert, schreibt Peter Buwalda nun also weiter an seinem stilistisch meisterhaften literarischen Universum – mit nicht weniger als einer Trilogie, deren erster Teil "Otmars Söhne" ist. Wieder geht es um Familie und die Bruchstücke davon, um abwesende Väter und Stiefväter, um Identität und Verantwortung, um persönliche Versäumnisse, Sexualität und Schuld – das unübersichtlich gewordene Leben in heutiger Zeit.
Vita
Peter Buwalda, 1971 in Brüssel geboren, arbeitete für eine Musikzeitschrift, bevor er seinen ersten Roman schrieb und freier Schriftsteller wurde. «Bonita Avenue», 2013 auf Deutsch erschienen, wurde für zwölf Preise nominiert, darunter die wichtigsten niederländischen Literaturpreise, und mehrfach ausgezeichnet. Der Roman führte über zwei Jahre lang die holländischen Bestsellerlisten an und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. 2019 veröffentlichte Peter Buwalda seinen zweiten Roman, «Otmars Söhne», den ersten Teil einer Trilogie. Er lebt in Amsterdam.
Gregor Seferens, 1964 geboren, ist Übersetzer etwa von Maarten ’t Hart, Geert Mak und Harry Mulisch und wurde u. a. mit dem Else-Otten-Übersetzerpreis ausgezeichnet. Er lebt in Bonn.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel «Otmars zonen» im Verlag De Bezige Bij, Amsterdam, und ist der erste Teil des auf drei Teile hin angelegten Romans «111».
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Otmars zonen» Copyright © 2019 by Peter Buwalda
Die Übersetzung dieses Buches wurde von der niederländischen Stiftung für Literatur gefördert.
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-00653-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Mike
«Glaubt Er, daß ich an seine elende Geige denke, wenn der Geist zu mir spricht?»
Ludwig van Beethoven
«Die Symbole des Terrors sind alltäglich und absolut vertraut: die Faust, die Pistole, das Messer, die Bombe und so weiter. Von noch größerer Bedeutung ist das versteckte Symbol des Terrors: der Penis.»
Andrea Dworkin
Über den Korallen
111
Mit dem, was Psychiater für ein stattliches Honorar Vatersuche nennen, hat es nichts zu tun; Dolf sucht nichts, und er vermisst auch nichts, als in ihrer Wohnung in der Geresstraat ein Mann auftaucht, zu dem er noch im selben Jahr «Papa» sagt, obwohl er doch bereits ein zehnjähriger Junge ist. Der Mann, der Otmar Smit heißt, dirigiert in der Musikschule im Ortskern von Blerick den Chor, in dem Dolfs Mutter singt. Er ist klein und gedrungen, raucht Belinda durch eine elfenbeinerne Zigarettenspitze und hat so breite Füße, dass man unter seine nussbraunen Budapester Hufeisen nageln könnte.
«Sie haben aber runde Füße», rutscht es Dolf heraus, als der Mann wieder einmal ihr schnell noch gestaubsaugtes Wohnzimmer betritt. Der Mann erwidert, er könne ruhig «du» zu ihm sagen und ob er wisse, dass Ronald Koeman und Luciano Pavarotti ebenfalls runde Füße hätten. Dann ergreift er blitzartig seine Hand, schaut ihn wie der Gott des Gewitters unter wuchernden Augenbrauen hervor an und sagt: «Drück zu, fester – noch fester», woraufhin Dolf die trockene Hand so kräftig wie möglich drückt, erst mit einer Hand und dann mit beiden. Otmar zwinkert Dolfs adrett gekleideter Mutter zu und fragt, die freie Hand locker in der Hosentasche, ob er, wenn ihr Sohn fertig mit Drücken sei, in der Küche helfen könne, irgendwas schälen, einen Topf Kartoffeln abgießen oder so was.
Wahrscheinlich spürt Dolf zum ersten Mal, was Väterlichkeit ist, auch wenn er diese Art von Wörtern nie verwendet. Es sind sich dehnende und sich zusammenziehende Monate, in denen ihn dieser freundliche, anteilnehmende Mann in seinen roten oder grünen Hosen und den gediegenen Fischgrätjacketts mit Wildlederflicken an den Ellenbogen gleichsam einlullt; Otmars joviale Lebhaftigkeit, sein handfester Optimismus – davon geht eine Kraft aus, mit der er nicht gerechnet hatte. Bis dahin war er mit seiner Mutter allein gewesen, ein etwas düsterer, einsamer Start für einen Jungen, wird ihm, sich damit abfindend, bewusst. Auch ohne Vater, ohne Geld für einen Sportverein, ohne Campingurlaube in Frankreich ist er zufrieden. Seine Mutter und er bilden eine Zweieinigkeit, als verliefe irgendwo in der Abgeschlossenheit ihrer Wohnung, unter den durchgetretenen Teppichen oder hinter den Tapeten, auf denen die Filzstiftrunen seiner Kleinkindzeit zu sehen sind, noch immer eine Nabelschnur.
In De Klimop, seiner Grundschule, ist die Vaterlosigkeit nicht unbedingt ein Nachteil. Bei den Raufbolden und Sitzengebliebenen in seiner Klasse erzwingt er damit Furcht; sie glauben, dass diese Lücke in seinem Leben ihn härter gemacht hat, zäher. Manche Mädchen wollen ihn trösten, wenn sie hinter seinem Rücken erfahren, dass sich sein Vater davongemacht hat, noch bevor er auf die Welt gekommen ist. Sie laden ihn als einzigen Jungen zu ihrer Geburtstagsparty ein, bei der ihre Mütter vor unausgesprochenem Mitleid sanft werden, was er durchaus bemerkt und sich schweigend gefallen lässt.
Doch dann ist da Otmar Smit aus Venlo. Wenn er Dolfs Mutter abholt, um mit ihr in den neuen James Bond zu gehen oder eine Kabarettvorstellung in der Maaspoort zu besuchen, hat er immer ein Geschenk für ihn dabei, meistens einen Bausatz, der genau ins Schwarze trifft – das richtige Flugzeug, richtiger Maßstab, richtiger Weltkrieg. Einmal bleibt er einen ganzen Sonntagnachmittag bei ihnen in der Wohnung, um Dolf am mit Zeitungen abgedeckten Esstisch zu zeigen, wie man einen Vickers-Doppeldecker lackiert. Die Farbe kommt aus begehrenswerten Minibüchsen, die Otmar in einem Venloer Geschäft kauft, von dessen Existenz seine Mutter nicht einmal etwas ahnt. Sie führen ernste Gespräche darüber, welcher Klebstoff der beste ist, der aus einer Tube oder der aus einem Tiegel, und auch über die Flugzeuge reden sie, ob die Bordwaffe der schiefen und krummen Vickers schon zwischen den Blättern des Propellers hindurchschoss, ob die Sopwith Camel, die an einer Angelleine über seinem Schreibtisch hängt, einigermaßen wendig war – Dinge, für die man einen Vater braucht, erkennt er.
Zweifellos hat seine Mutter auch schon vorher Verehrer gehabt. Der Honigwaffelverkäufer auf dem Markt schneidet die oberste Waffel in ihrer Tüte immer in Herzform. Der Musiklehrer, ein Mann mit einem Glasauge, möchte, dass er ihr Grüße ausrichtet. Auf dem Schulhof umherirrende Väter scherzen mit ihr, was Dolf verwundert, denn sonderlich freundlich ist sie nicht. Allerdings ist sie anders als andere Mütter. Da ist zunächst mal ihr komischer Name, Ulrike Eulenpesch – «warum heißt ihr Eulenpisse», fragt ein Mitschüler, auf den Dolf sogleich losgeht –, und außerdem spricht sie seltsam, so wie die hübsche Schwester von Prinz Claus, sagt Otmar. In deutschen Versandhäusern bestellt sie blumige Seidenblusen und taillenhohe Hosen, zu denen sie offene Schuhe mit goldenen Riemchen anzieht, selbst bei Regen. Wenn er im Klassenraum sitzt, sieht er sie aus dem Augenwinkel den Schulhof betreten, ihr aschblondes Haar, das sie mit großen Haarspraywolken in Form bringt. «Mist, wieso ist das Elnett denn schon wieder alle?», ruft sie aus der Dusche, sodass sie am Nachmittag zusammen mit dem Bus nach Venlo fahren, über die Maasbrücke, und Hand in Hand durch die Vleesstraat zum Nolensplein gehen, um bei «Die 2 Brüder von Venlo» neue bronzene Dosen zu kaufen und auch noch Kaffee und Zigaretten und Krustenbrote; die liebt seine Mutter, ebenso wie Gold und «geschulten Gesang». Beim Bettenbeziehen singt sie deutsche Arien. «Deine Mutter war in Wuppertal bei der Operette», sagt Otmar, wenn Dolf freche Bemerkungen macht. «Sei also ein bisschen lieb zu ihr.»
Er tut, was er kann. Auch wenn er, als sie noch zu zweit waren, nicht in solchen Begriffen über seine Mutter dachte, als wäre sie jemand, zu dem man besonders lieb sein müsste; ihr Charakter eignet sich nicht für Mitleid, sie ist eine Frau, die, wenn sie traurig ist, wütend wird oder anfängt zu putzen. Die einzigen Frauen, die ihr ähnlich sind, sieht er im deutschen Fernsehen in der Werbung für Schwarzkopf-Shampoo, doch die wohnen in großen Häusern und sind fröhlich.
«Wann kommt Otmar wieder», fragt er, als es ihm zu lange dauert. Sobald der koboldhafte Mann da ist, schleppt Dolf ihn zur Heimorgel, die sie von Opa Ludwig bekommen haben und die Otmar «Steinway mit Ohrwärmern» nennt. Er zieht den Kopfhörer heraus, lässt erst mal all seine Fingerknöchel knacken, woraufhin etwas Beeindruckendes aus den staubigen Lautsprechern zu seinen Füßen dringt, ein wilder Strom von Tönen, die Dolf weniger schön als vielmehr gut oder gekonnt findet, oder wie sagt man das. «Liszt, Ferenc, ‹Fränzchens List› – so mein Vater, der schon unter der Erde ist», sagt Otmar oder: «Ludwig Bethosen, stocktaub, aber dennoch kein Hörgerät, Mensch – auf keinen Fall benutzen, einfach so tun, als wenn nichts wäre.» Altmodische Witzchen, wenn er jetzt daran zurückdenkt, die aber seine Mutter silberhell auflachen lassen, was an und für sich schon ein Ereignis ist. Durch Otmar wird ihm bewusst, dass sie eigentlich immer mürrisch war. «Mach mich nicht griesgrämig, Junge», warnt sie ihn oft zu spät. Vielleicht ist «verbittert» ein besserer Ausdruck, wie die bittere, schwarze Schokolade, die sie schimpfend durchs Klo spült, wenn sie die von Leuten geschenkt bekommen hat, «die mich mästen wollen, mein Schatz».
In gewisser Weise versteht Dolf ihre Verdrießlichkeit ja, mehr noch, ihn selbst plagt so was auch. Wenn er nach der Schule bei einem Freund zum Spielen ist, wo es nach Blumenkohl und Bratwurst riecht, und ein Vater den Gartenweg betritt, dann überfällt ihn eine Trauer, die an Wut grenzt, weniger aus Eifersucht, sondern vielmehr, weil ein solcher Mann, der seine Tasche abstellt und seiner Frau einen Kuss gibt, ihn daran erinnert, dass irgendwo ein Mann herumläuft, der seiner Mutter und ihm etwas vorenthält. Bei ihnen ist es Ulrike selbst, die am Nachmittag gerädert heimkommt, um Jahre gealtert nach einem Tag in der Venloer Gärtnerei, in der «ich des Liebesschicksals wegen arbeiten muss, mein Schatz», das T-Shirt steif von der Wundflüssigkeit der Gerberastiele, die sie in tropischer Hitze abgeschnitten hat – «kriechend, sie lassen deine Mutter auf den Knien kriechen». Oft ohne ihm einen Kuss gegeben zu haben, schließt sie sich im Bad mit dem zu kurzen Duschvorhang ein, was zur Folge hat, dass sie jeden Abend ein durch und durch nasses Handtuch auswringen muss, und kommt erst nach einer Dreiviertelstunde wieder heraus, nach Elnett riechend und erstaunlich gut renoviert, woraufhin sie am Küchentisch, das Kleingeld aus ihrem Portemonnaie wie Schrot um sich herum, einen Einkaufszettel schreibt.
Er ist nicht gut angesehen in der Geresstraat, der Mann, von dem Dolf nicht zu reden wagt. Ein vertracktes Tabu umgibt seinen «Erzeuger», wie seine Mutter ihn nennt. Einerseits will sie nicht, dass von ihm gesprochen wird, andererseits spricht sie fortwährend von ihm, ein Alleinrecht, das sie aufgrund einer Vergangenheit, zu der Dolf gerade eben nicht gehört, für sich Anspruch nimmt. Es sind immer dieselben vier, fünf Geschichten, die sie erzählt, über Ereignisse oder Eigenschaften, aus denen hervorgeht, dass sein «Erzeuger» ein unangenehmer Mensch war – «ein großer Fehler deiner Mutter, Junge». Ein Mann, der zu Opa Ludwig gesagt hat, er könne kein Gespräch mit ihm führen, weil dieser nicht studiert habe; ein Mann, der sich innerhalb von fünf Minuten ins Bett verkriechen konnte, Fenster und Vorhänge dicht geschlossen, Thermometer unter der Zunge, einzig und allein weil man behauptet hat, er sehe blass aus. Der, obwohl er seinen Grundwehrdienst leistete, mit Geld nur so um sich warf und sie jede Woche zum Chinesen in der Pepijnstraat einlud, aber, als sie einmal seine Eltern in Eindhoven besuchten, sehr sorgenvoll über seine Finanzen sprach und sich einen Umschlag mit zweihundert Gulden in die Hand drücken ließ, weshalb er auf dem Rückweg triumphierte. Der solche Schweißfüße hatte, dass Ulrike seine herumliegenden Armeesocken nur anfasste, wenn sie zuvor eine Butterbrottüte über ihre Hand gestülpt hatte, die sie dann, auf links gedreht, an den Rand ihres Wäschekorbs knotete.
Als Kind verblüffte ihn natürlich vor allem die Butterbrottüte; jetzt, mit vierunddreißig, fällt ihm die durchschlagende Wirkung von Ulrikes Bombenteppich auf, die Art, wie sie den Mann mit einem tödlichen Cocktail von Bewertungen niedermachte: Wer will schon von einem Wichtigtuer ohne Rückgrat oder Ehrgefühl, von einem eingebildeten Snob, der sich einfach so auf seinen Schweißfüßen aus dem Staub gemacht hat, gezeugt worden sein.
Kein Wunder, dass Dolf Alain so gut verstehen konnte, einen Jungen aus der Wohnwagensiedlung, der im letzten Grundschuljahr sein bester Freund geworden war. Sie saßen in der Klasse hinten in der Ecke und waren unzertrennlich. Oft mussten sie albern lachen, zu oft, fand Herr Hendricks, doch das war mit einem Mal vorbei, als Alains Vater bei de Pope, der Kabelfabrik an der Bahnlinie, wo er als Zeitarbeiter beschäftigt war, einen Stromschlag abbekommen hatte. Zack, mehr als vierhundert Volt in seine Nervenbahnen, erzählte sein neuer Freund eines Morgens, was seiner Meinung nach auf mehr als zwei Steckdosen zugleich hinauslief. Man hatte seinen Vater mit aufheulender Sirene auf die Intensivstation gebracht, wo er dann ein paar Wochen bleiben musste.
Infolgedessen war der schmächtige und trotz seiner schweren schwarzen Treter wieselflinke Alain schnell erschöpft und brauchte, wie er fand, «bei gewissen Dingen Hilfe», und dieser Ansicht war Dolf auch. Er hatte Verständnis dafür, er erledigte gern Dinge für seinen Freund. «Eben weil du keinen Vater hast», erklärte Alain ihm, «weißt du, wie ich mich fühle, und darum sind wir beste Freunde.»
Obwohl Alain nur langsam wuchs, hatte er einen Schnurrbart, oder zumindest einen Hauch davon, der ihm in der Klasse großes Ansehen verlieh. Außerdem besaß er ein Springmesser, und er war rotzfrech: Wenn Dolfs Freund es für nötig hielt, beschimpfte er jeden aufs unflätigste, auch Lehrer und Lehrerinnen. Es war eine Ehre, neben Alain zu sitzen, dessen Cousins «Bekannte» der Polizei waren, was Dolf so an seine Mutter weitergab, die ihm daraufhin bestätigte, ja, es handele sich um eine «Art von Freunden».
Er selbst sei auch nicht untätig, erklärte Alain ihm, im Haushalt, um genau zu sein, was Dolf bemerkenswert fand. Er erledige alle Einkäufe, und er koche das Essen, weil seine Mutter notgedrungen einen Job als Putzfrau in einer Schule angenommen habe. Also ging Dolf nicht mehr zu Fuß zur Schule, sondern fuhr auf Ulrikes altem Fahrrad, weil er fortan in aller Frühe erst einmal ein ordentliches Stück in die andere Richtung musste, bis ganz nach Vossener, um Alain in der Wohnwagensiedlung abzuholen, die noch jenseits des Schwimmbads lag.
Sollte Dolf irgendwann einmal in Probleme geraten, versicherte Alain seinem Freund, in richtige Probleme, meine er, dann wären seine Cousins für ihn da. Dies zu wissen gab Dolf in der ersten Zeit ein gutes Gefühl. Möglichweise füllten Alain und dessen Cousins ja eine unbewusste Leere, die er zu Hause allmählich empfand; in der Geresstraat sprachen sie nie über tiefergelegte Mercedes-Karossen oder über Familienehre, und außerdem gab sein Freund, der anderthalb Jahre älter war (aber merkwürdigerweise keinen Geburtstag hatte) ihm am Tag öfter gute Ratschläge als seine Mutter in einem Jahr.
Nach ein paar Wochen verlangte Alain, dass Dolf ihm morgens Butterbrote machte, damit er selbst, so erklärte er ihm, genügend Zeit habe, um seinen Schwestern Brote zu machen. Dummerweise hatte Dolf nur eine Brotdose, und man konnte die Stullen auch nicht endlos reinstopfen, vor allem dann nicht, wenn sie mit Spekulatius belegt waren, und den wollte Alain schon sehr bald unbedingt auf seinen Broten haben. «Meine Mutter hat kein Geld, um so viel Spekulatius zu kaufen», sagte Dolf, worauf Alain erwiderte, dass er dann eben darum betteln müsse, denn Dolfs Mutter habe bestimmt viel Geld, das sehe man ja an ihrem Pelzmantel.
«He, Mann», sagte Dolf, «auch ich hab keinen Vater», eine Bemerkung, die seinen Freund schrecklich sauer werden ließ, so richtig, richtig sauer. «Auch?», schrie er. «Auch? Mein Vater ist noch nicht tot, du Idiot, nicht einmal dein Vater ist tot – warum übertreibst du dann so? Dein Vater könnte sogar noch zurückkommen, wenn deine Mutter nicht so eine Schlunze wäre.»
Alain trat ihm mit aller Kraft in die Eier, beleidigt, woraufhin Dolf mit tränenden Augen auf ihn losging, zu mehr war er nicht imstande. Sie rollten sich ringend auf dem Schulhof, bis Alain sein Springmesser zog und es flach auf Dolfs Kehle drückte – dasselbe Zigeunermesser von seinem Vater, mit dem sie in den Herbstferien, auf der Baustelle am Klingerberg, Blutsbrüder geworden waren.
Danach, als er, zitternd und mit lauter Schrammen, Alain nach Hause brachte, verlangte der, dass er ihm – um es wiedergutzumachen, wie er erklärte – den Fokker-Dreidecker überließ, den Dolf zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte.
Die Erinnerung entlockt Ludwig einen Seufzer. Er schaut durch das Seitenfenster des ansonsten leeren Taxis, ohne irgendetwas von der Umgebung wahrzunehmen. Melancholie erfasst ihn – er hat zu viel Zeit, an Blerick zu denken –, aber auch Ungeduld. Bereits seit gut zehn Minuten wartet er auf einen Amerikaner, der wie er zum Flughafen von Juschno-Sachalinsk muss. Mein Gott, braucht der lange. Er hat den Taxifahrer in das Bürogebäude von Sakhalin Energy geschickt, um nachzufragen, doch das war nun auch schon vor fünf Minuten. Er versucht, sich nicht zu ärgern. Wenn er sich ein wenig vorbeugt, das Kinn zwischen Fahrer- und Beifahrersitz, dann kann er das Ziffernblatt einer Kirchturmuhr sehen, so ein russisch-orthodoxes Teil mit vergoldetem Zwiebelturm. Fast halb fünf. Mach hinne, du Sack. Noch zwei Minuten, nimmt er sich vor, dann suche ich mir ein anderes Taxi. Ich steige aus und fahre mit einem anderen.
Währenddessen steht ihm der Flug entsetzlich bevor, er hasst Fliegen, ein Flugticket ist eine Rubbellosniete. Die absurde Beschleunigung, das Surreale des Abhebens, das Knacken und Beben – ungeachtet der hundert Modellflugzeuge, die er als Kind zusammengeleimt hat, steht er Todesängste aus. Und er muss so oft fliegen. Als handele es sich um eine subtil ausgetüftelte Strafe, schickt Shell ihn über alle Kontinente und Ozeane – wenn nicht, was immer wieder vorkommt, in zusammengeflickten Maschinen mit hier und da einem Propeller, dann in einer abgekupferten Sowjet-Boeing. Kündige den Job doch, so äußert Juliette regelmäßig ihr Mitgefühl. Während der seltenen Male, die sie zusammen fliegen, lächerlich kurze Strecken zu Orten, die sie auswählen, um ihre Beziehung aufzufrischen, Korfu, Wien und neulich erst Prag, zerquetscht er beim Start und bei der Landung ihre Fingerknöchel zu Brei. «Lass dich doch mal krankschreiben», sagte sie, als er ihr einmal erzählte, dass die Verbindung Moskau – Juschno-Sachalinsk der längste Inlandsflug der Welt sei. Tatsächlich kann sie es einfach nicht glauben, dass er sich traut, ohne sie zu fliegen, dass er es ohne sie überlebt, also muss er wohl in Gesellschaft von jemand anderem reisen – einer Frau, mit der er ein Doppelleben führt.
In einem kann er Juliette jedoch nicht widersprechen: Für jemanden mit Flugangst hat er einen merkwürdigen Job. Ständig die langen, nervenzehrenden Flugreisen für ein paar Meetings, und das schon seit – er zählt die Jahre an den Handschuhfingern ab – fünf Jahren; seit 2008 besucht er als Vertreter für menschengemachte Erdbeben die örtlichen Niederlassungen von Shell, um sie zu 4d-seismic surveys zu überreden. Das 4d, wie es in seiner Abteilung in Rijswijk genannt wird, ist eine gesalzen teure Technik, mit der sich, durch seismische Wellen, Ölfelder vermessen lassen. Ich bin der Betriebsradiologe, sagt er, wenn man beim Bier zusammensitzt, und dann und wann müssen Aufnahmen gemacht werden. Die Entscheidung fällt nicht leicht, aber anschließend wissen wir genau, wie viel Öl noch da ist, wo sich das Zeug versteckt, wo es Versackungen gibt. Das Unternehmen ist zeitraubend, kompliziert, mühsam. Man braucht Boote dafür, mit kilometerlangen, auf dem Wasser treibenden Schläuchen, an denen Unterwasserkanonen voller Dynamit hängen. Und zugegeben, die Investitionen sind durchaus hoch, rechnen Sie mit fünfzig Millionen, gaukelt er den jeweiligen CEOs vor. Er meint achtzig Millionen.
Natürlich ist er auf Ablehnung und Skepsis gefasst, für mit Grußkarten versehene Blumensträuße hat er den falschen Job. Die Männer, die die Fässer füllen müssen, könnten ihn zum Mond schießen – vor allem auf Sachalin. Überall, wo er seinen Fuß in die Tür stellt, Norwegen, Brunei, im Golf von Mexiko, gibt es neu hinzukommende Umweltprobleme, doch Sachalin ist ein Fall für sich. Eine bedrohte Bartenwalart hält sich in der Umgebung der Bohrinseln auf, der Westpazifische Grauwal, ein Tier, das sich ausgerechnet im Ochotskischen Meer paart, exakt auf den Quadratkilometern, die Sakhalin Energy im Auge hat. Daher sind Wale, anti-fossile Brennstoffe, die Linke aktionsbereit. Insgesamt gibt es noch siebenundachtzig Wale – «bedroht» ist milde ausgedrückt, fast gänzlich ausradiert trifft es besser. NGOs mit Namen wie Friends of the Ocean und Sakhalin’s Black Tears prozessieren wegen jedes submarinen Furzes, den Big Oil fahren lässt. Und dann kommt Ludwig Smit aus Rijswijk mit seinem Dynamit. Guten Tag, ich werd dann jetzt mal den Kreißsaal in die Luft sprengen.
Es könnte Abend sein, so bewölkt ist es. Er schaut erneut zum Kirchturm; die zwei Minuten sind um – doch er tut nichts. Er tut selten etwas. Eigentlich ist er für seinen Job ungeeignet, er ist zu abwartend dafür, zu gehemmt, um Streit anzufangen. Er landet wie ein Elefant in der Jahresbilanz, ein interner Störenfried, der unerwünschte Scherereien mit sich bringt und schon auf dem Hinweg «sorry» murmelt. Ach, Junge, würde Ulrike sagen, das hast du von dem Kerl geerbt, der ist auch immer weggelaufen, wenn ihm der Boden zu heiß wurde.
Lange kannte er den Namen nicht. Sie nannte ihn «Ha», er also auch. Ein merkwürdiger Name, doch an merkwürdige Namen gewöhnt man sich selbst dann, wenn sie zu merkwürdigen Männern gehören. Es verging noch eine ganze Weile, bis er dahinterkam, dass Has Nachname «Tromp» und «Ha» eine Abkürzung war. Seine Mutter meinte damit den Buchstaben «H», so wie man «K» für Krebs sage, erläuterte sie ihm auf die direkte Art, die in ihm manchmal die Frage aufwarf, ob ihr Inneres wohl ihrem aufgetakelten Äußeren entsprach, das chic und damenhaft war. Das K für Krebs war zudem ein Euphemismus – das H seiner Mutter keineswegs, es war eine gereizte Maßnahme, das Maximum, das sie für seinen Erzeuger erübrigen konnte, der schlicht Hans hieß und in den sie sich bei einem eisigen Karneval in Venlo verliebt hatte. Dort, während des Umzugs, trieb er sich mit ein paar Kameraden herum, als Soldat verkleidet, was Dolf zum Lächeln brachte, doch laut seiner Mutter ein typisches Beispiel für Has Bequemlichkeit war. Ein paarmal tranken sie zusammen etwas in «De Paerdskoel», woraufhin sie anderthalb Jahre lang eine ernsthafte Beziehung führten. Dachte sie jedenfalls. Bald nachdem sie festgestellt hatte, dass sie im vierten Monat schwanger war, quittierte er den Dienst in der Blericker Kaserne unten an der Maas, aber auch in ihrem Leben.
«Den Dienst quittieren.»
«Die Platte putzen.»
Otmar: «Deine Mutter meint, sich auf und davon machen.» Es war ein windstiller warmer Samstagnachmittag auf ihrem Balkon, er saß auf Ulrikes Schoß, wobei seine nackten Zehen gerade so den lauwarmen Beton berührten. Otmar hatte Wurstbrötchen mitgebracht.
«Aber wieso denn?»
«Weiß ich nicht, mein Junge. Keine Lust mehr, denke ich.»
«Aber ihr habt doch ein Kind bekommen?»
«Ich hab ein Kind bekommen. Er nicht. Dein Erzeuger hat mich nur geschwängert, und danach ist er abgehauen. Nein, das war alles nicht besonders schön.»
«Wollte er denn nicht Vater werden?»
«Offenbar nicht, nein.» An Otmar gewandt: «Er ist immer vor dem Singen raus aus der Kirche. Das kann nicht gutgehen.» Nicht lange danach schlug er in Otmars Sprichwörter- und Redensartenlexikon den Ausdruck «vor dem Singen raus aus der Kirche» nach; irgendwas mit dem Sperma und einem Koitus interruptus – auch daraus wurde er nicht schlau.
«Aber was hat er dann gemacht?»
«Er hatte eine curriculare Verpflichtung» – mehr wusste seine Mutter auch nicht. Es bedeutete letztendlich, dass Ha, um sein unterbrochenes Ingenieurstudium abzuschließen, ein Praktikum bei der Niederländischen Erdölgesellschaft in Assen machte, sodass sich die Turteltäubchen nur noch am Wochenende sehen konnten. Der schnelle Beginn eines schnellen Endes, sagte Ulrike, die schwanger in der Geresstraat hockte und die Wochentage abzählte.
«Und dann?», fragte Dolf mit vollem Mund.
«Und dann nichts. Nach einer Weile ist er nicht mehr gekommen.» Wenn sie in Assen anrief, ging Ha nicht ran. «Er hat uns einfach sitzenlassen, mein Schatz. Dich ebenfalls, auch wenn du noch in meinem Bauch warst.»
«Na, na», beschwichtigte Otmar, und er blinzelte Dolf zu. Er war an diesem Nachmittag extra seinetwegen gekommen, um das Resultat der Eignungsprüfung für die weiterführende Schule zu feiern. Das hatte man jedenfalls vorgehabt, doch das Ergebnis war so schlecht – nach dem Test zu urteilen, hatte er bei weitem nicht das Zeug, aufs Gymnasium zu gehen –, dass es eher eine Trauerfeier war. Seine Mutter war weniger enttäuscht als wütend; sie hatte gesagt, so könne er nicht Arzt werden. «Ich hätte nie gedacht», sagte sie, «dass du ein Realschüler werden würdest.»
Wovon Dolf nicht erzählt hatte, war die schwere Operation, die Alains Vater bevorstand. Jeden Moment, bei jedem Schlag, könne sein Herz versagen, hatte Alain ihm erklärt. Sein Vater liege schon seit Monaten im Wohnwagen flach. Der elektrische Strom habe Löcher in sein Herz gefressen, sagte er, man könne damit einen Weihnachtsbaum eine Woche lang beleuchten, so viel sei hindurchgebrettert. Luft und Blut leckten heraus, sodass Alain sich kaum auf die Eignungsprüfung hatte vorbereiten können, was Dolf auch nachvollziehen konnte. Darum müssten sie nun eben zusammen auf die Realschule gehen, denn es sei doch Unsinn, ihre Blutsbrüderschaft wegen der weiterführenden Schule zerbrechen zu lassen.
Dieser Ansicht hatte Dolf zugestimmt, auch wenn es ihm nicht schlimm vorkam, von einem Moment zum nächsten von seinem besten Freund erlöst zu sein, weit weg auf einer Schule in Venlo zum Beispiel, ohne Realschulzweig – doch während der Eignungsprüfung stieß Alain ihn ständig an, stupste ihn gegen Schulter und Hinterkopf, blinzelte ihm beruhigend zu, mit seinen ruinösen Zähnen grinsend, sodass Dolf schließlich doch, um seinen Freund nicht zu verärgern, das Ganze in den Sand gesetzt hatte.
«Komm mal kurz mit», sagte Otmar. Dolfs Mutter stellte eine Schale mit wiederaufgewärmten Hot Dogs auf den Esstisch. Otmar hatte eine Plastiktüte dabei, aus der er eine eingepackte Schachtel nahm – Geschenkpapier vom Kaufhaus Geerlings, wie Dolf sogleich sah. Ein seltsamer Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Wenn es mal bloß kein Modellbausatz ist, dachte er.
Es war einer, ein sehr guter sogar, natürlich im richtigen Maßstab und aus dem richtigen Weltkrieg, und zudem noch das allerbeste Flugzeug, das er sich hätte wünschen können, eine Sopwith Baby, die man nur in England kaufen konnte; solange er Otmar kannte, sprachen sie bereits darüber. Es war ein sea-plane, ein Doppeldecker mit großen Schwimmern am Fahrgestell, sodass die Piloten damit auf dem Wasser landen konnten. Achtundzwanzig Kilo Bombenlast. Die Maschine erinnerte an einen Geier mit Puschelbeinen.
«Warum weinst du?», fragte Otmar.
Dolf zuckte mit den Achseln.
«Freust du dich denn nicht? Mach die Schachtel ruhig auf, dann leimen wir sie gemeinsam zusammen. Das würde mir großen Spaß machen.»
«Morgen», schluchzte er.
«Morgen», sagte Otmar und blinzelte Ulrike zu. «Morgen …» Er nahm die Zigarettenspitze aus dem Mund. «In Ordnung. Für wann sollen wir uns verabreden?»
Dolf schaute auf den Rand des Tisches, unter dem sich seine nackten Füße verbargen; er versuchte, nicht zu weinen, doch seine Schultern zuckten.
«Oder», sagte Otmar, «ist das Modell morgen bereits wieder verschwunden, so wie die letzten beiden Male?» Er packte Dolf an der sich wie von selbst bewegenden Schulter und rieb sie.
«Du kleiner Taugenichts», sagte er.
110
Nicht einmal eine Woche später, sie standen auf dem Balkon und hängten Wäsche auf, erzählte ihm seine Mutter, dass Otmar ihr einen Heiratsantrag gemacht habe, und wollte wissen, was seine Antwort darauf wäre.
Den verbissenen Knirps, der keinen Vater haben wollte, der fanatisch seine heroische Verwaisung verteidigte, sein Anderssein in der Schule, den gab es nicht mehr, das spürte er sofort. Der Dolf von damals erinnert ihn an Schuljungen, die vor Entrüstung in die Luft gehen, wenn man sie fragt, ob sie verliebt seien – wir? Niemals, und das wird auch nie passieren –, bis sie sich an einer Eiche wiederfinden, in die sie, Zunge zwischen den Zähnen, den Namen eines Mädchens kerben.
Also war seine Antwort darauf «Ja», er wolle unbedingt, dass sie und Otmar heirateten. Eine Zeitlang war er sogar davon überzeugt, dass Otmars Erscheinen eine Art Belohnung für die Prüfungen war, die er und seine Mutter hatten bestehen müssen. Wenn er abends im Bett darüber nachdachte, fragte er sich, ob Otmar dann sein Vater werden würde. Er hoffte es, aber ganz sicher war er sich nicht.
Sein möglicher Vater war nämlich Witwer, was Dolf nicht wusste – nun ja, Otmars vorige Frau war gestorben, das hatte er schon mitbekommen, klar. Jedenfalls kümmerte er sich um zwei Kinder, ein Mädchen mit schwarzem Pferdeschwanz, gut zwei Jahre älter als Dolf, und einen Jungen, einen Kopf kleiner als er und etwas jünger, die Otmar eines Nachmittags in seinem palmgrünen Volvo Kombi mit in die Geresstraat brachte, um sie vorzustellen. Die Tochter hieß Tosca und sagte liebenswürdige Dinge zu seiner Mutter, nippte aber an der Orangenlimonade, als handelte es sich um Muschelwasser. Der Sohn, der wie seine Schwester besonders musikalisch zu sein schien und zu Dolfs Bestürzung ebenfalls Dolf hieß («da finden wir eine Lösung, Jungs», sagte Otmar, «wenn’s nur das ist … das kriegen wir hin»), weigerte sich nachdrücklich, auf ihrer Heimorgel zu spielen. Obwohl er noch nicht einmal elf war, redete er wie der Bürgermeister von Venlo. «Der Schnitt Ihrer Wohnung ist sehr praktisch», sagte er zu Ulrike, «und vielleicht tröstet es Sie zu wissen, dass die Familie Mozart beengter lebte.» Dabei zupfte er zwanghaft an den schneeweißen Manschetten, die aus den Ärmeln seines Jacketts ragten. Den Kopf bedeckte zurückgekämmtes, sich hochwölbendes hellblondes Haar. Was für ein komischer Kerl, dachte Dolf die ganze Zeit. «Er hat mit einem Orchester Chopin gespielt», sagte seine Mutter, als die drei gegangen waren. «Er ist genial. Aber oft sind so welche auch ein bisschen crazy» – sie tippte sich mit einem Finger an die Stirn.
Was er nicht bedacht hatte, war, dass sie nach Venlo umziehen mussten. «Das gehört zum Heiraten», sagte Ulrike. Das monumentale Eckhaus, in dem Otmar und seine Kinder wohnten, stand im alten Zentrum an dem Platz, den seine Mutter und er immer überquerten, wenn sie zu «Die zwei Brüder von Venlo» gingen. Unter der Wohnung befand sich der Free Record Shop, «daher beim Gehen bitte kräftig stampfen», sagte Otmar, als sie ihre Jacken aufhängten. Von einem riesigen, mit Samt bezogenen Sofa aus, auf dem seine Mutter wie eine deutsche Baronesse und er selber wie ihr Schoßhund aussah, blickte er durch die hohen Fenster auf das mittelalterliche Rathaus, das am Rande des Marktes emporragte und auf dessen Freitreppe soeben ein Brautpaar herabgeschritten kam. Otmar stellte heiße Chocomelbecher mit Sahne hin, mit der auch die Zimmerdecke bespritzt zu sein schien; da gab es weiße Profilleisten und Ranken und Trauben. Auf den Holzfußböden lagen Teppiche, auf denen Körbe mit Zeitungen und Zeitschriften standen. Das weiß lackierte Bücherregal, zu dem sein Blick fortwährend hingezogen wurde, war voller als der Bibliobus vor seiner Schule, wo er sich jeden Donnerstag vier Bände «Adlerauge» auslieh.
«Die stehen dreireihig», sagte Otmars Sohn, als er Dolfs verstohlene Blicke bemerkte.
«Zweireihig», sagte sein Vater, «nicht übertreiben.»
«Manchmal dreireihig», insistierte der Junge.
Es war die mit Abstand schönste Wohnung, in der Dolf jemals gewesen war, und auch die größte. Es gab Nischen und kleine Treppen, überall hingen echte Gemälde, die Zimmer rochen nach Papier, Firnis und gehobeltem Holz. Auf den Treppenabsätzen sah er gerahmte Schwarzweißfotos von einem jüngeren Otmar in Gesellschaft von Menschen, die berühmt aussahen; er meinte Prinz Claus und Bill Cosby zu erkennen, aber das konnte er eigentlich nicht glauben. Während der ersten Stunde in der Wohnung machte er sich ernstlich Sorgen darüber, was diese Tosca und ihr komischer Bruder so alles gedacht haben könnten, als sie in der Geresstraat zu Besuch gewesen und durch den Uringeruch im Treppenhaus zu ihrem Volvo zurückgegangen waren; ob sie sich über die schlichten, todlangweiligen Zimmer in ihrer Wohnung lustig gemacht hatten, in denen es überall zog und tropfte und klapperte oder alles einfach nur hässlich war – wollen die zwei uns überhaupt, dachte er, will Otmar meine Mutter noch, nachdem er das alles gesehen hat?
Erst beim Rundgang wurde ihm bewusst, dass Otmar seine eigene Wohnung natürlich jeden Tag sah. Überall, wo sie hinkamen, standen Vitrinen voller wunderbar gebastelter Modellschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Flugzeugträger, Fregatten, Containerschiffe, es waren unglaublich viele, an allen hohen Wänden oder auf kleinen Tischchen: Vitrinen aus «entspiegeltem Glas», sagte Otmar, «denn sonst sieht man sowieso nichts». Boote in der kühlen Küche, wo normale Menschen Borde für Töpfe und Pfannen anbringen würden, auf einem leicht abschüssigen Treppenabsatz, in den Arbeits- und Schlafzimmern und sogar auf der Toilette – «meine maritime Liebhaberei», erwiderte Otmar, als Dolf sich zur Sicherheit erkundigt hatte, wer das alles gebastelt habe, «manchmal muss ich etwas machen, das nichts mit Musik zu tun hat, mein Junge, denn sonst ermorde ich eines Tages ein Kind, wirklich, ungelogen. So kommen wir zu uns selbst. Ein Stündchen lang nichts als Otmar und der Leimpinsel. Auch wenn ich», und dabei blinzelte er Dolf zu, «durchaus einen erfahrenen Assistenten beim Basteln gebrauchen könnte.»
Damit war noch nichts gesagt über die, wie drückt man es freundlich aus, «Musikaliensammlung», über die Dolf in den folgenden Jahren hinwegstieg und manchmal auch -stolperte und die seine Mutter erst nach Otmars Tod als «elenden Trödel» zu bezeichnen wagte, bevor sie sie schon bald nach dem Begräbnis für möglichst viel verkaufte: die Partituren- und Notenstapel, in seiner Erinnerung auf jeder Sitzgelegenheit, auf jeder Treppenstufe, auf jeder ebenen Fläche, außer wenn es eine Vitrine war; Hunderte Schallplatten, Musikkassetten und die damals noch seltenen CDs; die Büsten von Komponisten, die Dolf eine Zeitlang für Abgüsse von Otmar selbst hielt; die Celli, die Geigen in ihren Kindersärgen, die haarenden Streichbögen, die losen Gliedmaßen von Cembalos und Fortepianos, ungeschmirgelt und geschmirgelt oder zwischen Leimklemmen fixiert; bündelweise Saiten, klauenartige Hämmerchen, Hälse, Pedale, Schnörkelfüße, Seitenteile, komplette Klaviaturen, die wie künstliche Gebisse auf einen Flügel warteten, der zuschnappte – alles, was man sich nur denken konnte, lag herum. Otmars Wohnung ächzte unter einem musikalischen Sediment, das emporwuchs, als würde sich das Geklimper und Gefiedel, mit dem seine Kinder am Tag die Luft in Schwingungen versetzten, nachts ablagern. Bescheuert? Auf jeden Fall anders als Ulrikes Sammlung leerer Parfümflakons.
Zu dritt – der hellblonde Namensvetter war vor ihnen die Treppe hinaufgeflitzt und ließ sich nicht mehr blicken – folgten sie Otmar und der Spur seiner Zigarette durch eine Tür, hinter der ein großes Zimmer verborgen, vielmehr versunken war: Sie mussten drei Stufen hinabgehen, ehe sie auf dem Holzfußboden standen. Auch hier schmale hohe Fenster, vor denen man volvogrüne Läden schließen konnte, Dolf sah Glocken- und Treppengiebel überraschend nah. Außer drei Vitrinen mit Schiffen, auf der mittleren drei hohe Plattenstapel in abgegriffenen beigen Hüllen («das Schellack-Archiv», sagte Otmar), stand in dem Zimmer nur noch ein kleines schlumpfblaues Klavier.
«Ist das ein Spielzeugklavier?», fragte Dolf.
«Spielzeug?», polterte Otmar fröhlich, «das ist ein Juwel. Ich wünschte, Dolf – Entschuldigung, der andere Dolf – würde darauf seine Haydn-Sonaten üben. Leider ist er ein Steinway-Adept, was am Alter liegen könnte. Er isst ja auch lieber Marshmallows als Pilze zu seinen Nudeln.»
Geklapper, das ihm erst allmählich bewusst wird als etwas, das von seinen Kiefern herrührt. Es ist gnadenlos kalt im Lada. Sachalin, die Bekanntschaft war kurz und tiefgekühlt. Ob die Menschen hier, im hintersten Winkel Sibiriens, ihren Platz auf Erden für den Mittelpunkt der Welt halten, um den herum sich der gesamte Kosmos angeordnet hat? Oder ist das typisch für New York? Oder für Overveen? Wer Sachalin sagt, sagt Tschechow; immer, wenn er auch nur einen Absatz über die Insel gelesen hat, wurde auch Tschechow erwähnt, und das nur, weil er vor einem Jahrhundert einmal kurz hier gewesen war. Es hat etwas Erbärmliches – eine Insel, die größer ist als Skandinavien und von einem einzigen flüchtigen Besucher zehrt, der festgehalten hat, wie hässlich, desolat und menschenunwürdig er es dort fand.
Wie anders der große, stille, leere Raum, in dem Dolf stand und sich umsah und in dem es genauso roch wie im Gästezimmer von Opa Ludwig in Wuppertal, ein Geruch, den er mochte. Unter den Fenstern war ein Podest, auf das ein Doppelbett passte, auf dem aber nichts stand.
«Das hier wird dein Zimmer», sagte Tosca, die bis dahin kaum ein Wort von sich gegeben hatte. In der Geresstraat hatte er sie gar nicht richtig wahrgenommen. Erst jetzt, als ihr herausgeputzter Bruder seine Aufmerksamkeit nicht mehr stahl, fiel ihm auf, dass sie robust wirkte, ein wenig plump sogar. Ihre schmalen Schultern hingen herab, wodurch sie die Form einer Konifere hatte. «Und Papa wird jetzt gleich sagen», fuhr sie fort, «dass er die Schiffe aus den Vitrinen rausnehmen wird, damit du deine Modelle reinstellen kannst. Du hast doch jede Menge Flugzeuge?»
Er nickte. Toscas sahniges Gesicht befand sich hinter einer schwarzen Brille mit konvexen Gläsern, die ihre grünbraunen Augen größer aussehen ließen. Erst später, als Otmar ihr Kontaktlinsen erlaubte, sollte er bemerken, dass sie freundlich waren, dass ein nüchternes, aber erbarmungsvolles Licht von ihnen ausging.
«So ist es tatsächlich geplant, Dolf», sagte Otmar, «ich räume die Vitrinen –»
«Und du wirst außerdem sagen, dass es nicht sein muss, sondern freiwillig ist», unterbrach Tosca ihn. «Während ich zum Beispiel nicht ins ‹De Splinter› darf.»
«Tosca nimmt anderen Menschen gern das Wort aus dem Mund», sagte Otmar zu ihm und Ulrike. «Sie hat nicht gerade viel Geduld, wenn man bedenkt, dass sie erst dreizehn ist. Was viel zu jung ist für eine Kneipe in der Stadt.»
«Es ist blöd, dass ich nicht hindarf. Aber das mit Dolfs Zimmer, das ist doch richtig?»
Jetzt war es Dolf, dem sie das Wort aus dem Mund nahm. Stimmte das? Sollte dieses riesige Zimmer wirklich seins werden? Die Aussicht war überwältigend. Am liebsten hätte er sich an einem Regenfallrohr heruntergelassen und wäre zwischen den vorüberschlendernden Menschenmassen so schnell wie möglich über die Maasbrücke gesprintet, um in Blerick seine Fokkers und Vickers zu holen, aber er blieb einfach nur stehen, zehenringend in seinen zweigestreiften Adidas-Schuhen, und ihm war ganz flau vor Hoffnung, dass das Mädchen die Wahrheit sagte.
«Ich muss Geige spielen», sagte Tosca, «aber Dolf darf Modelle bauen. So wird es sein, das weiß ich jetzt schon. Bastle du nur ruhig deine Flugzeuge, Junge. Geh du nur ruhig mit deinen Freunden in den Filmclub.» Sie sprach mit verstellter, nasaler Stimme, doch ihr Gesicht hatte einen derart sanften Ausdruck, dass Dolf sich nicht vorstellen konnte, dass sie Otmar persiflierte, aber Ulrike hatte es auch gehört und stieß ihr schrilles Lachen aus.
«Tosca», sagte Otmar, «Modellbau hat nichts mit deiner Geige zu tun. Und ein Filmclub noch weniger. Deine Geige ist kein Bausatz und erst recht kein Hobby.» Er stand neben dem blauen Zwergpiano und ließ seine breite Hand über die Klaviatur gleiten, die sonst weißen Tasten waren schwarz und andersherum. Mit dem Siegelringfinger schlug er die Taste ganz links an, kräftig – der Ton schnarrte tief und metallisch.
«Ich hasse Geigespielen.»
«Du liebst Geigespielen.»
Es geschah etwas Seltsames, sie wiederholten die beiden Sätze mindestens dreimal schnell nacheinander, bis Otmar sie anherrschte: «Die Geige ist das Wichtigste in deinem Leben. Die Geige ist deine Bestimmung. Das weißt du genauso gut wie ich.»
«Ich weiß nichts genauso gut wie du, Papa. Du weißt alles besser. Du bist ein Hellseher. Du kennst schon jetzt mein Leben. Ich nicht, denn ich bin ganz gewöhnlich.»
«Du bist nicht gewöhnlich», sagte Otmar, «du bist vorlaut.»
«Ich sage nur, dass Dolf schöne Sachen machen darf.»
«Du machst andere schöne Dinge.» Otmar wackelte mit seiner Nase wie Sateetje, das Meerschweinchen in Dolfs Klasse. Er werde es, sagte Herr Hendricks, zu Weihnachten mit Saté-Sauce essen. Alain wollte das Tier vorher befreien. «Und außerdem macht Dolf nicht nur schöne –»
«Ich meine den neuen Dolf. Das weißt du genau!»
«Den meine ich auch», sagte Otmar und packte ihn kurz bei der Schulter. «Dieser Dolf muss jeden Morgen in die Schule, um nur einen Unterschied zu nennen.»
«Nein.»
«Doch.»
«Nicht jeden Morgen.»
Otmar holte tief Luft, sagte aber nichts.
«Ich würde auch gern zur Schule gehen», sagte Tosca, eine Bemerkung, die Dolf in Erstaunen versetzte. Was meinte sie damit? «Eigentlich sind wir eine kriminelle Vereinigung», hörte er seinen Stiefvater später zu Gästen sagen, meistens reichen Venloer Bürgern, denen er mit einer Mischung aus Charme und emotionaler Erpressung Spenden abschwatzte, «obwohl wir Wohltaten begehen und keine Missetaten.» Auf sein Geheiß hin entzogen sich Tosca und Dolf der Schulpflicht, weil sie Wunderkinder waren, ein Wort, das zu Hause nie ausgesprochen wurde. Es kam in Interviews vor, und er hörte es im Radio oder Fernsehen.
«Du solltest froh sein, dass du zu Frau Verhey gehen darfst.»
«Das ist für mich keine Schule, zweimal im Monat nach Utrecht für ein paar Stunden Geigenunterricht.»
«Willst du in Zukunft lieber zu Hause bleiben?», fragte Otmar. «Ich brauche sie nur anzurufen.»
Tosca schüttelte den Kopf.
«Verhalte dich wie dein neuer Bruder», sagte Otmar, «der hört wenigstens auf seine Mutter, wenn sie ihm etwas sagt. Und du hörst auf mich.»
«Ich gehorche dir. Das ist etwas ganz anderes.»
«Du widersprichst mir. Das ist etwas ganz anderes.»
Tosca seufzte auf eine gedehnte Weise, die Dolf so patzig vorkam, dass seine Achseln dabei zwickten. Das würde Ohrfeigen geben, dachte er, seine Mutter hätte schon längst hingelangt.
«Und gerade», sagte Tosca kopfschüttelnd nur zu ihm, «habe ich ihm noch das Wort aus dem Mund genommen. Kannst du dem noch folgen?»
Bis hierhin kann Ludwig seinem Gedächtnis ganz hervorragend folgen. Es erscheint ihm vollkommen plausibel, dass sein erster Besuch in Otmars Wohnung ungefähr so verlaufen ist. Was die Entgleisung angeht, ist er sich weniger sicher. Es kommt ihm unwahrscheinlich vor, dass Tosca und Otmar sich in diesem frühen Stadium haben gehenlassen. Erst nach der Hochzeit, als er und seine Mutter offiziell «Mitglieder der Familie» waren, merkte er mit der Zeit, dass in Venlo ordentlich die Fetzen fliegen konnten. Während der fünf oder sechs Jahre, die sie so zusammenlebten, war er regelmäßig Zeuge von Streitereien und Meinungsverschiedenheiten, wenn er nicht sogar selbst daran beteiligt war. Die Spannung hing mindestens einmal pro Tag wie zum Schneiden in der Luft, vor allem die Unterrichtspausen am Küchentisch stehen ihm deutlich vor Augen, Ulrike, die Essen machte für ihn und Otmar und seine beiden – ja, was waren sie eigentlich? Schüler? Angestellte? Projekte? Zirkusbären? –, und an den Schritten auf der langen Treppe konnte man bereits hören, wie die Stimmung war. Entweder stürmte Dölfchen in die Küche und wünschte schnaubend, sein Vater wäre tot, oder Tosca schlich aus dem Wintergarten herein, tonlos und tränenüberströmt und mit gequälter Miene schweigend, wenn seine Mutter sie der Form halber fragte, was ihr fehle, oder es war Otmar selbst, der sich knurrig und mit zischender Lunte am Schädel an den Tisch setzte.
Jeden zweiten Tag erteilte sein Stiefvater Tosca oder Dölfchen am Vormittag Unterricht, auch an den Wochenenden, und dann waren die laut werdenden Stimmen, das gelegentliche Türenschlagen zu hören, und während des Mittagessens schreckte Otmar nicht davor zurück, seiner Tochter oder seinem Sohn die Wahrheit zu sagen, «schlecht gearbeitet, Tosca, sehr, sehr schlecht – so fliegst du beim Wettbewerb schon in der ersten Runde raus, gleich einpacken, basta, nichts wie weg». Oder er spielte Bruder und Schwester gnadenlos gegeneinander aus. «Was für eine Wohltat, Junge», sagte er mit vollem Mund, «die Konzentration, mit der deine Schwester die Franck-Sonate spielt, so fließend, so fehlerlos … Ich hoffe, du gibst ihr gleich Contra. Was du gestern zu Gehör gebracht hast, war beschissen, ich weiß kein anderes Wort. Beschissen. Guten Appetit.»
Eine Schulklasse zieht am Lada vorbei, eine Prozession aus dick eingepackten Mondmännlein, etwa so alt wie Noa. Während er die Kinder beobachtet, stellt er sich vor, dass er Noa auf dem Arm hat, ein duftendes Bärchen, das er ins Bett trägt. Schon seit Jahren schläft seine Stieftochter vier Nächte in der Woche bei ihnen in Overveen, und jeden Abend legen Juliette und er sie in ihrem Doppelbett schlafen – weil sie es sich so wünscht. Stunden später, wenn sie selbst zu Bett gehen, ist es seine Aufgabe, Noa aus der warmen Deckenmatrize zu heben und sie ruhigen Schritts in ihr eigenes Zimmer neben der Treppe zu tragen, eine Aktion, die bei ihnen «Luftpost» heißt. Die Beinchen um seine Hüften, die Arme um den Nacken, in einer der kleinen Fäuste das halb verschlissene Stoffschwein, das sie konsequent «Schäfchen» nennt und das sie auch im Halbschlaf nie vergisst mitzunehmen. Das dunkelbraune, weiche, krause Haar an seinem Kinn, das Blut, das warm und hastig durch ihren kleinen Körper strömt. Wie ein routinierter Scout huscht Juliette ihm voraus, schaltet neben Noas Bett ein barbapapaförmiges Lämpchen an und schlägt die Decke zurück.
Ein paar Schnäuzchen spähen in den Wagen, er lächelt ihnen zu. Vor der Kolonne latscht eine kommandierende Lehrerin. Der Bürgersteig ist spiegelglatt, er ist von einer Art schwarzem Permafrost bedeckt. Sie werden also wie ein Hase nach Hause schlurfen, nachher.
Wenn er selber aus der Schule heimkam, hörte er bereits unten an der Treppe die Geige oder das Klavier, und Otmars Kinder hatten dann oft noch Stunden vor sich, während ihr Vater wie ein Feldwächter zwischen Mansarde und Wintergarten hin- und herging. Er erinnert sich an das Geräusch, das Otmar machte, wenn er die lange Treppe herunterrauschte oder sie keuchend hinaufstieg, wobei sein wie eine Radioantenne ausziehbarer Kugelschreiber, mit dem er Fingersätze und Akzente in die Noten schrieb oder auch gegen die Notenständer schlug, über die Stufen schleifte – «stopp, aufhören, absolut lausig, von vorne».
Streit, Verzicht, harte Kritik, sie gehörten zum Erziehungskonzept, der Einsatz war hoch, das Ziel klar umrissen. Otmar glaubte, dass seine Kinder mit mehr Talent ausgestattet waren als er selbst, und was drinsteckte, so lautete sein Credo, musste man herausholen, das waren sie der Musik schuldig. «Ja, natürlich», antwortete er Journalisten, die ihn während der standardisierten, jovialen Führung fragten, ob so viel Druck für Kinder denn gesund sei – «sehr gesund, danke der Nachfrage. Solange man seine Papierschiffchen in geschlossenen Vitrinen aufbewahrt, kann der Druck nicht hoch genug sein. Sie wissen, wie man aus Steinkohle Diamanten macht?»
Otmars eigene Erziehung war erheblich rigoroser gewesen, Tosca und Dölfchen wurden zumindest noch zu Hause unterrichtet, Mathematik, Sprache, Geschichte auf Realschulniveau, behauptete er. Ihn selbst hatte sein Vater jeden Mittag aus der Volksschule geholt, er durfte nur vormittags hingehen, weiterführende Schulen kannte er nur vom Hörensagen. «Dafür bin ich eurem Opa immer noch dankbar», sagte er bei Tisch. «Er wäre selbst unheimlich gern Geiger geworden, aber wisst ihr, was dann passierte? Es stellte sich heraus, dass er sehr liebe Eltern hatte.»
Ja, Ludwig ist sich sicher: Seine Erinnerung trübt den ersten Besuch mit einem Scharmützel, das sich erst Monate später ereignet hat, wahrscheinlich sogar Jahre, denn was Otmar danach sagte, bezog sich auf Jascha Heifetz und war auch grimmiger: «Schon die Vorstellung», sagte er zu seiner Tochter, «dass ich Heifetz gegenüber derart ausfallend geworden wäre. Du enttäuschst mich, Tosca.»
«Mein Gott», rief sie. «Was hat dieser blöde Scheiß-Heifetz damit zu tun?»
Dolf hob die Hände, abwehrend, wollte sie auf die Ohren pressen. Scheiß-Heifetz? In diesem Venloer Haus wurden allerhand Götter und Halbgötter verehrt, in erster Linie die großen Komponisten, in angemessener Distanz ein ganzer Haufen Geiger und Pianisten, Rubinstein, Shlomo Mintz, Martha Argerich, Perlman – doch Jascha Heifetz schlug sie alle.
Otmar hatte den Mund bereits geöffnet – und es kamen Klaviertöne heraus: Über ihren Köpfen setzte ein dumpfer, aber durchdringender Notenschlagregen ein. Er und Ulrike wussten nicht, wohin sie gucken sollten, zur meterhohen Zimmerdecke, über der Dölfchen offenbar zu üben begonnen hatte, oder zu dem Mädchen, dem die Blasphemie entfahren war.
Anfang der siebziger Jahre war Otmar mit seinem Geigenkoffer im Handgepäck nach Los Angeles geflogen, um Scheiß-Heifetz, der lebenden Legende, die in Bel Air wohnte, vorzuspielen. Viele hielten Jascha Heifetz für den besten Geiger des zwanzigsten Jahrhunderts, Otmar hielt ihn für den besten aller Zeiten. Zu seiner grenzenlosen Freude wurde er als Schüler angenommen, er durfte bleiben. Während seiner Venloer Jahre sollte Dolf dahinterkommen, dass sein Stiefvater unter Heifetz’ strengem Blick seinen Lebensplan entworfen hatte; in Los Angeles hatte er seine Kinder mit der Frau gezeugt, die er dort auch wieder verlor, der Schwedin Selma Appelqvist, die Tosca und Dölfchen immerhin einen Künstlernamen zum Reinbeißen hinterlassen hatte. Sie war Zeichnerin gewesen, in Venlo lag noch eine Handvoll sogenannter Graphic Novels herum, biographische Comicgeschichten, darunter eine über Heifetz.
Otmar schob den Ärmel seines Jacketts nach oben und tippte auf die Uhr. «Höchste Zeit, du freches Gör», sagte er mit sonderbar entblößten Zähnen. «Dein Bruder hat bereits angefangen. Los. In den Wintergarten. Du hättest mal erleben sollen, was Heifetz mit faulen Geigern gemacht hat.»
«Du bist aber nicht Heifetz.»
«Ich zähle bis drei.»
Tosca schüttelte den Kopf, ihre Brillengläser blitzten. «Wenn Heifetz so genau wusste, wie man mit faulen Geigern umgeht, warum bist du dann nicht Sologeiger geworden?»
«Eins!», brüllte Otmar.
«Selbst mit Heifetz’ Hilfe –»
«Tosca», mischte sich seine Mutter hastig ein, «du kannst das so unglaublich gut. Das ist doch die Hauptsache, oder?» Durch ihre Sorge klang eine Bewunderung hindurch, die Dolf neu war.
«Warum also sollte ich den ganzen Tag üben», sagte Tosca, «wenn am Ende möglicherweise doch alles schiefgeht?»
War irgendwas schiefgegangen, ging es Dolf wie ein Blitz durch den Kopf. Mit Otmar? Und was hatte Heifetz damit zu tun? Der Name wurde jeden Tag mindestens ein Mal erwähnt, manchmal weil Otmar eine der Schellackplatten auflegte, dicke schwarze Scheiben, die er als Junge, lange bevor er in Heifetz’ Klasse gekommen war, sie sich vom Mund absparend gesammelt hatte – meistens aber, weil Otmar irgendetwas aus seiner Zeit in Amerika einfiel, eine Situation oder etwas, das sein Lehrer gesagt hatte. Dann hingen sie alle vier an seinen Lippen, vor allem, weil Otmar Heifetz sehr lustig nachmachen konnte, er zog dann seine Oberlippe hoch wie ein Esel und schnauzte kurz angebunden irgendwas in einem Warschauer-Pakt-Englisch, aber auch, weil es nicht nur zum Lachen, sondern immer etwas Gemeines war. Dieser Heifetz sei ein schwieriger Mann gewesen, hart, unfreundlich, gab Otmar zu. Dennoch war er weiterhin begeistert von ihm, und zwar, wie er gerne erklärte, weil Heifetz so unerhört gut Geige spielen konnte, und das machte alles wieder wett. Alles.
«Du Schlange», brüllte er, das Abzählen nicht beendend; die elfenbeinfarbene Zigarettenspitze mit der Belinda hüpfte in seinem Mundwinkel auf und ab, bis die Zigarette in einem Bogen herausfiel. «Antworte gefälligst, wenn Ulrike dir ein Kompliment macht.»
«Warum hat Heifetz dir denn nie ein Kompliment gemacht, Papa?»
Ein metallischer Schlag dröhnte durchs Zimmer, viele Male lauter als das Klavierspiel über ihnen. Otmar hatte die Klappe des kleinen Klaviers – ein echtes Walter, kein Nachbau und ganz bestimmt kein Spielzeug – mit explosionsartiger Kraft zugeknallt. Mit zwei Schritten stand er neben Tosca und zog sie am Ohr hinter sich her zur Tür. «Mitkommen», brüllte er.
«Beruhige dich, Liebling», rief seine Mutter, «sie meint es nicht böse» – doch Otmar hörte nicht auf sie, er schleifte die sich widersetzende Tosca die kleine Treppe hinauf und schob sie über die Schwelle. Mit einem Knall zog er die Tür hinter ihnen beiden zu; Handgreiflichkeiten waren zu hören und dass Tosca weinte.
Mit hochrotem Kopf starrte Dolf auf die Belinda, die auf den Dielen weiterglimmte.
«Es ist nicht leicht, Sologeiger zu werden», sagte seine Mutter. Dann schwiegen sie.
Er erinnert sich daran, dass er, während Otmars laute Stimme zu hören war, über den grenzenlosen Fanatismus nachdachte, den sein Stiefvater an den Tag legte und dessen Zielscheibe er selbst bis dahin noch nie gewesen war, wohl aber sein Stiefbruder und seine Stiefschwester, und das ununterbrochen. War das nun gut oder schlecht? Woher kam das nur? Noch in der Geresstraat hatte Ulrike ihm erzählt, dass die Mutter von Dölfchen und Tosca in Amerika plötzlich gestorben war, sie hatte einen Herzstillstand erlitten, nicht so etwas wie das Getue von Alains Vater also, sondern einen echten. Otmar musste plötzlich für alles allein sorgen, viel zu beschäftigt, um Abend für Abend mit seiner Geige aufzutreten; seine eigene Karriere löste sich vor seinen Augen in Rauch auf. Ganz sicher war er kein Schinder, auch wenn es manchmal ein wenig danach aussah. Er versuchte nur, etwas aus der Situation zu machen. Er versuchte mit aller Macht, Heifetz’ heiligen Geist über seinen Kindern auszugießen, es war jeden Tag Pfingsten in Venlo: auf den beiden Scheiteln die meterhohen Flammen des heiligen Feuers, in das er selbst jahrelang gestarrt hatte – für «den sonnigen Arsch», wie er selbst sagen würde.
Nach einigen Minuten kam Otmar wieder zurück. «So», sagte er und schloss mit gespitzten Lippen die schlecht eingehängte Tür, vorsichtig, was wohl glauben machen sollte, dass er Tosca gerade zu Bett gebracht und ihr eine Geschichte vorgelesen hatte. Lächelnd ging er die abgetretenen Stufen hinunter. «Das Mädchen», sagte er und löschte die Zigarette mit seinen Elefantenschuhen, «kann verdammt noch mal froh sein, dass ich nicht Heifetz bin.»
109
Du Sack. Komm raus.
Die Drehtür bewegt sich nicht, in den spiegelnden Bürofenstern darüber ballt sich eine hohe, gelbliche Wolkendecke zusammen. Um nicht an die Uhrzeit zu denken, betrachtet er das Gebäude von Sakhalin Energy, einem Erdölkonsortium, das Milliarden in die Förderung von Bodenschätzen vor der Küste Sibiriens investiert, doch ganz offensichtlich nicht in die eigene Fassade. Nackt und billig, so sehen die weißen Kunststoffplatten und das Spiegelglas aus; Reste vom Kleber wurden entfernt und die Nieten verdeckt, aber das ist auch schon so ziemlich alles. Es dürfte nicht leicht sein, auf dieser Erdhalbkugel ein Bürogebäude zu finden, in dem mehr Dollar zirkulieren. Von außen ein Grab aus Plastik, drinnen ein Edelwarenhaus an einem Samstag. Er beißt in den hochstehenden Reißverschlusskragen seiner Skijacke. Ihm ist sehr kalt.
Aus der obersten Etage macht sich einer der beiden Aufzüge auf den Weg nach unten; er heftet seinen Blick auf die Kabine, und als befände sich sein Bewusstsein darin, sinken auch seine Gedanken immer tiefer in sein Gedächtnis hinab, bis er schließlich wieder in Venlo ist, langgestreckt auf den Dielen seines Zimmers, wann immer er trüber Stimmung war, ein Ohr am Holz, in der Nähe des Brandflecks von Otmars Belinda, groß wie ein manhole.
Der Fußboden kühlte nie ganz ab, weil sein Stiefvater wegen der Geigen und Klaviere auch nachts die Heizung anließ, manchmal sogar im Sommer. So langgestreckt daliegend, wuchs er, und es brach die Zeit seiner Namensänderung an. Eine Weile hatten sie seinen Stiefbruder Dölfchen genannt, was dem kleinen Virtuosen nicht gefiel, wahrscheinlich weil ihm selbst bewusst wurde, dass er im Vergleich zu seinem Namensvetter ein Winzling war, vor allem aber wollte er «einmalig» sein und «keine Ableitung von jemand anderem, Papa, von keinem, nie». «Das ist doch nur eine vorläufige Lösung, Junge», beruhigte Otmar ihn nochmals, «ich kümmere mich darum. Vielleicht ist Rigoletto ja ein Name für dich.» Er stand auf, stellte sich unten an die Treppe und rief, die Hände wie einen Trichter am Mund: «RIGOLEETTOOO! EEEESSEN!»
Am Ende wurde es Ludwig. Doch nicht sein Stiefbruder wurde zu Ludwig, sondern er. In dem Jahr, als er in der Schule die Orientierungsklasse besuchte, tauften sie ihn mit Maaswasser aus einem Puddingbecher Ludwig, und er trug fortan den Namen seines deutschen Opas, eines Grubenarbeiters, der eine unvollendete, inzwischen verlorengegangene Symphonie hinterlassen hatte, sagte Otmar während der sogenannten feierlichen Familienzusammenkunft; ein Scherz, den er vielleicht machte, um Ludwig-ehemals-Dolf zu trösten. Seine eigenen Kinder waren anders, sehr anders. Oder Dolf-fortan-Ludwig war anders, je nachdem, wie man es betrachtete, und die Frage, die ihm leise auf den Nägeln brannte, war die, ob Beethovens Vorname, worüber niemand ein Wort verlor, nicht vielleicht Perlen vor die Säue war. Das Schweigen hierüber fand er ein wenig seltsam, denn gerade von diesem Beethoven hingen überall im Haus Porträts.
Als wäre in Venlo etwas normal gewesen. Laut und deutlich stieg in ihm die Erinnerung an lechzende, gierige Belagerer auf, die sich nachdrücklich nicht auf ihn stürzten, sondern ihn im Gegenteil aus dem Bild schieben wollten, wenn wieder einmal Kameras in die vollgestopften Räumlichkeiten über dem Free Record Shop eindrangen; wie sich zeigte, war er nun der Stiefbruder von Kindern, über die ganze Fernsehdokumentationen gedreht wurden. Otmars Zucht funktionierte, Tosca und Dölfchen waren Kinder mit einer Karriere, die bereits ordentlich glänzte; alle naslang stiegen sie zu Otmar oder seiner Mutter in den Volvo, um irgendwo in Deutschland oder den Beneluxländern ein Konzert zu geben, Tosca in einem Abendkleid, in dem man auch einen Edison hätte abholen können, Dölfchen in einem knitterfreien Smoking von Wiplala. Zu Hochzeiten standen sie als Solisten vor immer besseren Orchestern, Dölfchen damals schon ein wenig häufiger als seine Schwester, und sie erreichten das Finale von Wettbewerben, spielten zusammen im Fernsehen vor der Königin.
Man müsse kein Dr. Spock sein, um sich zu fragen, was das mit dem einen mache, der nicht vor der Königin auftrete, sagte ein Studentenpsychologe, als Ludwig mit zweiundzwanzig in dessen Sprechstunde kam – wegen etwas vollkommen anderem übrigens. «Haben Sie unter diesem, äh … was Sie gerade so passend als … Talentschraubstock bezeichnet haben, gelitten?», wollte der Mann wissen.
Schraubzwinge. Und, tja … was heißt gelitten? Jedes Kind will etwas Besonderes sein, darin gab ihm der Psychologe recht, doch nicht jedes Kind ist etwas Besonderes. Die meisten Kinder sind nicht besonders. Durchschnittliche Kinder sind vollkommen unwissend, niveaulos, nicht talentiert, strohdumm sogar – so sah er sich in der neuen Konstellation jedenfalls mehr und mehr, vor allem an Tagen, an denen am Küchentisch nicht gestritten, sondern diskutiert wurde. In der Geresstraat hatten er und seine Mutter schweigend dagesessen und dem Transistorradio auf der langen Anrichte gelauscht. Nun wurde er überschwemmt vom Redeschwall seiner Stiefgeschwister, mit denen er unmöglich mithalten konnte, wenn sie mit ihrem Vater, meist beim Abendessen, über Musik sprachen; sie wirkten dann plötzlich dreimal so schlau wie er. Noch vor den Töpfen kamen Musikstücke auf den Tisch, das Violinkonzert, das Tosca gerade einstudierte, aber öfter noch Dölfchens Klaviersonate, vielleicht weil er eigensinniger war als seine Schwester, vielleicht aber auch, weil Dolf und Otmar im Allgemeinen unterschiedlicher Meinung darüber waren, wie man spielen musste, mit viel oder wenig Rubato, mit Pedal oder nicht, die Melodiebögen singend oder doch parlando, «nicht so romantisch, Stümper», «nein, Papa, nicht so clean», kurzum: eine nicht endende Zahl von Variationen zu Themen, deren Tonart wechselte, von hitzig und kämpferisch bis hin zu erschreckend gelehrt, von beinahe philosophisch bis hin zu unangenehm emotional oder ekstatisch, was bewirkte, dass er Otmar und dessen Kinder wie Käse in einem Fonduetopf zu einem einzigen klebrigen, hochgestimmten Klumpen verschmelzen sah, Fäden ziehend vor Glück.
Er war das fünfte Rad am Wagen. Was noch durch seine Mutter verstärkt wurde, die, vielleicht weil sie unter der Dusche hin und wieder eine Operettenarie schmetterte, zu verstehen schien, worüber in ihrer neuen Familie gesprochen wurde, und manchmal etwas sagte, auf das die anderen zu seiner Überraschung ernsthaft eingingen. Überprüfen konnte er es nicht, doch ihm schienen es manchmal dämliche Bemerkungen zu sein, oft negativ und nicht unbedingt schwierig zu machen – doch ihm selbst fielen sie nicht ein. Sie sagte zum Beispiel, sie halte Liszt für einen Wichtigtuer, er «brauche zu viele Noten, um auf den Punkt zu kommen», oder dass Beethoven ihr wie «eine quadratische Figur» vorkomme, «jedenfalls was das Temperament anlangt, oder wie sagt man das – ein Viereck».
Die Beethovenporträts in den Zimmern und auf den Treppenabsätzen hatte Selma Appelqvist gemalt, und sie waren für





























