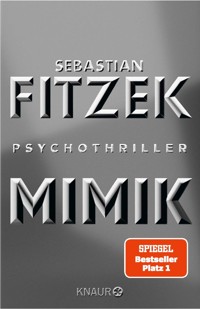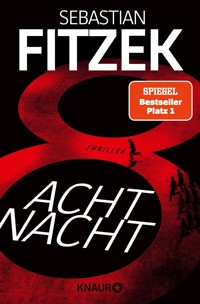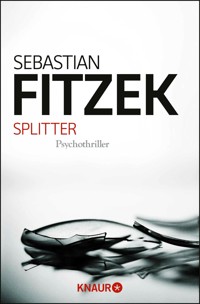9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wohliger Schauder für die dunkelste Zeit des Jahres: Zwölf Thrillerautoren der internationalen Spitzenriege sorgen dafür, dass Ihnen das Blut in den Adern gefriert, und zwar für weitaus länger als die zehn Minuten, die es zum Lesen jeder Story braucht. Denn sie alle beherrschen die Klaviatur des Grauens perfekt. Mitwirkende: Sebastian Fitzek, Val McDermid, Thomas Thiemeyer, Torkil Damhaug, Petra Busch, Michael Connelly, Markus Heitz, Michael Koryta, Steve Mosby, Judith Merchant, Jens Lapidus, Markus Stromiedel. Mit Handschriftenproben der Autoren, graphologisch gedeutet! P.S. Ich töte dich von Sebastian Fitzek: eine Sammlung von Kurzthrillern hochkarätiger Autoren im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Sebastian Fitzek
P. S. Ich töte dich
13 (+1) Zehn-Minuten-Thriller
Deutsch von Knut Krüger, Franz Leipold, Antje Rieck-Blankenburg, Lotta Rüegger, Helene Weinold und Holger Wolandt
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein plötzlicher Schneesturm in den Bergen zwingt den Psychiater Martin Vahl, in einem abgeschiedenen Hotel einzuchecken. Weil Vahl in dem heruntergekommenen Zimmer kein Auge zutun kann, greift er sich die Bibel aus dem Nachttisch und beginnt zu lesen. Kurz bevor ihm die Augen zufallen, löst sich ein kleiner Zettel aus den Seiten: »Nicht einschlafen – oder sie bringen Dich um …«
Wollen Sie mehr? Sitzen Sie bequem, haben Sie es warm und hell? Gut so, denn genauso wie Sebastian Fitzek werden Val McDermid, Michael Connelly, Markus Heitz, Steve Mosby und noch einige andere Thrillerautoren der Spitzenklasse dafür sorgen, dass Ihnen das Blut in den Adern gefriert – für weitaus länger als die zehn Minuten, die es zum Lesen jeder Story braucht. Denn sie alle lieben es düster, beherrschen die Klaviatur des Grauens perfekt …
Inhaltsübersicht
Vorwort des Herausgebers
Nicht einschlafen
Schöne Bescherung
1. Kapitel
2. Kapitel
Fehler im System
Der fast Perfekte
Vita reducta
Späte Abrechnung
Ein ehrenwertes Haus
16. Dezember, Homburg/Saar
Der Winter nimmt alles
Wünsche für Alison
Monopoly
15.09 Uhr
15.26 Uhr
16.22 Uhr
Feierabend
Pulver
Das Haus auf dem Hügel
Der Heimweg
Biographisches und Graphologisches
Copyright-Vermerk
Vorwort des Herausgebers
Vorworte sind langweilig. Todlangweilig. Um genau zu sein, fast so schlimm wie Danksagungen, in denen man mit Namen traktiert wird, die man eh nicht kennt und die bei männlichen Autoren immer mit der Verbeugung vor der selbstlosen Ehefrau enden, die die Phase des Schreibens »geduldig ertragen hat« und die »trotz allem« noch mit einem zusammen ist. Als hätte ein Schriftsteller die ehebelastendste Tätigkeit der Welt, schlimmer noch als ein Pathologe, der seine Arbeit gern mit nach Hause nimmt …
Dabei gibt es doch eigentlich nichts Schöneres als einen Lebenspartner, der völlig selbstvergessen stundenlang auf einen Computermonitor starrt und der es nicht bemerken würde, wenn man mal kurz (also für ein halbes Jahr etwa) mit Freunden in den Urlaub fährt.
Es gibt nur eine Situation, in der eine Autorin oder ein Autor wirklich zu einer Belastung für seine Umwelt wird. Dann, wenn er mitten in seinem neuen Buch steckt und den Anruf eines Kollegen bekommt: »Sag mal, hast du nicht Lust, was für meine Anthologie zu schreiben? Ich weiß, du bist zeitlich dicht, aber ist ja nur eine Kurzgeschichte …«
Nur eine Kurzgeschichte. Was für ein Widerspruch in sich.
Es gibt in meinen Augen keinen schlechteren Rat, den man Anfängern geben kann, als es »erst einmal« mit einer Short Story zu versuchen. Denn diese braucht alles, was ein Leser von einem großen Thriller verlangt: eine aufregende Handlung, interessante Figuren, einen unverwechselbaren Stil und eine überraschende Pointe. Und, im Gegensatz zum Roman, benötigt die Kurzgeschichte sogar noch mehr: Auf 500 Seiten können Sie sich einige Längen erlauben, Unstimmigkeiten abschleifen und vielleicht sogar Fehler vertuschen. Bei einer Short Story fahren Sie damit gnadenlos vor die Wand. Hier muss jeder Satz, am besten jedes Wort, stimmen.
Ein kluger Kopf schloss einen elend langen Brief einst mit den Worten: »Es tut mir leid, ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen.« Die Autorinnen und Autoren, die ich fragte, ob sie einen Beitrag zu P.S. Ich töte dich beisteuern wollen, können diesen Satz nur unterstreichen. Sie wissen aus langjähriger Erfahrung, dass sich gute Geschichten nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln lassen. Umso erstaunter war ich, wie viele von ihnen auf meine schamlosen Überredungskünste reingefallen sind, wofür ich allen ganz herzlich danke. Damit ich diese Sammlung kurzer Thriller nun nicht durch eine lange Vorrede verhunze, will ich schnell zum Punkt kommen und mich zum ersten Mal im Voraus bei Ihnen, den Leserinnen und Lesern, bedanken. Die lange Danksagung am Ende, die Sie von meinen Romanen gewöhnt sind, entfällt aus gegebenem Anlass. Dafür finden Sie dort etwas viel Besseres: nämlich einen Einblick in die Seele der jeweiligen Autoren. Allen Geschichten ist eine Original-Handschriftenprobe ihrer Verfasser vorangestellt. (Seien Sie froh, dass Sie mein klägliches Gekritzel nicht in voller Länge lesen müssen!) Anhand dieser Schriftproben hat die Graphologin Christiane Sarreiter psychologische Kurzgutachten erstellt, aus denen Sie nun ablesen können, was die Handschrift über das Innerste ihrer Urheber verrät.
Nur so viel – bei mir stimmt jedes Wort …!
Ich hoffe, Sie haben beim Lesen dieser Sammlung ebenso viel Spaß wie ich beim Zusammenstellen!
Liebe Grüße,
Ihr Sebastian Fitzek
Berlin, im Juli 2010, bei gefühlten 50 Grad im Schatten
Nicht einschlafen
Sebastian Fitzek
Unter normalen Umständen hätte er sich nie vorstellen können, an einem Ort wie diesem Sex zu haben. Dabei war seine Vorstellungskraft weiß Gott nicht die schlechteste, wie sein Psychiater ihm unlängst bestätigt hatte. Allein der Gedanke, hier mit jemandem zu schlafen, war ebenso absurd wie die Umstände, die Martin Vahl in dieses Hotelzimmer geführt hatten. Niemand, der schon einmal eine Milbe unter dem Mikroskop gesehen hat, würde sich freiwillig auf diesem Laken wälzen, dessen Flecken an einen Mix aus Essensresten und Körperflüssigkeiten erinnerten; nicht die einzige Hinterlassenschaft der unzähligen Gäste, die vor ihm hier genächtigt hatten. Die Wände waren mit fettigen Fingerabdrücken übersät; auf dem Boden lag ein zerschlissener Teppich, und man hätte gut und gerne eine Stunde damit verbringen können, all seine Brandlöcher zu zählen. Und die Putzfrau, wenn es denn eine gab, hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, die ausgetretene Zigarette vor der Heizung vom Fußboden zu kratzen.
Was soll’s. Hier ist es scheiße, aber ich bin glücklich, dachte Martin und sah zur Badezimmertür, hinter der er das Wasser rauschen hörte. In dieser Hinsicht war Nadja der Mann in ihrer Beziehung. Während die meisten Frauen, die er kennengelernt hatte, nach dem Sex immer stundenlang kuscheln wollten, rannte sie sofort nach dem Orgasmus unter die Dusche. Am Anfang ihrer Beziehung hatte er sich noch darüber gewundert; heute freute er sich über dieses vertraute Ritual. Lange hatte er geglaubt, es nie wieder erleben zu dürfen.
Fast hätte ich sie verloren, dachte er melancholisch. Und dann wäre ich allein gewesen. Allein mit meinen Stimmen.
Die Sprungfedern knackten bedrohlich, als Martin sich zur Seite drehte, um die Nachttischschublade aufzuziehen. Er hätte sich nicht gewundert, ein gebrauchtes Kondom oder ein schimmliges Wurstbrötchen darin zu finden; umso erstaunter war er über den tadellosen Zustand der Bibel. Das Neue Testament, in Leder gebunden, mit Goldprägung und Lesezeichen.
Martin war kein besonders gläubiger Mensch. Eher einer von der Sorte, die sich mit der Behauptung: »Ich denke, es muss eine höhere Macht geben, aber ich würde sie nicht Gott nennen«, herauslog, wenn man ihn nach seiner Konfession fragte. Er war konfirmiert, aber das auch nur, weil ihm damals seine Mutter ein Computerspiel für seinen Kniefall versprochen hatte. Als ihm Jahre später mit der ersten Gehaltsabrechnung die Höhe der Kirchensteuer bewusst wurde, trat er sofort wieder aus. Daher suchte er heute weder Trost noch Bestätigung in der Bibel, sondern einfach nur Ablenkung.
Martin hatte mehrere Macken. Und von allen Macken, derer er sich bewusst war, zählte diese sicher zu den unbedeutendsten: Er konnte nicht einschlafen, ohne zuvor noch wenigstens eine Seite gelesen zu haben. Dabei war es ihm ganz egal, was er las. Ein Buch, eine Illustrierte, die Rückseite einer Packung Cornflakes oder die Inhaltsangabe auf einer Shampoo-Flasche; sogar eine Gebrauchsanweisung erfüllte ihren Zweck. Nach einem langen Tag (und heute war ein verdammt langer Tag gewesen) fühlte er sich meist, als ob in seinem Kopf ein Überdruckventil geplatzt wäre. Und es gab nur eine wirksame Methode, um den Pfeifton zu ersticken, den seine wild schweifenden Gedanken erzeugten: lesen, egal was.
Meinetwegen auch eine Bibel, wenn es hier nichts anderes gibt.
Mangels eines Fernsehers lag in diesem Null-Sterne-Loch nicht einmal die obligatorische TV-Zeitschrift aus. Normalerweise hatte Martin immer ein Buch (meistens einen Thriller) im Gepäck, wenn er auf Reisen ging. Doch Nadja und er hatten sich so spontan entschlossen, für ihre zweiten Flitterwochen auf die Malediven zu fliegen, dass ihnen gerade mal Zeit blieb, Badesachen, Kosmetika und Medikamente einzupacken. Den Rest, also auch Bücher, wollten sie am Flughafen kaufen, doch hatte der Schneesturm ihre Pläne im Keim erstickt.
Martin schlug zufällig die Bergpredigt auf, die Passage, in der Jesus zu den Menschen spricht: »Liebet eure Feinde.« Er fragte sich kurz, ob Liebe denn eine Entscheidung sei, die man bewusst treffen könne, oder nicht viel eher ein Gefühl, das sich nicht erzwingen ließe. Ebenso wenig, wie er sich befehlen könnte, dieses nach Schweiß und Schimmel stinkende Hotelzimmer zu lieben. Manche Dinge lagen einfach außerhalb jeder bewussten Kontrolle. Die Tatsache, dass er sich hier wohl fühlte – obwohl die Schränke mit einer Staubkruste überzogen waren und die Fenster sich nicht öffnen ließen –, war einzig und allein dem Umstand geschuldet, dass das hier, verglichen mit all dem, was er zuvor durchgemacht hatte, das Paradies war.
Ein Paradies ohne Stimmen. Ohne tödliche Befehle.
Er schloss die Augen und versuchte, seine morbiden Gedanken abzuschütteln. In den letzten Wochen hatte er sehr viel schlimmere Orte besucht. Orte, die vor ihm noch nie ein Mensch betreten hatte, denn sie befanden sich nicht in der realen Welt, sondern …
… ausschließlich in meinem Kopf.
Mit den Stimmen hatte alles angefangen, damals kurz nach der Fehlgeburt, die Dr.Jonas Gorman für den Auslöser seiner Halluzinationen hielt. Sie kamen aus der Wand, plötzlich und ohne Vorwarnung, wie aus dem Nichts. Das erste Mal hörte er sie unter der Dusche. Er hatte den Strahl auf kochend heiß gestellt, als ob er damit die schlechten Neuigkeiten einfach aus seinem Bewusstsein brennen könnte, die man ihnen erst wenige Stunden zuvor in der Kinderwunschklinik mitgeteilt hatte: »Eine Gelbkörperhormonschwäche. Das nächste Mal nehmen wir Utrogest zum Aufbau der Gebärmutterschleimhaut.«
Das nächste Mal. Scheiße. Es gab kein nächstes Mal.
»Es sei denn, du tötest sie.«
Zuerst hatte er sich gefragt, was zum Teufel in ihn gefahren war, so etwas Morbides zu denken; dann hatte er das Wasser abgestellt und gemerkt, dass es gar nicht seine Gedanken waren, die er gehört hatte. Sondern Stimmen, die zu ihm sprachen. Kinderstimmen. Verschiedene, die alle das Gleiche sagten:
»Du musst sie töten.«
Von diesem Tag an war nichts mehr wie zuvor. Martin war selbst Psychiater, spezialisiert auf psychosomatische Orthopädie; das bedeutete, er musste sich mehr mit Phantomschmerzen im Arm als mit schizophrenen Wahnvorstellungen im Kopf beschäftigen. Trotzdem war er genügend sensibilisiert, um die ersten Anzeichen ernst zu nehmen und sich nicht die Welt zurechtzubiegen. Denn das war das Wesen einer jeden Geisteskrankheit: die Realität zu leugnen, während man nach Argumenten suchte, weshalb die eigene Wahrnehmung richtig und die der anderen falsch war. Die vielen unterschiedlichen Kinderstimmen, die ihn später bis in seine Träume verfolgten und ihm wieder und wieder befahlen, »sie« zu töten, bevor er selbst sterben würde,waren nur ein Hirngespinst. Darum aber waren sie nicht weniger gefährlich.
Er suchte Dr.Jonas Gorman auf, einen alten Freund aus Studientagen, der ihn medikamentös einstellte, nicht ohne ihn vor den schweren Beeinträchtigungen zu warnen, die damit auf ihn zukommen würden. Und weder Gorman noch der Beipackzettel hatten zu viel versprochen. Mundtrockenheit, Hautekzeme, Übelkeit, Migräne, depressive Verstimmungen, Gewichtszunahme – Martin hatte ein Best-of-Medley aller gängigen Nebenwirkungen seiner Psychopharmaka abgearbeitet.
Kein Wunder, dass ihre Ehe in jenen Tagen »Schlagseite« bekam, wie sein Vater es formuliert hätte. Bereits die ewigen Fehlversuche hatten sie zermürbt und ihre Spuren hinterlassen. Und gerade jetzt, da alle Hoffnung schon wieder zerstört schien, hätte Nadja einen psychisch starken Partner an ihrer Seite gebraucht, keinen Schizo mit Visionen. Selbst noch betäubt von der Faust des Schicksals, die ihr in den Unterleib geschlagen und das Ungeborene entrissen hatte, wollte Nadja den Beteuerungen der Ärzte keinen Glauben schenken, dass bis zu 70 Prozent aller Schwangerschaften abgehen, die meisten davon unbemerkt. Sie machte ihr fortgeschrittenes Alter für die Fehlgeburt verantwortlich, verfiel erst in Selbstvorwürfe, zu lange mit dem Kinderwunsch gewartet zu haben, dann in Selbstmitleid, gleich doppelt gestraft zu sein: mit einer schwachen Gebärmutterschleimhaut und mit einem noch schwächeren Mann. Ihr Mitleid steigerte sich in Wut und später sogar in Hass, wenn sie im Fernsehen Berichte über ungewollte Schwangerschaften junger Mütter sah. Und Martin konnte ihre Wut verstehen. Gott musste – falls es ihn wirklich gab – einen exzentrischen Sinn für Humor haben, wenn es ihm gefiel, bei einer drogensüchtigen Kinderprostituierten das Kondom des Freiers platzen zu lassen, während er Nadja – einer Mutter, die ihr eigenes Leben für das Wohl ihres Babys opfern würde – einfach einen Strich durch die Hormonrechnung machte.
Nadja litt darunter, dass die Welt auf einmal mit Kinderwagen, werdenden Müttern und erschöpften Vätern bevölkert zu sein schien. Die Werbung pries nur noch Windeln, Babynahrung und Kindersitze an, und es verging kein Tag, an dem nicht irgendeine Bekannte anrief, um Glückwünsche für einen positiven Schwangerschaftstest loszuwerden. Wie sollte sie so jemals ihre Trauer verarbeiten und neue Hoffnung schöpfen können? Noch dazu mit einem Mann an der Seite, der ihr nicht zuhörte, weil er von imaginären Kinderstimmen abgelenkt wurde, die in seinem Kopf herumtobten.
»Töte sie. Schnell. Bevor es zu spät ist.«
Martin schreckte aus seinem Dämmerzustand hoch. Fast wäre ihm die Bibel aus der Hand gefallen.
»Süße?«, rief er in Richtung Badezimmer, doch seine Worte wurden vom Wasser verschluckt, das in die alte, emaillierte Badewanne prasselte. Nadja duschte niemals unter einer halben Stunde, würde also frühestens in zehn Minuten herauskommen. Anfangs hatte er sich oft darüber aufgeregt, dass sie zu den wenigen Menschen zählte, die mehr Wasser beim Duschen als beim Baden verbrauchten. Heute, nach all den Schicksalsschlägen, wollte er einfach nur, dass sie glücklich war; dafür durfte sie gerne den Atlantik trockenlegen, wenn das ihr Wohlbefinden steigerte.
Er streckte sich und drehte den Kopf so heftig zur Seite, dass seine Halswirbel knackten. Dann warf er wieder einen Blick in die Bibel, die er die ganze Zeit über geöffnet gehalten hatte. Verwundert las er den letzten Absatz. Er konnte sich gar nicht erinnern, bis zu der Stelle vorgeblättert zu haben, an der Jesus seinen Jüngern befahl, die Kinder zu ihm kommen zu lassen.
Den Kindern gehört das Reich Gottes, na klar. Deshalb rufst du sie auch so schnell zu dir nach oben, was?
Martin gähnte. Die Lektüre zeigte ihre einschläfernde Wirkung.
Noch einen Absatz, dann bin ich weg, dachte er, als er spürte, wie sich ein Fremdkörper aus den Seiten löste.
Der Zettel entfaltete sich bereits im Fallen. Noch bevor er auf die Bettdecke traf, konnte Martin die dünnen, ungelenken Striche auf dem Papier erkennen. Im selben Moment dachte er daran, einfach die Augen zu schließen.
Gar nicht beachten. Der Zettel hat nichts zu bedeuten.
Wahrscheinlich hatte jemand eine Telefonnummer notiert, eine Uhrzeit oder einen Namen. Dinge, die man eben auf einen Notizblock kritzelte, wenn man am Telefon den Termin bestätigte, der einen in diese Absteige verschlagen hatte.
Nichts Interessantes. Unbedeutendes Geschreibsel.
Martin war müde, wollte endlich schlafen. Er spürte allerdings, dass ihn der Sekundenschlaf, aus dem er eben aufgeschreckt war, wieder aufgeputscht hatte. Jetzt musste er wenigstens noch eine weitere Seite lesen, sonst würde es ihm nicht gelingen, ein zweites Mal wegzudämmern.
Also kann ich mir auch gleich den Zettel vornehmen, dachte er, amüsiert darüber, wie einfach doch die menschliche Neugier zu entfachen war. »Stell zehn Menschen vor ein Schlüsselloch und mach etwas Lärm hinter der Tür. Neun werden sich bücken und hindurchschauen«, hatte ihm sein Vater einmal gesagt.
Martin legte die Bibel zurück auf den Nachttisch, gähnte lautstark und griff nach dem Papier in seinem Schoß.
Zwei Sätze.
Beide in einer ungelenken, nervösen Handschrift verfasst, alles in Großbuchstaben. Er musste schmunzeln, als er die ersten beiden Worte las. Dann drehte er den Zettel, um den zweiten Satz lesen zu können, der unter dem Knickfalz stand. Es dauerte eine Weile, bis er die Bedeutung der Worte begriff.
Den Zusammenhang. Den Befehl.
Zuerst dachte er immer noch an einen Scherz, allerdings an einen sehr, sehr schlechten, denn auf dem Zettel stand:
Nicht einschlafen …
oder sie bringen dich um.
Von dieser Sekunde an war Martin hellwach.
Sein erster Gedanke galt Nadja, die mittlerweile unter der Dusche zu summen begonnen hatte (»Autumn Leaves«, das Stück, das der Klavierspieler im Restaurant bei ihrem allerersten Kuss gespielt hatte) und die nicht wusste, was hier draußen gerade mit ihm geschah.
Was in mir geschieht!
Dann dachte er an sein Handy und an die einzige Nummer im Speicher, die er jetzt wählen konnte. Er legte den Zettel auf den Nachttisch und stand auf.
Irgendetwas bohrte sich in seine Fußsohle, als er barfuß zu seiner Jacke ging, die er an einen Haken neben der Tür gehängt hatte. Das unangenehme Gefühl sorgte zumindest für eine Unterbrechung seiner verwirrten Gedanken. Anders als seine Angst war der Schmerz in seinem Fuß real, und für einen kurzen Augenblick gelang es ihm, sich etwas zu beruhigen.
Ruhig, ganz ruhig, dachte er. Du machst dich lächerlich. Das hat nichts zu bedeuten.
Immerhin waren es keine Stimmen, die er hörte. Und der Zettel hatte sich echt angefühlt.
Und er ist echt! Ich sehe ihn immer noch neben der Bibel liegen, dachte Martin und zwang sich zu lachen. Dr.Gorman hatte ihm zwar gesagt, dass die haptischen Visionen die akustischen Halluzinationen ablösen könnten, wenn es schlimmer werden würde. Aber dieser Zettel war nichts als ein schlechter Scherz eines wütenden Gastes, der ihn aus reiner Bosheit für seinen Nachfolger dort plaziert hatte, damit dieser in diesem Drecksloch auch nicht einschlafen konnte.
Reiner Zufall, dass er gerade mir in die Hände gefallen ist.
Ausgerechnet einem Patienten, der wegen seiner schizophrenen Schübe behandelt wurde.
Alles okay, kein Grund zur Panik. Du hast keinen Rückfall.
Martins Puls sank langsam ab, und vermutlich hätte er sich wieder vollständig beruhigen können, wenn sein Blick nicht zur Eingangstür gewandert wäre.
»Jonas?«, rief er aufgeregt in sein Handy, nur eine halbe Minute nachdem er den zweiten Zettel gefunden hatte. Er stand direkt vor dem schlierigen Fenster seines Hotelzimmers und starrte auf eine Batterie Mülltonnen in einem verschneiten Hinterhof.
»Ist was passiert?«, fragte Dr.Gorman mit belegter Stimme. Man konnte ihm anhören, dass er überlegte, ob das Telefonat noch Teil des Traums war, aus dem Martin ihn gerade gerissen hatte.
»Ja. Ich glaube ja. Wir haben sie zu früh abgesetzt.«
Martin hörte das Rascheln von Bettwäsche, dann:
»Der Reihe nach. Was ist los bei dir?«
»Ich habe wieder Visionen.«
»Stimmen? Hörst du Stimmen?«
»Nein«, antwortete Martin seinem Freund und Psychiater. »Diesmal ist es haptisch. Ich finde Nachrichten.«
Gorman seufzte und entschuldige sich bei jemandem im Hintergrund, vermutlich seiner Frau, die nun ebenfalls aufgewacht war. Während der Psychiater offensichtlich das eheliche Schlafzimmer verließ, um ungestört reden zu können, legte Martin die zweite Botschaft, die er unmittelbar vor der Eingangstür gefunden hatte, auf das Fensterbrett. Er drehte den Zettel um, denn er wollte den Befehl nicht noch ein zweites Mal lesen müssen.
Töte sie!
»Wo zum Teufel bist du gerade?«, meldete sich Gorman wieder.
Martin seufzte.
»Die Pension nennt sich Hotel Vier Jahreszeiten, klingt hochtrabend, ist aber nur eine windschiefe Bude am Rande einer Landstraße irgendwo zwischen Hof und Plauen.«
»Was hast du da verloren?«
»Wir wollten verreisen, ein spontaner Entschluss. Du selbst hast doch gesagt, etwas Sonne würde nicht schaden.«
Tatsächlich hatte Gorman ihm die Idee mit den zweiten Flitterwochen in den Kopf gesetzt, zur Feier der Entwicklung, dass die medikamentöse Behandlung endlich erste Erfolge zeigte. Und das nicht nur bei Martin. Mit den Stimmen in seinem Kopf verschwanden zuerst die Erschöpfung und schließlich der Trübsinn aus Nadjas Seele. Nicht sofort, sondern in kleinen Schritten, die sie nun aber wieder mit ihrem ansprechbaren Ehemann gemeinsam zurücklegen konnte.
»Als ich sagte, ihr sollt mal Urlaub machen, um wieder zueinanderzufinden, meinte ich die Karibik oder den Indischen Ozean, nicht den Frankenwald«, sagte Gorman.
»Wir wollten ja auch auf die Malediven. Scheiße, das war einfach so eine fixe Idee, weil es uns beiden wieder bessergeht; wir haben gar nicht lange nachgedacht.«
Martin sah kurz zur Badezimmertür; das Rauschen des Wassers hielt unvermittelt an.
»Wir wollten heute noch abfliegen, aber die einzige freie Maschine ging von Leipzig aus, also haben wir uns ins Auto gesetzt und sind losgefahren. Leider ohne Winterreifen. Als ich zum Pinkeln kurz im Wald halten wollte, hab ich die Karre festgefahren. Und auf dem Weg zur nächsten Werkstatt sind wir dann hier vorbeigekommen.«
Hier, in diesem Drecksloch.
Schon das kaputte Neonschild über dem Eingang des Hotels war eher eine Warnung als eine Einladung. Und der Mann an der Rezeption hatte sie wie Außerirdische angestarrt, als sie einchecken wollten.
»Ein Zimmer?«, hatte er nachgefragt und dabei die Stirn in Falten gelegt, als könnte er sich nur dunkel daran erinnern, so etwas in seinem Hotel anzubieten. Dabei hatte er mit seinem behaarten Zeigefinger über das leere Papier eines Reservierungsbuchs gestreichelt. Schließlich hatte er ihnen wortlos den Schlüssel mit der Nummer 211 gereicht, noch bevor Martin Nadja vorschlagen konnte, doch besser ein anderes Hotel zu suchen.
Gorman räusperte sich, dann fragte er vorsichtig:
»Okay, und jetzt hörst du wieder diese unheimlichen Botschaften?«
»Nein, ich höre sie nicht. Ich sehe sie. Gottverdammt, ich hätte die Pillen nicht so früh absetzen dürfen. Sag mir bitte, was ich machen soll, Jonas. Nadja kommt in zwei Minuten aus dem Bad. Wir waren gerade wieder über dem Berg, ich darf das nicht schon wieder versauen, verstehst du? Du musst mir helfen.«
»Was sind das für Nachrichten?«
»Befehle!«
Martin erzählte ihm von der Drohung und auch von dem zweiten Zettel, den er direkt vor der Tür gefunden hatte.
»Du sollst Nadja töten?«
»Ja.«
Stille. In den folgenden Sekunden sagte sein Freund und Kollege kein Wort. Dann, es war bestimmt eine halbe Minute vergangen, seufzte Gorman:
»Hör mir gut zu. Ich weiß, das ist jetzt schwer zu verstehen, aber du musst dich auf meine Worte konzentrieren, ja?«
»Ich versuch es.«
»Du hast vermutlich recht.«
»Es geht wieder los?«
»Ja. Aber das ist nicht schlimm, verstehst du? Dadurch, dass du mich angerufen hast, hast du die erste Hürde bereits genommen.«
»Was soll ich tun?«
Was zum Teufel ist die zweite Hürde?
»Du musst dich deiner Angst stellen«, riet ihm der Psychiater.
Angst ist die Giftschlange des Todes, erinnerte sich Martin an eine weitere Lebensweisheit seines Vaters.
Füttere sie nicht zu oft, sonst zieht sie dich in ihr Nest.
»Wie?«, fragte er.
Wie soll ich mich der Angst stellen?
»Geh zu Nadja hinein.«
»Das kann ich nicht.«
»Ruhig, Martin. Ganz ruhig. Atme tief durch und sprich mir nach: Es gibt keine Zettel. Keine Befehle. Das alles ist nicht real.«
Martin wiederholte die Worte seines Freundes, ohne wirklich daran zu glauben.
»Aber was, wenn ich selbst die Zettel dort plaziert habe?«, fragte er danach. »Was, wenn ich wirklich eine Gefahr bin?«
Er hörte, wie Gorman ungeduldig mit der Zunge schnalzte.
»Das bist du nicht. Glaube mir, Martin, ich kenne dich zu gut. Darüber haben wir in all den Sitzungen doch schon hundert Mal gesprochen. Du würdest keinem Menschen etwas zuleide tun. Erst recht nicht deiner Frau. Du liebst sie, oder?«
»Ja.«
»Und du hast keine Waffe in deiner Hand?«
»Nein.«
»Nichts, womit du Nadja gefährlich werden könntest, richtig?«
»Richtig.«
Während sie sprachen, war Martin ziellos im Zimmer auf und ab gelaufen. Jetzt hielt er atemlos inne, direkt vor der geschlossenen Badezimmertür.
»Geh hinein«, sagte Gorman. »Öffne die Tür, schau ihr in die Augen. Umarme sie. Du wirst sehen, dann ist der Bann gebrochen. Du bist nicht gefährlich. Du wirst deiner Frau nichts tun.«
Martin nickte und legte seine zitternden Finger auf die Türklinke. Plötzlich presste er die Hand auf den Mund, um einen Schrei zu unterdrücken.
»Was?«, fragte Gorman.
»Da ist noch einer.«
»Wer ist da noch?«
»Ein Zettel.«
Martin ging in die Knie. Sein Zeigefinger strich über die roten Druckbuchstaben auf dem rauhen Klopapier, so wie vorhin der Finger des merkwürdigen Mannes an der Rezeption über das leere Reservierungsbuch. Diesmal war die Nachricht offenbar mit einem Lippenstift verfasst worden.
»Glaub nicht, was du siehst«, sagte Gorman. »Es gibt keinen Zettel.«
»Doch«, widersprach er. »Ich halte ihn gerade in meiner Hand!«
Dann las er die Nachricht ab:
Geh ins Badezimmer. Töte sie!
Gorman stöhnte entnervt.
»Du irrst dich. Darüber haben wir doch schon so oft gesprochen. Das alles geschieht nur in deinem Kopf, verstehst du?«
»Nein, ich verstehe nichts«, sagte Martin, und das entsprach der Wahrheit.
Hinter der Holztür quietschte ein Wasserhahn. Das Rauschen hatte aufgehört. Die Stille, die jetzt das gesamte Hotelzimmer verschluckte, wirkte wie ein Fremdkörper. Fremd und unwirklich.
Wie ein Zettel, der aus einer Bibel fällt.
»Nimm dich zusammen, Martin, du schaffst das.«
»Meinst du wirklich?«
»Ja. Alles, was du tun musst, ist, durch die Tür vor dir zu gehen. Ist sie verschlossen?«
»Nein«, sagte Martin nach einem kurzen Blick auf das Schloss. »Ich glaube nicht.«
»Dann los. Klopf an. Ruf ihren Namen.«
Ich kann das nicht, dachte Martin und war am Ende selbst erstaunt, dass er es doch fertigbrachte.
»Nadja?« Er klopfte zaghaft an die Tür, das Handy immer noch an seinem Ohr.
»Lauter«, riet ihm Gorman, doch Martin fühlte sich bereits durch sein Flüstern erschöpft. Um sich besser konzentrieren zu können, legte er das Telefon auf den Boden. Direkt neben das Stück Toilettenpapier mit der Lippenstiftbotschaft.
… Geh rein. Töte sie. Sonst …
»Los, weiter«, drängte Gorman, doch Martin konnte ihn schon nicht mehr hören. Er hatte sich wieder aufgerichtet und begann zu zählen. Bei drei wollte er die Tür aufreißen. Letztlich kam er nicht mehr dazu. Seine Frau war schneller.
Mit Nadja drang ein Schwall heißer Luft in das Schlafzimmer. Ihre warme Haut war gerötet, und ihre glänzenden, langen Haare dufteten nach Lavendel.
»Was hast du?«, fragte sie erschrocken, als Martin ihr ins Gesicht fassen wollte. Sie wich zurück. Ihr Lächeln gefror und wich einem undefinierbaren Gefühlsausdruck.
»O Nadja«, hörte Martin sich selbst schluchzen. Er zitterte vor Erschöpfung, und ihm wurde schwindelig. Er wankte in das überhitzte Badezimmer und setzte sich, bevor er vollends das Gleichgewicht verlor, auf den geschlossenen Toilettendeckel. Langsam lichtete sich der Dampf, der die hässliche Einrichtung bislang verhüllt hatte. Der Duschvorhang hing nur noch an drei von zehn Ringen auf der Schiene, mehrere Bodenfliesen waren lose oder fehlten völlig, und selbst der Spiegel über dem Waschbecken war zerbrochen. Wahrscheinlich hatte irgendein betrunkener Gast mit der Faust hineingeschlagen.
Martin versuchte, sich wieder zu sammeln, und folgte Nadja zurück ins Schlafzimmer.
»Tut mir leid, Liebes. Ich fürchte, ich bin völlig durcheinander«, sagte er. Sie hatte sich in ihr Bett gelegt, in dem sie sich noch vor einer halben Stunde so nahe gewesen waren. Jetzt schienen Welten zwischen ihnen zu liegen.
»Es tut mir so leid, aber ich habe wieder …«
… wieder diese Visionen. Er traute sich nicht, die Worte auszusprechen, die sie noch weiter voneinander entfernen würden. Nur aus diesem Grund waren sie doch überhaupt in diesem Loch gelandet. Wegen ihrer euphorischen Hochstimmung. Wegen ihrer Freude darüber, dass mit ihm wieder alles in Ordnung war. Dass sie wieder eine gemeinsame Zukunft hatten.
Mit Kindern.
Ohne Stimmen.
»Was ist passiert?« Nadja rutschte unruhig unter dem Laken hin und her, das sie bis zum Kinn hochgezogen hatte.
»Ich hab überall diese Zettel gefunden …«
Er zögerte, dann ging er zu seiner Seite des Bettes und suchte nach der ersten Warnung, die aus der Bibel gefallen war.
Die ich auf den Nachttisch gelegt hatte.
»Was für Zettel?«, fragte Nadja, während Martin auf die leere Ablage starrte.
»Eben war er noch da«, krächzte er heiser, dann lief er zum Fensterbrett, doch auch hier war die Notiz mit dem tödlichen Befehl verschwunden, ebenso wie das Stück Klopapier. Vor der Badezimmertür lag jetzt nur noch das Handy, und das Display war dunkel.
Hat Jonas etwa aufgelegt? Oder hab ich gar nicht mit ihm telefoniert?
Martin spürte, wie sich seine Augen mit Tränen füllten. Er blickte zur Decke hoch, als könne er dadurch ein Überlaufen verhindern.
»O Nadja, es tut mir so leid«, schluchzte er erneut.
»Was stand denn drauf, auf diesen Zetteln?«
»Ach, nur dummes Zeug.« Er setzte sich auf die Bettkante und vergrub den Kopf in beide Hände.
»Dass ich nicht einschlafen dürfte, sondern zu dir ins Bad gehen müsste, um dich …« Er stockte.
»Um was zu tun?«, hörte er sie hinter sich fragen.
Und dann biss sie zu.
Die Angst.
Die Giftschlange des Todes.
Martin begann wieder zu zittern und suchte nach einer rationalen Erklärung, weshalb die Stimme, die er eben gehört hatte, nicht länger die von Nadja war.
Sondern ihre.
Die der Kinder.
Langsam, als könne er das Unvermeidliche dadurch hinauszögern, drehte er sich zu seiner Frau.
»Suchst du die hier?«, fragten die Lippen in ihrem Mund, jedes Wort mit einer anderen kindlichen Stimme artikuliert.
Das sind sie. Die Stimmen, die ich immer gehört habe.
Deretwegen ich in Behandlung war!
Seine Frau hatte das Laken zurückgeschlagen. Sie öffnete ihre Hand und zeigte ihm die Zettel. Sie musste sie eingesammelt haben, während er im Bad den Schwächeanfall überwunden hatte.
»Du hättest auf Nadja hören sollen«, sagten die Stimmen aus ihrem Mund, und schlagartig wurden Martin mehrere Dinge zugleich bewusst: dass nicht er, sondern seine Frau über den Verlust des Babys wahnsinnig geworden war. Dass die Stimmen, die er gehört hatte, den verschiedenen multiplen Persönlichkeiten gehörten, in die sie nach der Tragödie zersplittert war.
Sie haben zu mir geredet. Ich habe sie gehört. Über die Wasserrohre, wenn ich unter der Dusche stand. In meinen Träumen, wenn sie neben mir lag und mit mir sprach.
Jetzt verstand er, dass Nadja ihn in ihren lichten Momenten mit den geschriebenen Hinweisen angefleht hatte, diese Stimmen in ihr zu töten – bevor er selbst zum Opfer würde.
Töte sie. Geh rein, bring sie um, sonst …
Zuletzt begriff Martin, dass er alle Zeichen falsch gedeutet hatte, dass er auf die falschen Stimmen gehört hatte. Und als er das Spiegelbild seiner Augen in dem Splitter sah, der sich nur einen Wimpernschlag später in seine Halsschlagader bohren sollte, erinnerte er sich, dass der Spiegel zu den wenigen Einrichtungsgegenständen gezählt hatte, die bei ihrer Ankunft in dieser Absteige noch intakt gewesen waren.
Schöne Bescherung
Val McDermid
1
Der Himmel war ein einziges Farbenmeer. »Oooh«, entfuhr es dem Mann; aus seinen blauen Augen schienen Funken zu sprühen.
»Aaah«, sagte die Frau. Obwohl sie nur diese eine Silbe ausstieß, war der ironische Unterton nicht zu überhören. Ihre wuscheligen blonden Haare erstrahlten in den Farben der Raketen und ließen sie wie eine Punklady aussehen – im krassen Gegensatz zum traditionellen Schnitt ihrer Jacke und ihrer Hose.
»Ich hatte schon immer eine Schwäche für Feuerwerk.«
»Könnte es sein, dass tief in deinem Inneren ein Pyromane steckt?«
Dr.Tony Hill, klinischer Psychologe und Profiler im Polizeidienst, machte ein reuevolles Gesicht. »Ertappt, Chef.« Er registrierte ein Lächeln auf ihrem Gesicht. »Aber gib es schon zu. Du stehst doch auch auf die Bonfire-Night.« Feuerwerkskörper überzogen den Himmel mit roten und grünen Streifen und hinterließen tanzende Farbpunkte, sobald er seine Augenlider schloss.
Detective Chief Inspector Carol Jordan schnaubte zornig. »Überhaupt nicht. Kinder werfen Knallfrösche in die Briefkästen fremder Leute, Betrunkene stecken sich brennende Feuerwerkskörper in den Hintern, Verrückte schmeißen mit Steinen, wenn die Feuerwehr ausrückt und sich um Freudenfeuer kümmert, die außer Kontrolle geraten sind – ich könnte mir keine schönere Nacht vorstellen.«
Tony schüttelte den Kopf; so einfach wollte er sich ihrem Sarkasmus nicht geschlagen geben. »Das ist lange her, dass du dich mit solchem Mist herumärgern musstest. Heutzutage sind es doch die Topverbrecher, die dir das Leben schwermachen.«
Wie auf Kommando schrillte Carols Handy. »Schrecklich«, seufzte sie, drehte sich zur Seite und steckte einen Finger ins andere Ohr. »Was gibt es, Sergeant Devine?«
Tony blendete den Anruf aus und widmete seine ganze Aufmerksamkeit wieder dem Feuerwerk. Plötzlich spürte er Carols Hand auf seinem Arm. »Ich muss los.«
»Soll ich mitkommen? Brauchst du mich?«
»Ich weiß nicht. Es wird schon nicht so schlimm werden.«
Das wäre das erste Mal. Tony folgte Carol zum Wagen, während hinter ihnen der Himmel zischte und brodelte.
Es roch nach verbranntem Fleisch – ein süßer, widerlicher, durchdringender Geruch, der sich in Carols Nasenlöchern festsetzte und noch tagelang nachwirken sollte. Angeekelt inspizierte sie die schreckliche Szene, die sich ihr bot.
Das Feuer war nicht besonders groß, aber es musste eine riesige Stichflamme entwickelt haben. Jemand hatte es am Rand eines brachliegenden Feldes entzündet, direkt neben einem Gatter, so dass es von der Straße aus nicht zu sehen war. Der leichte Abendwind hatte ausgereicht, um Funken in die angrenzende Hecke zu blasen, und die schnell auflodernden Flammen riefen die Feuerwehr auf den Plan. Nachdem der Brand gelöscht war, untersuchten die Feuerwehrleute die nassen, noch dampfenden Überreste. Schnell hatten sie die Quelle für den bestialischen Gestank ausgemacht, der sogar den Geruch des Benzins überdeckte, das als Brandbeschleuniger benutzt worden war.
Tony streifte am Rande des Feldes umher und inspizierte den Ort, der Schauplatz für ein weitaus schlimmeres Verbrechen als Brandstiftung war. Inzwischen befragte Carol den Einsatzleiter der Feuerwehr. »Das Ganze hat nicht lange gedauert«, meinte er. »Dem Geruch nach könnte er eine Mischung aus verschiedenen Brandbeschleunigern wie Petroleum und Aceton verwendet haben. Lauter Zeug, das normalerweise in jeder Garage herumsteht.«
Tony starrte auf die menschlichen Überreste; er runzelte die Stirn. Dann drehte er sich um und rief dem Einsatzleiter zu: »Lag der Körper zu Beginn des Feuers in der Mitte, so wie jetzt?«
»Sie meinen, ob das Holz um ihn herum aufgeschichtet worden ist?«
Tony nickte. »Genau.«
»Nein. Schauen Sie, wie das umliegende Holz in sich zusammengefallen ist. Daraus können Sie erkennen, dass er oben auf dem Holzstoß gelegen haben muss.«
»Wie ein Opfertier.« Das war keine Frage. Die Antwort des Einsatzleiters hatte nur bestätigt, was Tony die ganze Zeit schon vermutet hatte. Sein Blick traf Carol. »Jetzt brauchst du mich doch.«