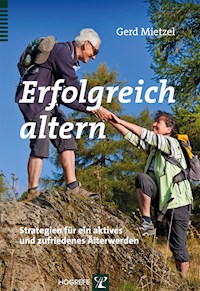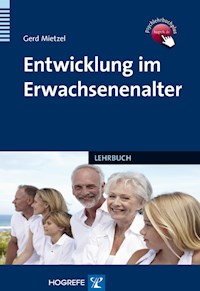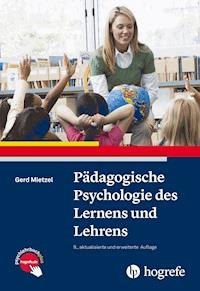
42,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Das Lehrbuch zählt zu den Standardwerken in der Ausbildung von Studierenden der Pädagogischen Psychologie, der Pädagogik und des Lehramts. Der Leser erhält einen gut verständlichen und umfassenden Einblick in die Pädagogische Psychologie. Vor allem aus konstruktivistischer Sicht werden Themen wie (kooperatives) Lernen, Gedächtnis, Denken, Motivation und pädagogische Diagnostik dargestellt. Dabei wird davon ausgegangen, dass Lernen nicht nur in Kindheit und Jugend, sondern ebenso im Erwachsenen- alter stattfindet und entsprechend angeregt werden kann. In der 9., aktualisierten und erweiterten Auflage wurden aktuelle Studienergebnisse sowie neue Forschungsfelder und Fachbegriffe ergänzt. Wichtige Themen, wie etwa Klassenführung, werden ausführlicher dargestellt. Ein Schwerpunkt des Bandes liegt auf dem Bezug zur Praxis und der Anwendbarkeit der Konzepte im Unterricht. Zahlreiche Beispiele sowie Zusammenfassungen am Kapitelende sollen dem Leser zusätzlich helfen, sich den Inhalt dieses Buches zu erarbeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Gerd Mietzel
Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens
9., aktualisierte und erweiterte Auflage
Prof. Dr. Gerd Mietzel, Studium der Psychologie und Erziehungswissenschaften. Seit 1970 Professor an der Pädagogischen Hochschule Ruhr, Abteilung Duisburg, jetzt: Universität Duisburg Essen, Campus Essen.
Informationen und Zusatzmaterialien zu diesem Buch finden Sie unter www.hogrefe.de/buecher/lehrbuecher/psychlehrbuchplus
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Die 1. und 2. Auflage des Buches erschienen unter dem Titel „Pädagogische Psychologie. Eine Einführung für Pädagogen und Psychologen“. Die 3. und 4. Auflage des Buches erschienen unter dem Titel „Psychologie in Unterricht und Erziehung“.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © Monkey Business Images/Shutterstock
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
Format: EPUB
9., aktualisierte und erweiterte Auflage 2017
© 1973, 1975, 1986, 1993, 1998, 2001, 2003, 2007 und 2017 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2457-6; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2457-7)
ISBN 978-3-8017-2457-3
http://doi.org/10.1026/02457-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Kapitel Lernen, Lehren und die Pädagogische Psychologie
1.1 Kennzeichnung der Pädagogischen Psychologie
1.1.1 Zielsetzungen der Pädagogischen Psychologie
1.1.2 Über implizites Wissen und Schwierigkeiten seiner Veränderung
1.1.3 Pädagogische Psychologie als wissenschaftliches Arbeitsgebiet
1.1.4 Pädagogische Psychologie als Grundlagen- und Anwendungsfachgebiet
1.2 Kennzeichnung des Lernens aus unterschiedlichen Sichtweisen
1.2.1 Lernen aus traditionell behavioristischer Sicht
1.2.2 Lernen als das Ergebnis eines Prozesses der Informationsverarbeitung
1.2.3 Zielerreichendes Lernen
1.2.4 Lernen aus konstruktivistischer Sicht
1.3 Verarbeitung pädagogisch-psychologischer Erkenntnisse
1.4 Über Akzeptanz und Anwendbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse durch Studierende
1.4.1 Unzulänglichkeiten herkömmlicher Lehrveranstaltungen
1.4.2 Praktische Unterrichtsversuche
1.4.3 Problembasiertes Lernen
1.5 Ziele und Nutzungsmöglichkeiten nachfolgend dargestellter Textinformationen
2. Kapitel Persönlichkeitsmerkmale des Lehrers, sein Wissen vom Gehirn und seine Unterrichtsführung
2.1 Kennzeichen erfolgreicher Lehrer
2.1.1 Erste Voraussetzung: Fachwissen
2.1.2 Zweite Voraussetzung: Pädagogisches Fachwissen
2.1.3 Dritte Voraussetzung: Lehrer-Selbstwirksamkeit
2.1.4 Vierte Voraussetzung: Hohe Leistungserwartungen
2.1.5 Fünfte Voraussetzung: Klarheit
2.1.6 Sechste Voraussetzung: Begeisterung
2.1.7 Siebte Voraussetzung: Fürsorgliche Zuwendung
2.1.8 Achte Voraussetzung: Bereitschaft zur Selbstkritik
2.2 Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht
2.2.1 Einige Grundlagen des menschlichen Gehirns
2.2.2 Möglichkeiten der Förderung der Gehirnfunktionen
2.2.3 Unbegründete Annahmen über das Gehirn: Neuromythen
2.3 Gute Klassenführung als Voraussetzung für effektives Lernen
2.3.1 Klassifikation verschiedenartiger Aktivitäten in Unterrichtsstunden
2.3.2 Kennzeichnung der Klassenführung und ihre Ziele
2.3.3 Strategien zur Förderung einer engagierten Lernzeit
2.3.4 Klassenführung im schülerzentrierten Klassenzimmer
3. Kapitel Pädagogische Förderung aus entwicklungspsychologischer Sicht
3.1 Menschliche Entwicklung und ihre Determinanten
3.1.1 Einige Kennzeichen der Entwicklung
3.1.2 Entwicklungsmechanismen
3.2 Jean Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung
3.2.1 Mechanismen kognitiver Entwicklung bei Piaget
3.2.2 Erklärung der kognitiven Entwicklung
3.2.3 Phasen der kognitiven Entwicklung
3.2.4 Kritische Überprüfung und Revisionen einiger Annahmen Piagets
3.2.5 Der Einfluss Piagets auf die Unterrichtsarbeit
3.3 Vygotskijs Theorie der kognitiven Entwicklung
3.3.1 Grundlegende Annahmen Vygotskijs
3.3.2 Einfluss Vygotskijs auf die Unterrichtsarbeit
3.4 Kognitive Entwicklung und Lernen im Erwachsenenalter
3.4.1 Die Entwicklung der Fähigkeit zu lernen im Erwachsenenalter
3.4.2 Beeinträchtigungen der Lern- und Leistungsfähigkeit
3.4.3 Empfehlungen zur Gestaltung eines effektiven Unterrichts für Erwachsene
4. Kapitel Grundlegende Prozesse des Lernens: Von der Fremd- zur Selbststeuerung
4.1 Erlernen von Assoziationen durch klassische Konditionierung
4.1.1 Pavlovs klassisches Konditionierungsexperiment
4.1.2 Weitere Begriffe und Prozesse der klassischen Konditionierung
4.1.3 Das Erlernen emotionaler Reaktionen
4.1.4 Klassisches Konditionieren im Klassenzimmer
4.1.5 Abbau von Furcht durch Gegenkonditionierung
4.2 Instrumentelle Konditionierung
4.3 Die operante Konditionierung
4.3.1 Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit operanter Verhaltensweisen
4.3.2 Entstehung von Löschungsresistenz durch partielle Verstärkung
4.3.3 Empfehlungen zur Vergabe von Lob und sozialer Anerkennung
4.3.4 Erhöhung der Auftretensfrequenz von Verhaltensweisen durch negative Verstärkung
4.3.5 Entstehung neuer Verhaltensabfolgen durch Formung
4.3.6 Verminderung der Auftretensfrequenz von Verhalten durch Extinktion
4.3.7 Wirkung von Bestrafung
4.3.8 Aufbau und Funktion diskriminativer Reize
4.4 Einige Grundlagen der sozial-kognitiven Theorie
4.4.1 Vergleich von Behaviorismus und sozial-kognitiver Theorie
4.4.2 Zugrunde liegende Prozesse des Beobachtungslernens
4.4.3 Stellvertretendes Lernen
4.4.4 Wirksamkeit von Modellen
4.4.5 Wirkungen des Beobachtungslernens
4.5 Selbststeuerung des Verhaltens und Lernens
4.5.1 Maßnahmen zur verbesserten Kontrolle von impulsiven und Gewohnheitsreaktionen
4.5.2 Kennzeichnung des selbstgesteuerten Lernens im leistungsthematischen Kontext
4.5.3 Systematische Förderung des selbstgesteuerten Lernens
5. Kapitel Lernen als aktive Verarbeitung von Informationen
5.1 Das menschliche System zur Verarbeitung von Informationen
5.2 Drei Komponenten des menschlichen Gedächtnisses
5.2.1 Das sensorische Register
5.2.2 Kontrollprozesse
5.2.3 Das Arbeitsgedächtnis
5.2.4 Das Langzeitgedächtnis
5.3 Förderung dauerhaften Behaltens
5.3.1 Aktivierung des Vorwissens
5.3.2 Prozesse zur Aufarbeitung neuen Lernmaterials
5.4 Weitere Empfehlungen zur Förderung des Behaltens
5.4.1 Darbietung der Lerninhalte in organisierter Form
5.4.2 Strategien zur Verarbeitung dargestellter Informationen
5.5 Mnemotechniken zur Erarbeitung sinnlos erscheinenden Lernmaterials
5.6 Wissen über eigene kognitive Prozesse: Metakognitionen
5.6.1 Wissen über eigene Aufmerksamkeitsprozesse und ihre Kontrolle
5.6.2 Wissen über eigene Gedächtnisprozesse und ihre Kontrolle
5.7 Theorien des Vergessens
5.7.1 Die Theorie des Spurenverfalls
5.7.2 Interferenztheorie
5.7.3 Das Fehlen geeigneter Abrufreize
5.8 Abschließende Betrachtung
6. Kapitel Problemlösen und seine Voraussetzungen
6.1 Das Erlernen von Begriffen
6.1.1 Theorien des Begriffslernens
6.1.2 Förderung des Begriffserwerbs im Unterricht
6.2 Förderung konzeptueller Veränderungen
6.2.1 Entstehung naiven Wissens durch alltägliche Erfahrungen
6.2.2 Konfrontation des Schülers mit wissenschaftlich begründetem Wissen
6.2.3 Gründe für Schwierigkeiten zur Erreichung konzeptueller Veränderungen
6.2.4 Strategien zur Förderung konzeptueller Veränderungen
6.3 Das Lösen von Problemen
6.3.1 Das Lösen von Problemen aus allgemein-psychologischer Sicht
6.3.2 Vergleich von Experten und Novizen beim Lösen von Problemen
6.3.3 Förderung des Problemlösens im Unterricht
6.4 Übertragung von Gelerntem auf neue Situationen: Transfer
6.4.1 Kennzeichnung des Transfers und einige seiner Bedingungen
6.4.2 Abhängigkeit des Transfers von unterrichtlichen Bedingungen
7. Kapitel Förderung der Lern- und Leistungsmotivation
7.1 Kennzeichnung des lern- und leistungsmotivierten Verhaltens
7.1.1 Lernmotivation als zielgerichtetes Verhalten mit unterschiedlichem Engagement
7.1.2 Abwehr von Ablenkungen durch Einsatz emotionaler und kognitiver Strategien
7.2 Kontrolle motivierten Verhaltens von innen und von außen
7.2.1 Intrinsisch motivierte Aktivitäten
7.2.2 Extrinsisch motivierte Aktivitäten
7.2.3 Unmotivierte Lernende
7.3 Verschiedene Sichtweisen motivierten Verhaltens
7.3.1 Die behavioristische Sichtweise
7.3.2 Erklärungen für Aktivitäten zur Befriedigung von Bedürfnissen
7.4 Kognitive Sichtweisen
7.5 Die sozial-kognitive Sichtweise
7.5.1 Unterscheidung zwischen Arbeit und Leistung
7.5.2 Erwartung×Wert-Theorie der Motivation
7.5.3 Selbstwirksamkeit: Einschätzungen eigener Fähigkeiten
7.5.4 Erklärungen von Handlungsergebnissen
7.5.5 Erlernte Hilflosigkeit
7.5.6 Selbstwerttheorie der Leistungsmotivation
7.5.7 Lernen unter verschiedenen Zielorientierungen
7.6 Emotionen im Kontext von Lernen und Leistungsverhalten
7.6.1 Emotionen als wichtige Bedingung von Lernen und Leistungshandeln
7.6.2 Angst in Leistungssituationen
7.7 Aktivierung von Neugier und Interesse im Unterricht
7.7.1 Pädagogisch bedeutsame Kennzeichen von Neugier
7.7.2 Kennzeichnung des situativen Interesses
7.7.3 Möglichkeiten zur Auslösung situativen Interesses
7.7.4 Entwicklung eines persönlichen Interesses
7.8 Motivierung unter rivalisierenden und kooperativen Zielstrukturen
7.8.1 Lernen unter rivalisierender Zielstruktur
7.8.2 Lernen unter kooperativer Zielstruktur
8. Kapitel Von Lernzielen und der Diagnostik von Gelerntem
8.1 Planung des Unterrichts
8.1.1 Kennzeichen von Lernzielen und ihre Funktionen
8.1.2 Die Taxonomie der Lernziele
8.1.3 Aufgabenanalyse als Maßnahme zur Bestimmung von Lernzielen
8.2 Über das Messen und seine Kennzeichen
8.2.1 Definition von Messung
8.2.2 Vier mögliche Merkmale einer Messung
8.2.3 Über die Genauigkeit von Messungen
8.3 Leistungserfassung als integraler Bestandteil des Unterrichts
8.3.1 Vorinstruktionale Maßnahmen zur Erfassung von Wissen und Verständnis
8.3.2 Leistungserfassung während des Unterrichts
8.3.3 Abschließende Erfassung von Schülerleistungen
8.4 Das Notensystem als traditionelle Methode der Leistungsbewertung
8.4.1 Nachgewiesene Schwächen des herkömmlichen Benotungssystems
8.4.2 Zensuren im Dienste pädagogischer Absichten
8.4.3 Beachtenswerte Grundsätze bei der Notenvergabe
8.4.4 Allgemeine Fehler in der Urteilsfindung
8.5 Gütekriterien standardisierter Tests
8.5.1 Objektivität von Tests
8.5.2 Zuverlässigkeit von Tests
8.5.3 Gültigkeit von Tests
8.6 Bewertung standardisierter Testergebnisse
8.7 Kritik an herkömmlichen Prüfungsinstrumenten
8.8 Verfahren einer alternativen Diagnostik
8.8.1 Handlungs-Assessment
8.8.2 Anlage von Portfolios
Literatur
Sachregister
|XI|Vorwort
Im Jahre 1973 erschien die erste Auflage dieses Lehrbuches unter dem Titel Pädagogische Psychologie. Zur damaligen Zeit gehörten Werke behavioristisch orientierter Autoren wie Burrhus Skinner, Robert Glaser und Robert Mager u.a. zur Standardliteratur in der Lehrerausbildung. Sie bewirkten erhebliche Veränderungen in den Vorstellungen, wie ein „guter“ Unterricht auszusehen habe. Viel gelesen wurde auch Heinrich Roths Monografie „Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens“, die als typisch für damals vorherrschende Vorstellungen anzusehen ist: Es gibt eine optimale Gestaltung der Lehre und wenn diese entsprechend dem vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisstand übermittelt werden kann, ergibt sich zwangsläufig, dass die adressierten Schüler auch entsprechende Lernfortschritte zeigen werden. Auch hier schimmert noch die Vorstellung von einem Schüler durch, der als passiv gesehen wurde.
Unter dem zunehmenden Einfluss konstruktivistischer Orientierungen ist diese Passivität zunächst zaghaft, seit den 80er-Jahren aber mit zunehmend besser fundierten Argumenten als einseitig kritisiert worden. Der Lernende, so stimmten fortan immer mehr Vertreter der Pädagogischen Psychologie zu, sei keineswegs passiv, sondern vielmehr aktiv in dem, was er in Unterrichtssituationen beachtet, auswählt und vor dem Hintergrund des bereits Bekannten verarbeitet.
In jüngerer Zeit hat sich aber nicht nur das Menschenbild vom Schüler verändert. Es ist auch ein wachsendes Interesse entstanden, ihn von unterschiedlichsten Blickwinkeln aus zu beleuchten und zu betrachten. Während noch vor wenigen Jahrzehnten einschlägige Lehrbücher überwiegend auf psychologische und pädagogische Fachliteratur zurückgriffen, um den Leser zu informieren, sind heute – wie auch dem angehängten Literaturverzeichnis zu entnehmen ist – Forschungsergebnisse von Vertretern vielfältiger Fachgebiete daran beteiligt, Auskunft darüber zu geben, wie der Lernende lernt. Vor allem aus der medizinischen Forschung, darunter jene der Neurowissenschaften, aber auch aus den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Architektur stammen Erkenntnisse, die in der vorliegenden Auflage dieses Lehrbuches Berücksichtigung gefunden haben.
Die überarbeitete 9. Auflage ist inhaltlich nicht nur aktualisiert, sondern auch thematisch erweitert worden. Die Bedeutung der Emotionen für das Lernen wird noch stärker hervorgehoben und neurowissenschaftlichen Erkenntnissen ist mehr Raum in der Darstellung gegeben worden, wobei auch das Bemühen besteht, verbreitete Missverständnisse aus diesem Bereich zu korrigieren, damit „Neuromythen“ als solche entlarvt werden. Wie auch in vorausgegangenen Auflagen werden zur Verbesserung des Verständnisses häufig Beispiele in hervorgehobenen Kästen angeboten.
|XII|Es ist unmöglich, die Namen aller derjenigen zu nennen, die durch ihre Diskussionsbereitschaft sowie durch kritische Stellungnahmen an der Entstehung dieses Buches direkt und indirekt mitgewirkt haben. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei Herrn Hartmut Krämer, der im Text nicht nur zahlreiche Schreibfehler korrigierte, sondern auch sehr viele Anregungen zur Verbesserung der Stilistik gegeben hat. Meine außerordentliche Anerkennung gebührt auch meiner Frau, Hannelore Mietzel, der ich verdanke, die notwendigen Bedingungen zum Schreiben dieses Buches gehabt zu haben und die meine Arbeiten während der gesamten Zeit konstruktiv begleitet hat. Eine besonders kooperative und konstruktive Zusammenarbeit wurde durch die Lektorin des Hogrefe Verlags, Frau Hannah Muelenz geschaffen; sie war stets bereit, nachgereichte Ergänzungen zum Text in das Manuskript einzubauen. Meinem Sohn, Dr. Thorsten Mietzel, sage ich großen Dank, dass er bereits früher erstellte Grafiken durch weitere ergänzt hat.
Der Autor ermuntert Leser der 9. Auflage dieses Werkes, ihm alles mitzuteilen, was sich in der Darstellung bewährt hat und was verbessert werden kann.
Gerd Mietzel
Universität Duisburg Essen
E-Mail: [email protected]
|1|1. KapitelLernen, Lehren und die Pädagogische Psychologie
|2|Fallbeispiel
Im Lehrerzimmer der Oberschule zum Dom fand vor kurzem eine erhitzte Diskussion statt. Es ging um die Frage, ob die Pädagogische Psychologie einem Lehrer wirksame Hilfen anbieten kann, wenn er alltäglich vor vielen Problemen steht, für die er eine Lösung finden muss. Lehrer Wolfgang Kapp gehörte zu jenen Kollegen des Lehrerkollegiums, die die Frage energisch verneinten. Entsprechend erklärte er mit erregter Stimme: „Man hat mir im Studium Geschichten von Pavlovs Hund und von Skinners Ratten erzählt, Beispiele für Wahrnehmungstäuschungen und ethnische Stereotype gegeben … was hilft mir so ein ‚Zeugs‘, wenn ich meine Schülerin Petra zum wiederholten Mal auffordern muss, auf ihrem Platz zu bleiben und endlich aufzupassen, wenn ich Daniel zum x-ten Male ermahnen muss, seine Hausaufgaben ordentlich zu erledigen, oder wenn ich dem größten Teil meiner Klasse immer wieder zu vermitteln habe, dass man sich in der Schule auch Inhalten zuwenden muss, die keinen Spaß machen?“ Lehrerin Sabine Nollmann hatte den engagierten Ausführungen ihres etwas älteren Kollegen mit dem Ausdruck offenkundiger Missbilligung einige Zeit zugehört, sich aber dann entschlossen, ihm entschieden zu widersprechen. Auch sie habe – so erklärte sie – in ihrer Lehrerausbildung von Pavlov und Skinner gehört, aber stets sei dabei auch erarbeitet worden, welchen Bezug deren Theorien zu Ereignissen im Klassenzimmer hätten. Ihr sei in Seminaren vielfältig Gelegenheiten geboten worden, sich u.a. darin zu üben, welche Verhaltensweisen eines Schülers als „operante“ (s.S.215) zu gelten hätten, unter welchen Bedingungen die der Lehrerin zu einem „diskriminativen Reiz“ (s.S.232 f.) würde und wie man verhindern könne, dass Schüler durch Konditionierung negative Einstellungen gegenüber einzelnen Fächern entwickeln. In ihren Seminaren habe sie auch Erkenntnisse der Motivationspsychologie kennengelernt und wiederholt die Gelegenheit gehabt, in der Rolle einer Lehrerin (Seminar-)Stunden zu moderieren und dadurch praktische Erfahrungen in der Weckung von Neugier und Interesse sammeln zu können.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!