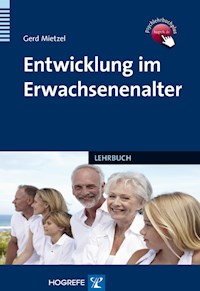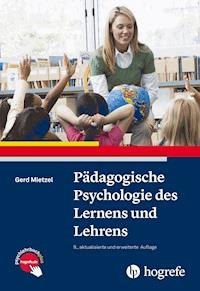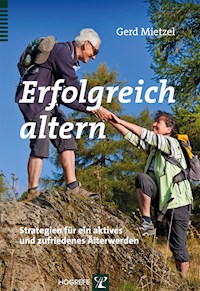
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Möglichst lange fit und aktiv zu sein gehört zu den Wünschen der meisten Menschen. Auch wenn wir hierfür nicht alle Bedingungen im Griff haben können, gibt es doch Möglichkeiten, unser Leben so zu gestalten, dass wir im Alter Wohlbefinden und Zufriedenheit erleben. Dieses Buch zeigt auf der Basis von Erkenntnissen der Psychologie, Medizin und Kognitionswissenschaft die Rahmenbedingungen für ein gelingendes Altern auf. Einleitend wirft der Autor einen geschichtlichen Rückblick auf das Thema »alt werden« und klärt die Frage, was ein »erfolgreiches Altern« ausmacht. Biologische, soziologische und psychologische Sichtweisen auf das Altern werden vorgestellt und veranschaulichen, welchen Einfluss man selbst auf die Veränderungen beim Älterwerden nehmen kann. Die weiteren Kapitel behandeln die Bereiche Gesundheit, soziale Beziehungen und geistige Fitness und geben Empfehlungen, was wir frühzeitig, aber auch noch im Alter, tun können, um diese Lebensphase aktiv und zufrieden zu genießen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Erfolgreich altern
[2]Strategien für ein aktives und zufriedenes Älterwerden
von
Gerd Mietzel
[3]Prof. em. Dr. Gerd Mietzel, Studium der Psychologie und Erziehungswissenschaften. Seit 1970 Professor an der Pädagogischen Hochschule Ruhr, Abteilung Duisburg, jetzt: Universität Duisburg-Essen, Campus Essen.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat für die Wiedergabe aller in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen etc.) mit Autoren bzw. Herausgebern große Mühe darauf verwandt, diese Angaben genau entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abzudrucken. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
© 2014 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Göttingen • Bern • Wien • Paris • Oxford • Prag • Toronto • Boston
Amsterdam • Kopenhagen • Stockholm • Florenz • Helsinki
Merkelstraße 3, 37085 Göttingen
http://www.hogrefe.de
Aktuelle Informationen • Weitere Titel zum Thema • Ergänzende Materialien
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Umschlagabbildung: © Patrizia Tilly – Fotolia.com
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
Format: EPUB
EPUB-ISBN: 978-3-8444-2583-3
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
[4]Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
[5]Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Suche nach einem Jungbrunnen und allem, was das Leben verlängert
1.1 Älter werden und alt sein
1.2 Warum hat der Mensch eine verhältnismäßig hohe Lebensdauer?
1.3 Der Wunsch nach Verjüngung
1.4 Altern und erhöhtes Gesundheitsrisiko
1.5 Bedingungen für ein erfolgreiches Altern
1.6 Genetische Grundlagen des erfolgreichen Alterns
1.7 Optimisten leben länger
2 Verschiedene Sichtweisen auf das Altern
2.1 Das Zusammenwirken von Anlage- und Umweltfaktoren
2.2 Theorien des Alterns aus biologischer Sicht
2.2.1 Altern als genetisch programmierte Abfolge von Veränderungen
2.2.2 Altern als Ansammlung nicht vorhersehbarer Fehler
2.3 Theorien des Alterns aus soziologischer Sicht
2.4 Theorien des Alterns aus psychologischer Sicht
3 Mit dem Körper erfolgreich altern
3.1 Gesunder Lebensstil: Was ist das?
3.1.1 Das A und O eines gesunden Lebensstils: Regelmäßige körperliche Aktivität
3.1.2 Gute Gesundheit durch richtige Ernährung
3.1.3 Regelmäßiger Schlaf: Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden
3.1.4 Was man sonst noch für seine Gesundheit tun kann
3.2 Ungesunder Lebensstil: Was sollte man vermeiden?
3.2.1 Rauchen: Das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko
3.2.2 Alkohol: Nur in moderaten Mengen unbedenklich
3.2.3 Stress im Übermaß
4 Mitmenschliche Beziehungen erfolgreich gestalten
4.1 Zwischenmenschliche Beziehungen in der heutigen Arbeitswelt
4.2 Freunde – weshalb sie unentbehrlich sind
[6]4.3 Paarbeziehungen – ihre Wirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden
4.3.1 Sozial-emotionale Bindung durch Liebe
4.3.2 Besitzen stabile Partnerschaften einen Schutzeffekt?
4.3.3 Erfolgreiches Altern durch fortbestehendes Erleben von Sexualität
4.4 Einsamkeit: Was sich dagegen tun lässt
4.5 Generativität: Etwas für die nachfolgende Generation tun
4.5.1 Über die Herausforderung, als Großeltern Generativität erleben zu können
4.5.2 Mentoren und Patenschaften: Ein Gewinn für Jung und Alt
4.6 Menschenwürdig altern – auch im letzten Lebensabschnitt
5 Förderung geistiger Fitness im Alter
5.1 Prozesse der Informationsverarbeitung
5.1.1 Das Arbeitsgedächtnis als »Werkstatt« für das Lernen
5.1.2 Informationsverarbeitung im Alltag: Ältere Straßenverkehrsteilnehmer
5.1.3 Dauerhaftes Behalten: Die Übertragung ins Langzeitgedächtnis
5.2 Veränderungen des Langzeitgedächtnisses im Alter
5.2.1 Veränderungen des semantischen Gedächtnisses
5.2.2 Veränderungen des episodischen Gedächtnisses
5.3 Wie lässt sich das Lernen und Behalten im Alter fördern?
5.4 Alzheimer: Wirklich unabwendbar?
5.4.1 Krankhafte Veränderungen im Gehirn
5.4.2 Medizinische Behandlungsmöglichkeiten bei Alzheimer
5.4.3 Aufbau einer kognitiven Reserve
Literatur
Sachregister
[7]Vorwort
Zu den ältesten Träumen der Menschheitsgeschichte gehört der Wunsch nach ewiger Jugend. Die Suche nach einem Jungbrunnen, mit dessen Wasser sich die Spuren des Alterns beseitigen – oder wenigstens etwas verwischen – lassen, hat unsere Vorfahren immer wieder angetrieben. Auch in den Schaltzentralen mächtiger Industriezweige der Gegenwart weiß man, wie tief die Sehnsucht nach dem »ewigen Leben« beim heutigen Menschen verankert ist, und deshalb scheut man keine Mittel, beim Konsumenten durch geschickte Werbung die Hoffnung wachzuhalten und möglichst noch zu verstärken, dass zumindest eine gewisse Teilhabe am Traumziel durchaus käuflich zu erwerben ist.
Aber – so könnten Kritiker solcher oft kostspieligen Werbeversprechen einwenden – bestimmen nicht letztlich die Erbanlagen bei jedem einzelnen Menschen, wie alt er wird und wie lange er sich seine Gesundheit bewahrt? Zweifellos hängt es von der genetischen Ausstattung des Menschen ab, dass er länger als sein Haushund und nicht so lange wie viele Schildkrötenarten lebt, aber legen die Gene tatsächlich den Tag, den Monat oder zumindest das Lebensjahr seines natürlichen Todes fest? »Nein!«, lautet die ziemlich einheitliche Antwort der Wissenschaftler, die eingehend studiert haben, welchen Einfluss Gene auf die Lebensdauer eines Menschen nehmen. Gene, so erklären sie, wirken niemals direkt, sondern stets in Wechselwirkung mit der Umwelt auf die Entwicklung. Die genetische Ausstattung verschafft Möglichkeiten. Wie diese aber genutzt und verwirklicht werden, wird durch nicht genetische Faktoren mitbestimmt, so etwa durch den Lebensstil eines Menschen und durch den medizinischen Fortschritt, an dem der Einzelne aber nur teilhaben kann, wenn er sich über die jeweils vorliegenden Erkenntnisse zum einen informiert und zum anderen auch nutzt!
»Wissen ist Macht«, so lehrte der englische Philosoph Francis Bacon vor fast einem halben Jahrtausend. Auf diesen bekannten Ausspruch könnte man auch zurückgreifen, um die Feststellung zu treffen, dass ein Mensch eine nicht zu unterschätzende Macht über seine gesundheitliche Entwicklung und damit letztlich auch über sein Wohlbefinden im Alter besitzt. Diese Macht, so lehrte der britische Philosoph, setzt allerdings einschlägiges Wissen voraus. Die Bereitstellung dieses Wissens ist das Hauptziel des vorliegenden Buches. Unzählige Aufsätze der Humanwissenschaften, der Medizin, der Psychologie und ebenso der Soziologie wurden durchforstet, um mitteilen zu können, wie unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse der Wissenschaft solche Lebensbedingungen zu gestalten sind, die das Erreichen eines höheren Alters bei guter Gesundheit und hoher Zufriedenheit wahrscheinlicher werden lassen.
Es kennzeichnet einen großen Teil wissenschaftlicher Literatur der Humanwissenschaften, dass sie sich einer Fachsprache bedient, die für Außenstehende nicht [8]ohne Weiteres verständlich ist, zumal der größte Teil der Diskussion im Englischen stattfindet. Umso wichtiger war es für den Autor dieses Buches, den Inhalt der zitierten Werke so aufzuarbeiten und wiederzugeben, dass ihre Bedeutung für interessierte Leser auch dann zu erschließen ist, wenn diese ihren Arbeitsschwerpunkt außerhalb der genannten Fachrichtungen haben sollten.
Die außerordentlich aufwendige und damit kostenintensive Forschung, die auf das Ziel gerichtet ist, die Gesundheit möglichst vieler Menschen bis in hohe Alter zu bewahren, um den in Zukunft zu leistenden Pflegeaufwand so weit wie möglich in einigermaßen erträglichen Grenzen zu halten, richtet sich mit ihren Empfehlungen aber nicht nur an Erwachsene im mittleren und höheren Erwachsenenalter. Sie muss sich in ganz besonderem Maße auch an jüngere Menschen wenden. Gerade darin liegt eine besondere Schwierigkeit, denn Jugendliche oder junge Erwachsene mögen Erkenntnisse, denen zu entnehmen ist, unter welchen Bedingungen sie ihre Aussichten auf ein gesundes und somit erfolgreiches Alter haben, noch nicht ernsthaft zur Kenntnis nehmen und schon gar nicht bereit sein, diese in die eigene Lebensgestaltung einfließen zu lassen. Die in diesem Buch mitzuteilenden Forschungsergebnisse zeigen eindrucksvoll auf, dass in früheren Lebensabschnitten wichtige Weichenstellungen dafür erfolgen, ob eine längere Pflegebedürftigkeit im Alter aussichtsreich zu vermeiden ist. Von vielen Lebensgewohnheiten der ersten fünfzig Jahre des individuellen Lebens hängt nun einmal ab, in welcher Verfassung die verbleibenden Jahrzehnte verbracht werden können. Wenn es nicht gelingt, Empfehlungen zur Vorsorge in der Weise an jüngere Altersgruppen so heranzutragen, dass diese ihren Lebensstil danach auszurichten bereit sind, wird die erhoffte Entlastung der Sozialversicherungen nur erschreckend unzureichend ausfallen und nach sich ziehen, dass der häufig vorhergesagte Arzt- und Pflegenotstand eines Tages zu einer unerträglichen Wirklichkeit wird.
Bei der Gestaltung dieses Buches wurde Wert darauf gelegt, dass Leser in einer klaren, verständlichen Sprache informiert werden. Wenn ihnen Fachausdrücke begegnen, dürfen sie damit rechnen, dass deren Bedeutung geklärt wird. Leser sollten sich nicht nur als Adressaten fühlen, denen Erkenntnisse über das Erwachsenenalter mitgeteilt werden, sondern auch als Angesprochene, die etwas über sich selbst und ihre Entwicklung erfahren. Es ist wichtig, die Kriterien für Entscheidungen kennenzulernen, die ihre Lebensgewohnheiten betreffen und die mit subjektivem Wohlbefinden und Gesundheit in Beziehung stehen.
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich für die besonders sorgfältige Durchsicht meines Manuskripts durch Herrn Hartmut Krämer, der im Text nicht nur zahlreiche Schreibfehler korrigierte, sondern auch sehr viele Anregungen zur Verbesserung der Stilistik gegeben hat. Meine außerordentliche Anerkennung gebührt auch meiner Frau, Hannelore Mietzel, der ich es verdanke, die notwendigen [9]Bedingungen zum Schreiben dieses Buches gehabt zu haben und die meine Arbeiten während der gesamten Zeit konstruktiv begleitet hat. Ganz besonders herzlich bedanken möchte ich mich bei Herrn Dr. Vogtmeier, der mir den Weg ebnete, dieses Buch beim Hogrefe Verlag zu veröffentlichen. Die Lektorin Frau Velivassis hat es trotz eines gewissen Zeitdrucks geschafft, die Textvorlage des Autors in eine übersichtliche und ansprechende Form zu bringen.
Der Autor ermuntert seine Leser, ihm alles mitzuteilen, was bewahrt und verbessert werden sollte, denn nur Rückmeldungen der Nutzer ermöglichen es, das vorliegende Werk bestehenden Bedürfnissen noch mehr anzupassen.
Gerd Mietzel
Universität Duisburg Essen
E-Mail: [email protected]
1 Suche nach einem Jungbrunnen und allem, was das Leben verlängert
[10]Es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen, denen das folgende Rätsel unbekannt ist: Was möchte niemand sein und was möchte doch jeder werden? Die Antwort lautet: alt. Bemerkenswert ist, dass fast alle Befragten der Feststellung zustimmen, dass sie nicht alt sein wollen, aber gerne alt werden möchten! Bringen sie damit nicht aber einen Widerspruch zum Ausdruck? Kann man gleichzeitig erklären, nicht alt sein zu wollen, aber sich gleichzeitig wünschen, alt zu werden? Der Widerspruch ergibt sich allerdings nur, wenn die Antwort auf ein einziges Wort begrenzt ist. Tatsächlich steht hinter der Rätsellösung alt eine etwas komplexere Aussage: Man würde jederzeit das Jungbleiben dem Altwerden vorziehen. Der einzige Ausweg, dem Altwerden zu entgehen, bestünde darin, das Leben früh zu beenden. Der Tod steht aber für die meisten Menschen nicht als attraktive Möglichkeit zur Auswahl; im Gegenteil: Ihn möchten sie so lange wie möglich hinausschieben, und so erklärt sich, warum allgemein eine große Zustimmung auf die Frage besteht, ob man alt werden möchte.
1.1 Älter werden und alt sein
In alltäglichen Unterhaltungen hört man häufiger die Äußerung, dass man »älter wird«, um damit auszusagen, dass man sich nunmehr dem Altsein nähert. Tatsächlich wird aber auch ein Neugeborenes oder ein Kleinkind mit jedem Tag älter, denn älter werden heißt eigentlich nur, dass sich mit dem Voranschreiten der Zeit der Abstand zur Geburt ständig vergrößert. Wenn man dagegen die Feststellung trifft, dass man sich dem Altsein nähert oder sich für alt hält, bringt man die subjektive Selbsteinschätzung zum Ausdruck, dass man sich jenem Abschnitt des Lebens nähert – oder ihn bereits erreicht hat –, der mit Prozessen verbunden ist, bei denen der Abbau überwiegt. Eine übliche Einteilung ordnet den einzelnen Abschnitten des Erwachsenenalters folgende Altersbereiche zu:
•das frühe Erwachsenenalter: 20 bis 40 Jahre,
•das mittlere Erwachsenenalter: 40 bis 65 Jahre,
•das späte Erwachsenenalter: ab 65 Jahre.
Was angeblich keiner sein möchte – oder doch?
Es ist nicht zu bezweifeln, dass sich vor allem nach Erreichen des fünften Lebensjahrzehnts bei weiter zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit langsam aber stetig erhöht, Opfer einer chronischen Erkrankung zu werden. Zudem sind am Körper des Alternden immer häufiger Anzeichen dafür zu erkennen, dass er nicht mehr zu den »Jungen« gehört; so entdeckt man beispielsweise die ersten [11]Falten im Gesicht, man wird auf das Ergrauen der Haare aufmerksam und es knackt in den Gelenken. Irgendwann merkt man auch, dass man beim Treppensteigen oder beim Laufen schneller kurzatmig wird als der begleitende Sohn oder die Tochter. Solche Beobachtungen führen im mittleren Erwachsenenalter zu einer veränderten Sichtweise, die die Journalistin und Schriftstellerin KLARA OBERMÜLLER1 auch bei sich selbst beobachtet hat und u.a. folgendermaßen beschreibt: »Die Zeit der kühnen Veränderungen, der großen Aufbrüche ist offensichtlich vorbei. Die Kinder werden erwachsen und gehen aus dem Haus. Die Ehe ist in ruhigeres Fahrwasser geraten, vielleicht auch gescheitert. Neue Beziehungen sind zwar noch möglich, aber ihr Gelingen wird von Mal zu Mal unwahrscheinlicher. Die berufliche Karriere hat eine Grenze erreicht, die nicht mehr zu überspringen ist. … Ich bin, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Herbst meines Lebens eingetreten. Es ist die Zeit der Ernte, die Zeit des Welkens und Vergehens. Das trifft, das schmerzt, das macht wehmütig, traurig und müde.«
Einen Zeitraum, in dem Menschen irgendwann in der Mitte ihres Lebens einmal – vielleicht auch mehrere Male – eine kritische Bestandsaufnahme vornehmen, durchleben wahrscheinlich sehr viele Frauen und Männer. Treten aber der wehmütige Rückblick und eventuell auch der wenig verlockende Ausblick auf die eigene Zukunft lediglich in einer Krise auf, die irgendwann überwunden wird? Sicherlich ist nicht zu leugnen, dass die verbleibende Lebenszeit mit jedem gefeierten Geburtstag kürzer wird.
Menschen im mittleren und noch deutlicher im späteren Erwachsenenalter haben im Hinblick auf ihre körperliche Verfassung und ihre Zukunftsperspektive einiges an Lebensqualität verloren, was Jugendlichen und Frauen und Männern im frühen Erwachsenenalter noch in geradezu imponierender Weise zur Verfügung steht. Ist vor diesem Hintergrund nicht der Schluss naheliegend, dass ältere Menschen allen Grund haben, unglücklich über das ihnen von der Natur zugemutete Schicksal ihres Altwerdens zu sein? Selbstverständlich hat es die Forschung wiederholt herausgefordert, diesen Verdacht zu überprüfen. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen brachten etwas Erstaunliches zutage: Es ergab sich nämlich, dass sich ältere Menschen – sowohl Frauen wie auch Männer – für glücklicher halten als jüngere. Obwohl man im höheren Alter mehr Beeinträchtigungen als Jüngere zu verkraften hat, teilen viele befragte ältere Menschen mit, dass sie sich gut fühlen und mit ihrer Lebenssituation zufrieden sind. Einer Meinungsumfrage zufolge halten sich 60 % der 65- bis 69-Jährigen sogar für »Best Ager«, denn sie sehen sich in einem Altersbereich, in dem man noch vielfältige Zukunftspläne machen kann. Im Durchschnitt fühlt sich über die Hälfte der 65- bis 85-Jährigen jünger, als sie tatsächlich sind2.
Mehreren Forschungsergebnissen lässt sich entnehmen, dass Menschen, die sich in ihrem neunten Lebensjahrzehnt befinden, ihre Zufriedenheit höher einstufen als Jüngere in ihren 40er Jahren und sogar höher als noch jüngere Altersgruppen3. [12]Es erscheint paradox, dass Menschen, die sich in Lebensabschnitten finden, vor denen sich Jüngere am meisten fürchten, zu jenen gehören, die vergleichsweise hohe Zufriedenheit bekunden und aussagen, sie fühlten sich gut. Ein älterer Mensch kann durchaus Beeinträchtigungen im kognitiven und körperlichen Bereich aufweisen; wenn er aber das besitzt, was Psychologen Widerstandsfähigkeit nennen, vermag er auf die Frage, ob er erfolgreich altert, eine bejahende Antwort zu geben, die sich mit jenem Gleichaltrigen vergleichen lässt, der gesund ist, aber eine geringe Widerstandskraft aufweist. Es ist also gar nicht unbedingt erforderlich, bei Frauen und Männern höheren Alters perfekte Gesundheit anzustreben. Gewisse Unzulänglichkeiten im Alter lassen sich ausgleichen, wenn man die Widerstandskraft eines Menschen stärkt und durch geeignete Maßnahmen dafür sorgt, dass er keine Depression entwickelt oder, falls eine solche vorhanden ist, bemüht ist, sie zu behandeln4.
Erwachsene vermögen in zunehmendem Maße offenbar zu lernen, sich an körperliche Defizite und an weitere Verluste anzupassen. Dadurch gelingt es ihnen in der Regel, sich über den Zeitraum des Erwachsenenalters hinweg eine ziemlich gleichbleibend hohe Zufriedenheit zu bewahren oder diese sogar noch zu steigern. Erst in den Jahren kurz vor dem Tod sinkt das Wohlbefinden erheblich ab5. Daraus darf aber nicht geschlossen werden, dass letztlich jeder Mensch »seines Glückes Schmied ist«, dass er es also selbst in der Hand hat, ob und wie zufrieden er ist. Auch die Lebensbedingungen, die sich in nicht unerheblichem Maße der Kontrolle des Einzelnen entziehen, entscheiden über sein Wohlbefinden mit. Wenn Menschen beispielsweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts geboren sind und einen Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise durchleben mussten, offenbaren sie vergleichsweise geringere Lebenszufriedenheit als Geburtsjahrgänge, die später auf die Welt kamen und entscheidende Erfahrungen in den Jahren des »Wirtschaftswunders« und des zunehmenden Wohlstandes gemacht haben. Dennoch finden sich in beiden Altersgruppen viele Angehörige, deren Zufriedenheit im Verlauf des Erwachsenenalters angestiegen ist, aber – entsprechend den für die jeweilige Generation vorherrschenden Lebensbedingungen – auf unterschiedlich hohem Niveau6. In welchem Wohnumfeld Menschen leben und wie hoch die Lebensqualität dort ist, hängt auch von der Gemeinde und den ihr zur Verfügung stehenden finanziellen Möglichkeiten ab. Werden Möglichkeiten für erholsame Spaziergänge geschaffen? Ist der Nahverkehr ausreichend ausgebaut? Sind Geschäfte in Reichweite? Auch solche Lebensbedingungen, auf die der Einzelne nur sehr eingeschränkt – wenn überhaupt – Einfluss nehmen kann, bestimmen also das Wohlbefinden der dort lebenden Menschen mit. Deshalb gilt auch, was die Entwicklungspsychologin DENIS GERSTORF und ihre Mitarbeiter7 über die Entwicklung und den Ausprägungsgrad des Wohlbefindens feststellen: »Es macht einen Unterschied, wo Menschen leben und sterben.«
Eine Wissenschaft, die sich für die Frage interessiert, unter welchen Bedingungen ein erfolgreiches Altern zu fördern ist, hat ihren Blick also nicht nur auf das [13]Individuum zu richten, sondern auch auf dessen Lebensumfeld mit dem Ziel, Anregungen dafür zu geben, wie Lebensbedingungen – und damit auch das Wohlbefinden – zu verbessern sind.
Was angeblich jeder werden möchte
Bei dem Wunsch des Menschen, das ewige Leben zu erlangen, handelt es sich um einen Traum, der sich geschichtlich weit zurückverfolgen lässt. Eingehendes Nachfragen fördert allerdings zutage, dass ein solcher Wunsch wohl von niemandem als erfüllt angesehen wird, wenn lediglich in Aussicht gestellt würde, das Leben endlos fortbestehen zu lassen. Unabdingbar sind zusätzlich Voraussetzungen, unter denen ein befriedigendes Leben zu führen ist. Bereits der antiken Sagenwelt lässt sich die Mahnung entnehmen, dass das eine – das ewige Leben – nicht ohne Weiteres zusammen mit dem anderen – befriedigende Lebensbedingungen – zu haben ist. Nach der altgriechischen Sage hatte sich Eos, die Göttin der Morgenröte, in den strahlenden Jüngling Tithonos verliebt. Ihre Gefühle füreinander waren sehr intensiv und aus ihrer Liebe schenkten sie mehreren Kindern das Leben. Eos wandte sich schließlich an Zeus mit der Bitte, ihren Geliebten unsterblich zu machen, allerdings vergaß sie, ihrem Wunsch hinzuzufügen, dass Tithonos auch die ewige Jugend zu gewähren sei. Deshalb alterte Tithonos wie jeder normale Mensch: Er wurde runzlig und schrumpfte immer mehr zusammen, ohne aber sterben zu können.
Das ewige Leben hat die Natur für kein irdisches Lebewesen vorgesehen. Bevor ein kurzer geschichtlicher Rückblick auf Bemühungen der Menschen erfolgen wird, das Leben zu verlängern und gleichzeitig eine Verjüngung zu erreichen, soll erklärt werden, warum die Evolution dem Menschen zu Beginn seiner Entstehungsgeschichte bereits viele zusätzliche Lebensjahre in die Gene geschrieben hat. Weiterhin wird anschließend herausgearbeitet, dass ein lang gehegter Wunsch der Menschheit auf Verlängerung des Lebens – wenn auch sicherlich nicht im angestrebten Umfang, aber dennoch in einer beachtlichen Anzahl zusätzlicher Jahre – in Erfüllung gegangen ist.
1.2 Warum hat der Mensch eine verhältnismäßig hohe Lebensdauer?
Wenn man den Menschen mit seinen nächsten biologischen Verwandten, den Primaten, vergleicht, dann fällt seine verhältnismäßig hohe Lebensdauer auf. Die wenigen Schimpansenweibchen, die das Ende ihrer fruchtbaren Jahre noch erreichen, sterben auf jeden Fall kurz danach. Ihre absolute Lebensdauer liegt bei etwa 45 Jahren, bei einem Alter, das auch für Menschen in ihrer frühen Entstehungsgeschichte kennzeichnend war. Die meisten Neandertaler, so wird aufgrund [14]von Knochenfunden vermutet, sind im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gestorben und nur wenige dürften ein Lebensalter von 40 Jahren erreicht haben8, 9. Mit dem Begriff der durchschnittlichen oder mittleren Lebenserwartung wird die Anzahl der Jahre angegeben, die ein neugeborenes Kind wahrscheinlich leben wird. Die Vorfahren des modernen Menschen waren dem Neandertaler hinsichtlich seiner Lebenserwartung vermutlich nicht überlegen10.
Verlängerte Lebensdauer als Verdienst von Großmüttern?
Wie lässt sich nun erklären, dass die meisten Frauen in heutiger Zeit noch mehrere Lebensjahrzehnte nach Eintritt ihrer Menopause vor sich haben? Eine Antwort lässt sich der Großmutter-Hypothese entnehmen11.
Die Großmutter-Hypothese, die unter Wissenschaftlern immer noch kritisch diskutiert wird, geht davon aus, dass ältere Frauen, die bereits zu Beginn der Menschheitsgeschichte lebten und jenseits ihrer fruchtbaren Jahre waren, dabei halfen, für ihre Enkelkinder Nahrung zu suchen. Auf diese Weise nahmen sie ihren Töchtern Arbeit ab und ermöglichten diesen eine größere Anzahl von Geburten in kürzeren Abständen. Die Großmütter halfen dabei, Nahrung zu suchen, die auch etwas älteren Kindern nicht ohne Weiteres zugänglich war, wie etwa Wurzelknollen oder noch zu knackende Nüsse. Es hing also auch von der Lebensdauer der Großmütter ab, wie umfangreich der Nachwuchs ihrer Tochter war. Einige Frauen, die lange genug am Leben blieben, hatten infolge ihrer Unterstützung mehr Enkelkinder und von diesen dürften einige das Gen geerbt haben, das ein längeres, gelegentlich – im Falle einer Mutation – sogar ein noch längeres Leben als das der Vorfahren ermöglicht hat. Aus langlebigen Enkelkindern konnten wiederum Großmütter werden, und je mehr sich von Generation zu Generation deren Leben verlängerte, desto mehr wurde die Fruchtbarkeit der Töchter gefördert. Somit hat die großmütterliche Unterstützung, die den Kindern der eigenen Tochter zuteilwurde, genetische Veränderungen bewirkt, die es älteren Frauen ermöglicht hat, länger zu leben.
Trotz der hohen Popularität der Großmutter-Hypothese – so sei hier aus Gründen der Vollständigkeit ergänzt – gibt es noch die Mutter-Hypothese, die mit ihr in Konkurrenz steht12. Diese geht davon aus, dass Mütter, deren fruchtbare Jahre beendet waren, länger lebten, um ihre verbleibende Kraft dafür einzusetzen, dass ihre eigenen Kinder überlebten. Die Mutter-Hypothese erhält Unterstützung, wenn sich die verlängerte Lebensdauer einer Frau positiv auf die Anzahl ihrer eigenen Kinder und deren Überlebenschance auswirken sollte. Auch für diese Hypothese gibt es Untersuchungsergebnisse, die sie stützen. Gemeinsam ist aber beiden Hypothesen die Annahme, dass die verlängerte Lebensdauer der Frau aus der Sicht der Evolution Anpassungswert hatte, weil dadurch mehr Nachwuchs das zeugungsfähige Alter erreichte.
[15]Die Anthropologin KRISTEN HAWKES ließ mithilfe von Mathematikern errechnen, wie viel Zeit die Evolution benötigt haben könnte, damit die allmähliche Verlängerung der genetisch festgelegten Lebensdauer des Menschen möglich werden konnte. Sie gelangte zu dem Schluss, dass die Verlängerung der menschlichen Lebensspanne in verhältnismäßig kurzer Zeit, nämlich im Zeitraum zwischen 24 000 und 60 000 Jahren – in Abhängigkeit von den jeweiligen Annahmen – geschehen sein kann13.
In der jüngeren Vergangenheit hat sich abermals die Lebenserwartung erhöht, aber in verhältnismäßig kurzer Zeit. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass für diesen Anstieg erneut genetische Veränderungen als Erklärung infrage kommen. Erklärungen finden sich aber hinreichend in veränderten Lebensbedingungen.
Veränderung der Lebenserwartung in jüngerer Zeit
Die erste verwertbare »Lebenstabelle« in der Geschichte der Menschheit wurde im Jahre 1693 von EDMOND HALLEY berechnet; er hatte die durchschnittlichen Todesfälle in Breslau von 1687 bis 1691 zusammengestellt, und daraus ergab sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts eine Lebenserwartung der Neugeborenen von etwa 29 Jahren. Noch bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts verzeichnete die Statistik, dass nur die Hälfte der Menschen das vierte Lebensjahr erreicht hat. Erst im 20. Jahrhundert fand ein Anstieg der Lebenserwartung statt, der sich bis zur Gegenwart fortsetzte. Der heutige Mensch hat die meisten zusätzlichen Lebensjahre erst seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts gewonnen. Somit sind die Nutznießer dieser dramatischen Veränderung Angehörige der letzten vier Generationen, also nur 4 von insgesamt etwa 8 000 Generationen, die die Menschheitsgeschichte umfassen14.
Nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes der Bundesrepublik Deutschland liegt die Lebenserwartung von neugeborenen Jungen statistisch bei 77 Jahren und 4 Monaten, Mädchen werden im Schnitt 82 Jahre und 6 Monate [16]alt. Eine dänische Studie macht die Vorhersage, dass mehr als die Hälfte der Neugeborenen, die in einer wohlhabenden Nation das Licht der Welt erblickt haben, das Alter von 100 Jahren erreichen wird. Sie werden die hinzu gewonnenen Lebensjahre in besserer Gesundheit und mit weniger körperlichen Beeinträchtigungen erleben; dennoch werden Alterskrankheiten zahlenmäßig zunehmen und eine erhebliche Belastung für die zukünftige Gesellschaft darstellen15. Die höhere Lebenserwartung, so ergänzt ein neuerer Bericht im Auftrag der Vereinten Nationen16, erfasst inzwischen ebenso die Bevölkerung aus Ländern der Dritten Welt. Nur wenige Länder, darunter Belarus (Weißrussland), Lesotho, Ukraine und Zimbabwe, verzeichnen noch eine Abnahme der Lebenserwartung, die mit Alkoholkonsum und Infektion mit AIDS zusammenhängt17. Diese weltweite Tendenz, so ist der Überschrift des UN-Reports zu entnehmen (Ageing in the 21st century. A celebration and a challenge), ist ein Grund zum Feiern, stellt aber zugleich eine Herausforderung dar, denn diese Veränderung in der Zusammensetzung der Bevölkerung erfordert neue Lösungen, die den Eintritt in den Ruhestand, die Gesundheitsfürsorge und die Beziehungen innerhalb der Generationen betreffen.
Die Lebenserwartung steigt für viele Menschen ständig an. Deshalb hat ein großer Anteil von ihnen die Möglichkeit, die Entwicklung ihrer Enkelkinder bis ins junge Erwachsenenalter zu verfolgen.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird es mehr ältere Menschen als Kinder unter 14 Jahren geben. Im Verlauf der vergangenen 170 Jahre ist die Lebenserwartung in einigen Nationen in jedem Jahrzehnt um etwa 2,5 Jahre gestiegen. Wenn man dieses umrechnet, bedeutet es, dass jeden Tag sechs Stunden hinzugekommen sind18. Sofern diese Vorhersagen zutreffen, hätte das zur Folge, dass bereits jetzt, noch mehr in der Zukunft, einer immer höheren Anzahl von Älteren eine zunehmend geringere Anzahl von jungen Menschen gegenüberstehen wird. Nach aktuellen Vorhersagen wird sich die Anzahl Erwachsener, die älter als 60 Jahre sind, im Jahre 2050 auf zwei Milliarden belaufen19. Damit werden [17]ältere Erwachsene erstmalig in der Geschichte der Menschheit jüngere (im Alter von 0 bis 14 Jahren) zahlenmäßig übertreffen. Abbildung 1 zeigt, welche Veränderungen im Hinblick auf den Anteil der 0- bis 4-Jährigen, der 0- bis 14-Jährigen und der über 60-Jährigen im Zeitraum zwischen 1950 und 2050 festzustellen bzw. zu erwarten sind.
Abbildung 1: Anzahl der über 60-Jährigen im Vergleich zur Anzahl von Kindern im Jahre 201520
Wie sich der Grafik entnehmen lässt, wird es im Jahr 2050 auf der Welt mehr Menschen, die über 60 Jahre alt sind, als Kinder geben. Allerdings ist die Möglichkeit nicht auszuschließen, dass eine solche Vorhersage nicht eintreffen wird, weil ein zunehmendes Übergewichtig und damit erhöhtes Auftreten von Diabetes Typ II in der Bevölkerung wieder zu einer Absenkung der Lebenserwartung führen können21. Eine Studie über die geburtenstarken Jahre in den USA, den sogenannten Baby Boomers, zeigt auf, dass der medizinische Fortschritt sich bei dieser Generation zwar in einer gesteigerten Lebenserwartung, keineswegs aber in ihrer Gesundheit niederschlägt22.
Die »Baby Boomers« weisen sogar einen höheren Anteil an chronischen Erkrankungen auf als die vorausgehende Generation, denn im Vergleich zu ihren Eltern sind diese geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt zunehmend in den Ruhestand eintreten, häufiger übergewichtig, sie haben mehr Cholesterin im Blut und leiden öfter an Diabetes. Während 75 % der Baby Boomer einen zu hohen Blutdruck haben, war dies nur bei 35 % der vorausgehenden Generation der Fall. Zusammenfassend gelangen die Autoren dieser Studie zu der Feststellung: »Trotz ihrer höheren Lebenserwartung gegenüber früheren Generationen haben US Baby Boomer höhere Auftretensraten von chronischen Krankheiten, mehr Gebrechen und eine geringere Selbsteinschätzung ihrer Gesundheit als Mitglieder vorheriger Generationen gleichen Alters«23. Könnten ähnliche Entwicklungen auch bei den geburtenstarken Jahrgängen anderer Industrienationen vorliegen oder spiegelt sich hier ein spezifisch amerikanischer Lebensstil wider?
Erklärungen für den Anstieg der Lebenserwartung
Es gilt als sehr unwahrscheinlich, dass die gesteigerte Lebenserwartung des Menschen der jüngeren Zeit auf eine Veränderung seiner Genausstattung zurückgeführt werden kann. Dagegen spricht, dass es zu allen Zeiten Menschen gegeben hat, die länger lebten als die Mehrheit ihrer Zeitgenossen. Obwohl beispielsweise die mittlere Lebenserwartung im ausgehenden 16. Jahrhundert bei 25 bis 30 Jahren lag, hoben sich hessische Pfarrer der Reformationszeit von dieser allgemeinen Tendenz deutlich ab, denn von ihnen wurden 30 % älter als 60 Jahre, etwa 21 % über 70 Jahre, etwa 9 % über 80 Jahre und 0,6 % sogar über 90 Jahre alt24. Diese Sonderstellung der Pfarrer war offenkundig »Ausdruck einer überdurchschnittlich guten Ernährung, von gesünderen Wohnverhältnissen, einem relativ sorgenfreien Leben und einer körperlich wenig anstrengenden Arbeit«25.
[18]Gene wirken niemals direkt auf die Entwicklung, vielmehr hängt es stets von den jeweils vorliegenden Umweltbedingungen ab, wie sie zum Ausdruck kommen. Die geringe durchschnittliche Lebenserwartung im Hoch- und Spätmittelalter hatte ihre Ursachen in der hohen Säuglingssterblichkeit, unzureichenden Ernährungsverhältnissen als Folge immer wiederkehrender Missernten sowie Seuchen wie Pest und Cholera26. Der durchschnittliche Anstieg der Lebenserwartung im 20. Jahrhundert ist zunächst darauf zurückzuführen, dass infolge des medizinischen Fortschritts die Sterblichkeitsziffern bei Neugeborenen und Kleinkindern drastisch gesunken sind. Nach einer vorliegenden Statistik aus England ist die Sterberate von Kindern unterhalb des Alters von fünf Jahren seit 1970 um 60 % gefallen. »Wer die frühe Kindheit überlebt hat, besitzt gute Aussichten auf ein verlängertes Leben«27. Hinzu kommen Neuerungen in der Sozialgesetzgebung: »Das Verbot der Kinderarbeit, die Verkürzung der Arbeitszeit usw. tragen das Ihre dazu bei, dass heute Menschen um etwa 30 Jahre länger leben als noch vor 100 Jahren«28.
Nachdem es gelungen war, die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu überwinden, tragen ständige Fortschritte der Medizin in erheblichem Maße dazu bei, dass Menschen länger leben. In 19 von 21 Regionen dieser Welt hat sich die Lebenserwartung während der letzten zwei Jahrzehnte verlängert. Ausnahmen ergeben sich durch die bereits benannte starke Verbreitung der AIDS-Krankheit in Südafrika, ebenso auch durch Naturkatastrophen in der Karibik29. Aus heutiger Sicht mag es erstaunen, dass vor 100 Jahren eine Blinddarmentzündung mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich verlief30. Damals kannte man noch keine Antibiotika.
Nach der Verfügung über Antibiotika und deren Einsatz etwa in der Mitte des letzten Jahrhunderts konnten viele bakterielle Infektionskrankheiten behandelt werden. Allein dadurch hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung entscheidend erhöht. Kritische Stimmen befürchteten allerdings zunächst, dass mehr und mehr Menschen die durch den Einsatz von Antibiotika gewonnenen zusätzlichen Lebensjahre unter Fortbestehen chronischer Krankheiten zu verbringen hätten. Auf diese Weise würden Menschen zwar länger leben, aber mit jeder zusätzlichen Altersspanne habe man mit einer größeren Anzahl chronisch Kranker zu rechnen. Damit hätten, so die Kritiker, die Mediziner nur einen scheinbaren Erfolg bei älteren Menschen erzielt; entsprechend sprach man bereits von einem »Scheitern des Erfolgs«31. Diese düstere Vorhersage traf jedoch nicht im damals behaupteten Umfang ein. Vielmehr hat sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte der Anteil derjenigen Menschen, deren Gesundheitszustand als schlecht oder sehr schlecht zu bezeichnen ist, allmählich verringert32, 33. Chronische Krankheiten sind in der jüngeren Vergangenheit tendenziell immer später im Leben aufgetreten. Dadurch hat sich die behinderungsfreie Lebenserwartung erhöht. Von einem hochgesteckten, weitergehenden Ziel ist man allerdings noch weit entfernt. Man möchte erreichen, dass das Entstehen chronischer Krankheiten soweit hinaus gezögert wird, dass diese sich auf ein kurzes Intervall vor dem Tode zusammendrängen. [19]Viele ältere Menschen werden immer noch längere Zeit vor ihrem Lebensende Opfer chronischer Krankheiten. Somit hat sich die Lebenserwartung der meisten Menschen auf dieser Erde während der letzten beiden Jahrzehnte zwar erhöht, aber die dazu gewonnenen Jahre werden häufig in einem schlechten Gesundheitszustand verbracht. Aus diesem Grunde ist die Forderung an die Medizin und die Sozialwissenschaften berechtigt, sich in den getroffenen Maßnahmen nicht nur auf die Lebensverlängerung zu konzentrieren, sondern gleichzeitig mehr Anstrengungen darauf zu verwenden, dass die restlichen Lebensjahre in besserer Gesundheit verbracht werden können34. Für England liegt beispielsweise eine Statistik vor, nach der sich die Lebenserwartung von Frauen seit 1990 um 4.6 % erhöht hat, eine in guter Gesundheit bestehende Lebenserwartung hat sich bei ihnen demgegenüber nur um 3 % erhöht35. Die Entwicklung von Krankheiten während der letzten Lebensjahre muss noch mehr verlangsamt werden, so dass die mit ihnen einhergehenden Behinderungen hinausgezögert werden.
Obwohl die Evolution dem Menschen, wie bereits festgestellt worden ist, viele zusätzliche Lebensjahre in seine Gene »geschrieben« hat und heutige Lebensbedingungen die Aussicht eröffnen, bei hoher Fitness diese Jahre auch durchleben zu können, besteht weiterhin der uralte Wunsch der Menschheit nach möglichst ewiger Jugend.
1.3 Der Wunsch nach Verjüngung
Die Göttin der Morgenröte hatte in ihrer Verliebtheit gegenüber Zeus einen Wunsch geäußert, den heutige Menschen offenbar nicht für attraktiv halten. Frauen und Männern wurde im Jahre 1985 von einem Meinungsforschungsinstitut folgende Frage vorgelegt: »Wenn die Wissenschaft es möglich machen würde, dass man 150 Jahre alt werden kann und auch so lange im Besitz seiner Kräfte bleibt: Würden Sie gerne so lange leben oder nicht?« Nur 28 % antworteten daraufhin mit »ja«36. Besteht bei Erwachsenen der Wunsch, in einen »Jungbrunnen« zu steigen und noch einmal das Jugendalter zu genießen? Antworten auf entsprechende Fragen ergeben, dass die meisten Menschen gerne ein jüngeres Alter haben möchten, als es in ihrem Personalausweis registriert ist, aber der Wunsch nach einer ewigen Jugend gilt offenbar den meisten Frauen und Männern nicht als attraktiv: »Die 45- bis 55-Jährigen wären im Durchschnitt gerne noch einmal 37 Jahre jung, die 56- bis 65-Jährigen am liebsten noch einmal 46, die 66- bis 70-Jährigen wären gerne noch einmal Anfang Fünfzig und die über 70-Jährigen würden dem Jungbrunnen bei Mitte Fünfzig entsteigen«37.
Die Suche nach Möglichkeiten, seinen Körper zu verjüngen und noch einmal die körperliche Tüchtigkeit und das Aussehen früherer Lebensjahre zurückzugewinnen, ist bereits in frühen Stadien menschlicher Geschichte nachzuweisen, wie ein kleiner zeitgeschichtlicher Rückblick belegt.
[20]
Jedes Jahr kommen viele ältere Personen nach Florida in der Erwartung, sich dort möglichst lange vor dem Altern zu schützen. Viele von ihnen besuchen auch die Jungbrunnenquelle, die eng mit dem Namen des spanischen Eroberers Juan Ponce de Leon in Verbindung gebracht wird, der tatsächlich wahrscheinlich niemals in der Nähe dieser Quelle gewesen ist, die noch heute im Spring House sprudelt. Viele Besucher trinken deren nach Schwefel schmeckendes Wasser, vielleicht auch in der Hoffnung, dadurch ein paar Altersfalten zu verlieren. (Der Abdruck des Fotos erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Ponce de Leon’s Fountain of Youth Archaeological Park.)
Suche nach Verjüngung in vorbiblischer und biblischer Zeit
Die Suche nach einem Lebenselixier, nach einem Wundertrank oder irgendeinem Mittel, das lebenserhaltend wirkt oder verjüngt, gehört zu den ältesten Träumen der Menschheit. Bereits im Gilgamesch-Epos, das zu den ältesten literarischen Werken gehört, ist von der Suche nach dem ewigen Leben die Rede. Auf zwölf zerbrochenen Tafeln, die bei Ausgrabungsarbeiten gefunden wurden und Zeugen der alten sumerischen Kultur sind, wird von dem Helden und König Gilgamesch (etwa 2 000 Jahre vor Christi Geburt) berichtet, der auf dem Boden des Meeres eine Pflanze fand, »durch welche der Mensch sein Leben erlangt«. Mit ihr verfügte er über eine gute Aussicht, unsterblich zu werden. Doch das war Gilgamesch nicht vergönnt, denn nach seiner Rückkehr aus der Unterwelt erfrischte er sich an einer Quelle, und während er sich ausruhte, schnappte sich eine Schlange die Pflanze, die sich daraufhin häutete und verschwand.
Nach einer im Altertum häufiger anzutreffenden Vorstellung könnte eine Verjüngung gelingen, wenn man einem alten Mann die Gelegenheit zu einer intimen Begegnung mit einem jungen Mädchen eröffnet. Wie sich dem Alten Testament entnehmen lässt, versuchte man eine solche »Behandlung« auch bei König David (1. Buch der Könige, Verse 1−4): »Als David ein hochbetagter Greis geworden war, der sich aus seinem Lager nicht mehr erheben konnte und der auch fror, obwohl er in Decken eingehüllt war, sagten seine Diener zu ihm: Man suche für unseren [21]Herrn, den König, ein unberührtes Mädchen, das ihn bedient und pflegt. Wenn es an seiner Seite schläft, wird es unserem Herrn, dem König warm werden. Man suchte nun im ganzen Land Israel nach einem schönen Mädchen, fand Abischag aus Sunem und brachte sie zum König. Das Mädchen war überaus schön. Sie pflegte den König und diente ihm; doch der König erkannte sie nicht.« Das bedeutet, dass der Alterungsprozess zu weit fortgeschritten war, um die erhoffte Rückgewinnung der Kräfte noch zu erreichen. Der britische Philosoph und Naturwissenschaftler Roger Bacon (1214 – 1294) ließ sich von dieser biblischen Geschichte anregen und verhalf dem Sunatismus (genannt nach dem Wohnort des Mädchens Abischag) zum Durchbruch. Seine danach empfohlene Therapie männlicher Altersschwäche sah vor, wie im Falle von König David, dass sich ein alternder Mann zu einem reifen Mädchen legt, weil er dem Atem des jungen Mädchens heilende Kräfte zuschrieb. Geschlechtsverkehr war dabei allerdings nicht zu vollziehen.
Selbstkontrolle über das Erreichen eines höheren Lebensalters
Der Gedanke des Philosophen Bacon, dass dem alternden Menschen zunehmend etwas fehlt, taucht im Mittelalter in verschiedenen Variationen auf. Ein Beispiel liefert der italienische Philosoph LUIGI CORNARO (1467–1566), der die Überzeugung vertrat, dass es Menschen möglich wäre, sowohl die Dauer ihres Lebens als auch dessen Qualität mitzubestimmen. Er war in Venedig geboren, in einer Stadt, in der viele Bürger damals wegen der Bedeutung des Hafens in wirtschaftlich guten Verhältnissen lebten. Deshalb fanden sich unter den Wohlhabenden auch viele Menschen, die ein sorgloses und ausschweifendes Leben führten. Zu ihnen gehörte auch CORNARO, der allerdings im Alter von etwa 35 Jahren erfahren musste, dass er infolge seines Lebensstils körperlich fast am Ende war. Seine Ärzte machten ihm wenig Hoffnung, sein Leben fortsetzen zu können, aber erklärten ihm, dass er noch eine Chance des Überlebens hätte. Er müsse seinen Lebensstil grundlegend ändern. CORNARO entschloss sich daraufhin, den ärztlichen Ratschlägen Folge zu leisten. Er verringerte seine täglichen Essensrationen auf ein Minimum und entschied sich, bis zum Ende seines Lebens einen anspruchslosen und bescheidenen Lebensstil zu führen. Sein Buch Vom maßvollen Leben oder die Kunst, gesund alt zu werden, Erstauflage 1550, wurde in viele Sprachen übersetzt. Der Erfolg seiner rigorosen Maßnahmen ließ nicht lange auf sich warten. Schon nach wenigen Tagen glaubte er, Erfolge seiner Bemühungen zu erkennen, und nach einem Jahr war seine Gesundheit wieder vollkommen hergestellt.
Beachtenswert ist, dass CORNARO das höhere Alter nicht als Krankheit gesehen hat, sondern als einen Lebensabschnitt, in dem man seine Lebenskraft und seine Gesundheit in hohem Maße erfahren kann, wenn man ihn entsprechend vorbereitet. Den Schlüssel zu einem langen Leben sah er darin, sich in jeder Hinsicht maßvoll und genügsam zu verhalten. Seine strenge Diät und sein maßvolles Trinken [22]vermochte er in seinem weiteren Leben strikt einzuhalten. Auf diese Weise gelang es ihm, das Alter von 102 Jahren zu erreichen.
Wie sich dem geschichtlichen Rückblick von RALPH TRÜEB38 entnehmen lässt, war CORNARO nicht der einzige Vertreter in der Renaissance, der die Erreichung eines gesunden und langen Lebens vom jeweiligen Lebensstil eines Menschen abhängig machte. TRÜEB verweist beispielsweise auf den Philosophen und Arzt Sigismund Albicus (1347–1427), der drei Gefahren für den intelligenten Menschen sah: zu häufigen Beischlaf, ein Übermaß an Wein und Speisen sowie Nachtarbeit. Der Arzt Tommaso Rangone verfasste im Jahre 1550 eine Schrift mit dem Titel »Wie man das Leben des Menschen über 120 Jahre hinaus verlängern kann« und empfahl dazu eine ruhige Lebensweise und eine sorgfältige Speisenwahl. Der italienische Arzt Gabriele Zerbi (1445 – 1505) prägte in seinem Buch den Begriff Gerontocomica, der die Kunst beschrieb, den Prozess des Alterns aufzuhalten. Er verglich das Altern mit dem Ölvorrat einer Lampe, der ständig abnimmt, bis die Flamme schließlich erlischt. Um ein langes Leben vor sich zu haben, empfahl er, ein gemäßigtes Klima zu wählen, er verwies auf die Notwendigkeit, »sich im Winter gut zuzudecken und im Sommer jedes Schwitzen zu vermeiden, mäßige Bewegung nach den Mahlzeiten, Einsamkeit zu vermeiden und die Vorzüge von Hühnerbouillon für geschwächte Greise«39.
Hinter den Empfehlungen, die Ärzte der Renaissance gaben, stand die Überzeugung, dass es sich beim höheren Alter um einen Lebensabschnitt handelt, der seine Reize hat und durchaus als attraktiv anzusehen ist. Entsprechend schrieb CORNARO, »ich habe nie gewusst, wie wunderbar es ist, ein hohes Alter zu erreichen.« Damit werden Vorstellungen ausgedrückt, die durchaus mit heutigen Denkweisen Überschneidungen aufweisen: Wer sich durch einen angemessenen, also gesunden Lebensstil auf das höhere Alter vorbereitet, besitzt sehr wohl Chancen, seinen letzten Lebensabschnitt genießen zu können. Welche Maßnahmen dabei als »angemessen« und »gesund« zu bezeichnen sind, unterliegt nicht nur dem jeweiligen Zeitgeist, sondern auch dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand.
Hohes Lebensalter als zu behandelnde Krankheit
Während des 19. Jahrhunderts wurde die Auffassung, dass es sich beim höheren Lebensalter um einen Lebensabschnitt handelt, in dem man Gesundheit und Zufriedenheit durch entsprechende Vorbereitung erfahren kann, durch wissenschaftliche Erkenntnisse infrage gestellt. Es setzte sich zunehmend die Sichtweise durch, dass man den höheren Lebensabschnitt zu hassen und zu fürchten hat, weil es sich dabei um eine Krankheit handelt40. Man untersuchte die körperlichen Organe, Auge und Ohr, die Gelenke und die Blutgefäße und erklärte, dass es sich bei den Alternsprozessen von Erwachsenen im mittleren und höheren Lebensalter nicht[23]um Veränderungen handelte, die sich durch Verzicht auf zu reichliches Essen und durch Bewegung kontrollieren ließen, sondern behauptete, es handele sich bei den beobachteten Veränderungen um Prozesse, die im fortgeschrittenen Lebensalter nur voranschreiten und nicht zu vermeiden sind. Viele angesehene Ärzte stimmten darin überein, dass ein hohes Lebensalter und Krankheit untrennbar miteinander verbunden seien. Beispielsweise schrieb der in Wien geborene und später in die USA ausgewanderte Arzt IGNATZ LEO NASCHER (1863–1944), auf den der Begriff Geriatrie (die Lehre von den Krankheiten des alternden Menschen) zurückgeht41, es sei unmöglich, »eine scharfe Linie zwischen Gesundheit und Krankheit im höheren Lebensalter zu ziehen«. Zu Beginn des 20. Jahrhundert zweifelten führende Mediziner nicht mehr daran, dass es sich beim höheren Lebensalter um eine Krankheit handele, die Körper und Geist zerstöre42.
Die zunächst wachsende Überzeugung, dass es sich beim höheren Lebensalter um einen Abschnitt handelt, der als fortschreitende Krankheit zu definieren ist, wirkte bei vielen Medizinern lähmend auf ihre Bereitschaft, Forschungsarbeiten in diesem Bereich durchzuführen. Es gab allerdings Ausnahmen: Einige wenige Mediziner nahmen das beschriebene, inzwischen weithin bestehende Grundverständnis vom höheren Lebensalter nicht zum Anlass, ihr Interesse davon abzuziehen; vielmehr stellte es für sie eine besondere Herausforderung dar: »Wenn das höhere Lebensalter eine gehasste Krankheit war, warum sollte man es nicht anpacken und vernichten?«43.
Zellen und Drüsen als Verursacher des Alterns
Wenn man das höhere Lebensalter für eine Krankheit hält, die man heilen möchte, muss man nach Ursachen suchen, die zu beseitigen sind. Einige Ärzte richteten ihren Blick daraufhin auf die Körperzellen. Stoffwechselprozesse und dadurch entstehende Ablagerungen in den Zellen führten schließlich zum Tode. »Die Zelle erstickt gewissermaßen in ihren eigenen Stoffwechselprozessen«44. Andere Ärzte richteten ihren Blick auf die Drüsen. Vor allem die Keimdrüsen gerieten in den Verdacht, mit dem Alternsprozess in Beziehung zu stehen. Bestärkt darin, dass die Keimdrüsen einen Schlüssel zur Verjüngung und damit zur Vermeidung des Alterns enthalten könnten, unterzog sich der Physiologe und Nervenarzt CHARLES-ÉDOUARD BROWN-SÉQUARD (1817–1894) einem Experiment, über dessen Ergebnisse er vor der biologischen Gesellschaft in Paris 1889 im Alter von 72 Jahren berichtete.
Er hatte sich drei Wochen lang einen wässrigen Extrakt aus den Hoden von Hunden und Meerschweinchen eingespritzt und daraufhin »zumindest all jene Kräfte zurückgewonnen, die er vor vielen Jahre besessen« habe. Er versicherte, dass er »alles was er für mehrere Jahre wegen seines fortgeschrittenen Alters nicht oder schlecht tun konnte, heute in bewundernswerter Weise erledigen kann«45. Er sei nach seiner Selbstbehandlung sogar in der Lage gewesen, die amourösen Wünsche [24]seiner neuen jungen Frau zu befriedigen. Viele französische Ärzte versuchten diesen Erfolg bei ihren älteren Patienten zu wiederholen. Ihre Bemühungen erbrachten jedoch nicht den erwarteten Erfolg und BROWN-SÉQUARD fiel in Ungnade46. In einer deutschen medizinischen Fachzeitschrift höhnte ein Autor: »Seine phantastischen Experimente … müssen als senile Verirrung angesehen werden«47.
Auf die verjüngende Wirkung von Keimdrüsen setzte auch der russische Arzt SERGE VERONOFF (1866–1951). Er hatte in Ägypten vor dem Ersten Weltkrieg die Aufgabe übernommen, Männer zu kastrieren, die dem ägyptischen Königshof als Haremswächter dienen sollten. Ihm fiel sehr bald auf, dass diese kastrierten Männer verhältnismäßig schnell alterten. Aus dieser Beobachtung zog er den Schluss, dass die Hormone der männlichen Keimdrüse das Altern kontrollieren könnten. Deshalb pflanzte er Hoden junger Affen in die Körper alter Männer. Seine reichen Patienten machten ihn zum mehrfachen Millionär; aber ein verlängertes Leben konnte er keinem schenken. Die damaligen Versuche mit Keimdrüsenextrakten regten auch Karikaturisten an, sich über diese »Verjüngungskur« lustig zu machen.
RALPH TRÜEB48 stellt kritisch zu dem von BROWN-SÉQUARD verwendeten Extrakt fest, dass allein die jeweils verabreichte Menge zu gering war, um irgendeine Wirkung entfalten zu können, denn die tägliche Produktion der Geschlechtsdrüsen ist tausendmal größer als die Dosis, die sich BROWN-SÉQUARD verabreicht hat. Wenn er trotzdem die Wirksamkeit seines täglich verabreichten Extrakts erfahren haben will, muss man wohl als Erklärung an einen Placebo-Effekt denken, wonach seine Erwartung an das Medikament, aber nicht dieses selbst, für die behauptete Wirkung verantwortlich zu machen ist.
Der zu Beginn des 20. Jahrhunderts verstärkt auftretende Wunsch, dem hohen Alter möglichst lange zu entgehen, »niemand wollte mehr alt, aber alle mussten jung sein«49, regte viele weitere Maßnahmen an, die der Wirkung eines Jungbrunnens entsprechen sollten. Zu erwähnen sind noch die Arbeiten des österreichischen Arztes Eugen Steinach (1861–1944), zu dessen Patienten u. a. Sigmund Freud gehörte. Neben der Verpflanzung von Hoden empfahl er einen Eingriff, durch den Samenleiter abgebunden wurden (Vasektomie genannt). Dabei produzieren die Hoden weiterhin Geschlechtshormone. Er hatte zunächst bei passiv-apathischen Ratten beobachtet, dass die Tiere nach einem solchen Eingriff wieder jugendliche Aktivität zeigten. Aus dieser Beobachtung zog Steinach den Schluss, dass sich durch einen solchen Eingriff auch beim Menschen eine Verjüngung erreichen lasse. Wenn man auf diese Weise die nutzlose Produktion von Spermien unterbinde, dann könnte, so glaubte er, das männliche Sexualhormon Testosteron ansteigen und alternden Menschen eine Art Wiederbelebung ermöglichen.
Auch Frauen sollte der Weg einer Verjüngung ermöglicht werden. Steinach spritzte ihnen nicht nur Hormone, sondern bestrahlte auch ihre Eierstöcke. Wie [25]positiv solche Bemühungen damals aufgenommen und einer Öffentlichkeit vorgestellt wurden, zeigt folgendes Zitat: »Die Implantation eines Eierstocks hat sehr beeindruckende Ergebnisse. Wenn ein Eierstock von einer jungen in eine alternde Frau verpflanzt wird, hört er auf, Eier hervorzubringen, aber er gibt weiterhin Hormone ab, die im Blut eines neuen Wirtes zirkulieren und große Fortschritte in der kognitiven, körperlichen und sexuellen Gesundheit hervorbringen. … Die senile Frau wird energiegeladener, zeigt wiedererweckte sexuelle Wünsche, gewinnt zurückgewonnene Attraktivität gegenüber dem Mann, und nach einer längeren Zeit der Unfruchtbarkeit kann sie wieder schwanger werden und Nachwuchs in die Welt setzen«50.
Negative Kennzeichnung des Alternsprozesses
Die von Seiten der Medizin unternommenen Anstrengungen zur Verjüngung des menschlichen Körpers sowie die Schriften, die diese Maßnahmen – und angeblichen Erfolge – einer Öffentlichkeit vorstellten, enthielten letztlich die Botschaft, dass es sich beim Altern um einen Prozess handelt, den man möglichst ganz abwenden sollte, denn er würde nichts mit sich bringen, was das Leben noch lebenswert machen könnte. Das höhere Lebensalter wird als »erbärmliches, seltsames Gemisch aus Verdorbenheit und Verwesung, in welchem die süßere, reinere Lebensflamme sich abquält und glimmt« beschrieben; es ist »widerlich, vulgär und abscheulich«51. In einem kurzen zeitlichen Abschnitt, in dem man bereit war, das höhere Alter positiver zu sehen, erfolgte in den frühen 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in Amerika ein Rückschritt52: Die Kennzeichnung des höheren Lebensalters als nutzlos, das es folglich zu verhindern gelte, bekam neue Nahrung durch eine Gruppe von Ärzten, die sich zur Gründung der »Amerikanischen Akademie für Anti-Aging-Medizin« entschlossen hatten. Statt die Gedanken von [26]CORNARO und Zeitgenossen (s. S. 22) aufzugreifen und fortzuführen, beschrieben sie abermals das Alter als Lebensabschnitt, der nur Krankheit, Armut und Hinfälligkeit mit sich bringe. Die Gefahr dieser Anti-Age-Gruppe sieht CAROLE HABER53 nicht nur darin, dass hier Versprechen gegeben werden, die nicht einzuhalten sind, sondern mehr noch in dem Bemühen einer Abwertung eines ganzen menschlichen Lebensabschnitts: »Sowohl in ihrem Rezept für eine andauernde Jugend und in ihrer Verachtung älterer Menschen neigt die Anti-Aging-Bewegung dazu, ebenso wie ihre Pendants aus dem späten 19. Jahrhundert und dem frühen 20. Jahrhundert, den Prozess des Altwerdens abzuwerten und ins Abseits zu schieben.« Glücklicherweise hat sich auf europäischem Boden eine Anti-Aging-Bewegung entwickelt, die offenkundig bemüht ist, dem letzten Lebensabschnitt des Menschen eine positivere Bewertung zuzuschreiben.
Auf dem Wellness-Markt wird in Form von Cremes und Pillen eine unübersehbare Fülle von Möglichkeiten angeboten, mit deren Hilfe dem Körper – wenigstens dem Anschein nach – ein jüngeres Aussehen zu verleihen ist. Zumeist bleiben die Erfolge hinter den Wünschen der Konsumenten zurück.
1.4 Altern und erhöhtes Gesundheitsrisiko
Wer das höhere Alter als nicht mehr lebenswerten Abschnitt des menschlichen Lebens kennzeichnet, muss mit erheblichem Widerstand rechnen, denn das höhere Erwachsenenalter wird von einer ständig wachsenden Anzahl von Menschen erreicht und viele von ihnen berichten, hohe Zufriedenheit zu erleben (s. S. 11). Da man aber im späteren Leben an seinen Körper nicht mehr die gleichen Anforderungen stellt wie in jüngeren Jahren, kann subjektives Wohlbefinden durchaus auch bekundet werden, wenn körperliche Organe als Folge des Alterungsprozesses nicht mehr so gut wie früher funktionieren. Sowohl für die Menschen, die sich in ihrem letzten Lebensabschnitt befinden, als auch für die Gesellschaft, in der sie leben, stellt es in jedem Fall einen Gewinn dar, wenn es der Wissenschaft gelingt, den Alternsprozess durch Entwicklung und Anwendung geeigneter Maßnahmen zu verlangsamen.
Anti-Aging-Medizin im deutschsprachigen Bereich
Die Vertreter der Anti-Aging-Medizin, die sich im deutschsprachigen Bereich begründet hat, zielen darauf, sich eindeutig von der gleichlautenden Bewegung in den USA abzuheben. Ob die Übernahme des Begriffs Anti-Aging als glücklich zu bezeichnen ist, mag dahingestellt sein, denn er könnte leicht den Eindruck wecken, dass das Altern durch bestimmte Maßnahmen aufzuhalten oder gar rückgängig zu machen sei; zu erreichen ist allenfalls ein Verzögern. Fragt man nun Vertreter der deutschen Anti-Aging-Bewegung nach ihren Zielen, erhält man folgende Antwort: »Unser Ansatz ist«, so heißt es auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin e.V., »dass wir Alterungsprozesse als den wesentlichen Risikofaktor für die gängigen Volks-und Zivilisationskrankheiten identifiziert haben. Ein vertieftes Verständnis dieser Alterungsprozesse und deren [27]gezielte Beeinflussung ist daher das Konzept im Kampf für ein gesundes Altern.« Demnach ist das höhere Alter kein Lebensabschnitt, der mit Krankheiten gleichgesetzt wird. Vielmehr erhöht sich mit zunehmendem Alter das Risiko, eine chronische Krankheit zu entwickeln, die aber nicht als unabwendbar angesehen wird. Durch vorbeugende Maßnahmen kann sie im günstigen Fall vermieden werden oder wenigstens ein Hinauszögern ihres Auftretens erreicht werden. Sollte eine chronische Krankheit auftreten, ist die Anti-Aging Medizin bemüht, ihren Verlauf positiv zu beeinflussen, »denn jeder habe ein Recht auf gute medizinische und soziale Versorgung im Alter«54.
Sofern eine Anti-Aging-Medizin ihr Ziel darin sieht, altersbedingt auftretende Krankheiten hinauszuzögern und ihre Symptome abzumildern, mag sie Unterstützung von Wissenschaftlern erhalten, die weiterhin nach chemischen Stoffen suchen, die ein solches Bemühen unterstützen können. Wenn man fragt, wodurch dieses Ziel erreicht werden könnte, wird man häufig auf Proteine mit der Bezeichnung Sirtuine verwiesen.
Mit Sirtuinen dem Ziel einer Verlangsamung des Alternsprozesses einen Schritt näher?
Bei Resveratrol, das aus den Schalen roter Trauben zu gewinnen ist, aber auch in anderen Früchten, so etwa in Erdnüssen, vorkommt, handelt es sich um eine Substanz, der lebensverlängernde Eigenschaften zugeschrieben werden. In einem vielbeachteten Experiment wurden Mäuse mit außerordentlich fettreicher Nahrung gefüttert55. Nach einigen Monaten hatten die Tiere die bei Fettleibigkeit typischen Krankheiten entwickelt: Fettleber und Diabetes 2. Viele von ihnen starben. Tiere einer Vergleichsgruppe erhielten das gleiche Futter, allerdings wurden zusätzlich 22 mg Resveratrol pro Kilogramm in ihre Nahrung gemischt. Auch diese Tiere entwickelten Fettleibigkeit, es fanden sich bei ihnen jedoch keine veränderten Blutwerte, ihre Leber zeigte keine Auffälligkeit und auch ihre Lebensdauer wich nicht von der normal aufwachsender Mäuse ab.
Um zu prüfen, ob gleiche Effekte beim Menschen zu erzielen wären, müsste man sie veranlassen, große Mengen Resveratrol zu sich zu nehmen, was allerdings ethisch überhaupt nicht zu vertreten wäre, weil sich nicht vorhersagen ließe, welche unheilvollen Wirkungen unter Umständen damit auszulösen wären. Nun gibt es allerdings ein Enzym, das man anfänglich in Hefezellen, später auch in Fruchtfliegen sowie Säugetieren hat nachweisen können. Es handelt sich dabei um Sirtuine, die offenbar im Alternsprozess eine besondere Rolle spielen und die aus diesem Grunde verstärkt das Forschungsinteresse erregt haben: Mit ihnen verbindet sich die Hoffnung, dass sich mit ihrer Hilfe das Leben verlängern lässt. Bei Säugetieren hat man sieben verschiedene Arten dieses Enzyms gefunden. Eines davon, SIRT1, wird im Körper von Lebewesen eingeschaltet, wenn diese die täglich konsumierte [28]Kalorienmenge erheblich verringern oder sportliche Aktivitäten ausüben. Man kann es aber auch durch Resveratrol aktivieren, das jedoch in erheblichen Mengen konsumiert werden müsste. Es wurden inzwischen allerdings synthetische Aktivatoren entwickelt, deren Wirkung auf SIRT1 im Vergleich zu Resveratrol um das Hundertfache erhöht ist. Durch Aktivierung von Sirtuinen ist es offenbar möglich, einen gewissen Schutz vor Alterskrankheiten zu erreichen56. Der australische Molekularbiologe BRIAN MORRIS57 erklärt aber dazu: »Jeder Schutz ist unvollständig. Das Altern wird voranschreiten, aber langsamer. Alterskrankheiten werden sich entwickeln, aber verzögert sein.« Sein australischer Kollege DAVID SINCLAIR äußert sich optimistischer: »Wir haben festgestellt, dass Altern nicht das unumkehrbare Leiden darstellt, für das wir es einmal gehalten haben. Einige von uns können 150 Jahre alt werden«, aber von diesem Ziel ist er offenbar noch entfernt, denn er ergänzt, »ohne weitere Forschung werden wir das nicht schaffen«58.
1.5 Bedingungen für ein erfolgreiches Altern
Die über Tausende von Jahren erfolglos gebliebene Suche nach einem Jungbrunnen ist immer wieder mit großer Enttäuschung verbunden gewesen. Auch wenn die Medizin vor allem in der jüngeren Zeit eindrucksvolle Leistungen vollbringen konnte, die zu einer beträchtlichen Erhöhung der allgemeinen Lebenserwartung geführt haben, ist zur Kenntnis zu nehmen, dass sich das Altern zwar hinauszögern lässt, dieser Prozess aber letztlich nicht zu beseitigen oder gar rückgängig zu machen ist. Irgendwann in der Mitte des Lebens muss ein Mensch zur Kenntnis nehmen, dass sein Körper damit begonnen hat, Abbauprozesse in Gang zu setzen, die als Verluste zu interpretieren sind: Die Laufgeschwindigkeit, die man noch als 20-Jähriger erreicht hat, vermag ein 40-Jähriger nicht mehr ohne Weiteres zu erreichen. Das Lesen gelingt nur noch mithilfe einer Brille, erste Gesichtsfalten sind nicht mehr zu übersehen und Knochen bewahren nicht weiterhin die Festigkeit, die sie im Jugendalter einmal hatten. Auch erste Gedächtnisausfälle veranlassen viele Menschen im mittleren Lebensalter, sich ernsthaft die Frage zu stellen, ob nach solchen Symptomen das Entwickeln einer Demenz nur noch eine Frage der Zeit sein könnte.
Man kann Anzeichen zunehmender körperlicher Verluste klagend zur Kenntnis nehmen und sich eine Zukunft vorstellen, die nur noch unheilvolle Erfahrungen mit sich bringen kann. Allein ein derartiger Pessimismus wird mit bedingen, dass Gesundheit und subjektives Wohlbefinden keine positive Entwicklung mehr nehmen können. Optimisten werden den Blick demgegenüber nicht nur auf mögliche Verlusterfahrungen richten, sondern auch positive Aussichten erkennen und Strategien entwickeln, um möglicherweise auch beschwerliche Alterserscheinungen konstruktiv zu bewältigen. Allein die subjektiv bestehende Überzeugung, man fühle sich viel jünger als das tatsächliche Alter erwarten lasse, ist als Ausdruck [29]positiven Alterns zu sehen, denn diese positive, sich selbst aufwertende Illusion geht mit hoher Lebenszufriedenheit einher59.
Wer sich eine solche positive Sicht für die zweite Lebenshälfte schafft und bewahrt, verfügt über eine gute Voraussetzung dafür, gesund, zufrieden und mit gut funktionierendem Gedächtnis seine verbleibenden Lebensjahrzehnte zu erfahren. Wie eine Längsschnittuntersuchung mit über 10 000 Teilnehmern in England ergeben hat60, haben diejenigen Menschen im Alter von 50 Jahren, die zufrieden waren und ihr Leben genossen haben, die größte Wahrscheinlichkeit, zehn Jahre später noch zu leben. Von demjenigen Drittel der Versuchsteilnehmer, die im Hinblick auf das Kennzeichen Lebensfreude die höchsten Rangplätze einnahmen, waren etwa 9,9 % gestorben. Demgegenüber zeigte sich bei denjenigen Teilnehmern, die sich im Hinblick auf den Ausprägungsgrad ihrer Lebensfreude im untersten Drittel befanden, dass fast 30 % nicht mehr am Leben waren. Je mehr Lebensfreude Erwachsene aufweisen – das lässt sich der englischen Längsschnittstudie entnehmen –, desto höher ist ihre Aussicht, erfolgreich zu altern.
Erfolgreiches Altern – eine Begriffsklärung
Wenn man den Begriff Altern wörtlich versteht, bedeutet er lediglich »älter werden«; danach würde er sehr weit anwendbar sein, denn älter wird ein Organismus seit seiner Entstehung, also unmittelbar nach der Befruchtung einer Eizelle: Von diesem Zeitpunkt an vergrößert sich der zeitliche Abstand eines Individuums von dem Moment an, da Ei und Samenzelle verschmolzen waren. Zumeist verwendet man Altern jedoch in einem engeren Sinne: Man altert, wenn man die ersten Symptome bei sich – oder anderen – wahrnimmt, die als Zeichen eines Abbaus interpretiert werden: die ersten grauen Haare, die ersten Falten im Gesicht, das Auftreten von Kurzsichtigkeit usw.
Bewertung objektiver Verluste – eine Frage der Interpretation
Verluste treten mit vorrückendem Alter allmählich immer zahlreicher auf und in einer ersten Annäherung zur Klärung des Begriffes kann festgestellt werden, dass ein erfolgreiches Altern davon abhängt, wie man solche altersbedingten Verluste wahrnimmt und bewertet, denn darin unterscheiden sich Menschen – was sich auch bei einem seltenen Fund in einem Weinkeller offenbaren könnte: In einem verborgenen Winkel entdeckt man eine uralte Flasche Wein. Beachtet man nun zuerst die völlig verstaubte Flasche und den zersetzten Korken oder erkennt man sofort die Aussicht darauf, einen edlen Tropfen genießen zu können?
Auch der griechische Philosoph PLATO war sich offenkundig darüber im Klaren, dass es von einem alternden Menschen selbst abhängt, ob er eine altersbedingte Veränderung als Verlust oder gar als Gewinn sieht. In seinem Werk Der Staat[30]findet sich gleich zu Anfang ein Gespräch zwischen Sokrates und dem alten Kephalos. Dieser berichtet, dass er öfter mit anderen Menschen seines Alters zusammentrifft: »Bei diesen Zusammenkünften nun«, so erklärt er, »jammern die meisten von uns, indem sie sich nach den Freuden der Jugend sehnen und der Liebesgenüsse gedenken und der Trinkgelage und Schmause und was es sonst noch ähnliches gibt, und sind verdrießlich, weil sie etwas Großes verloren und damals ein glückliches Leben geführt haben, jetzt aber eigentlich gar keines. Einige beklagen auch die Misshandlungen des Alters durch die Angehörigen und stimmen deshalb über das Alter ein Lied an, was es ihnen alles für Unglück bringe.« Damit wird jedoch einseitig eine negative Sichtweise bekundet. In seinem Werk Cato der Ältere. Über das Greisenalter trat der römische Schriftsteller und Philosoph MARCUS TULLIUS CICERO (106–43 v. Chr.) dieser negativen Bewertung des »Greises« mit folgenden Worten entgegen: »Freilich arbeitet er nicht wie die jungen Männer, aber doch ist, was er tut, weit wichtiger und nützlicher. Denn nicht immer ist es die körperliche Stärke oder Schnelligkeit und Behändigkeit, die große Dinge ausführt, sondern die Klugheit, das persönliche Ansehen, das Gewicht der Stimme – Eigenschaften, die man im Alter nicht nur nicht verliert, sondern sogar in zunehmendem Maße gewinnt. … Mit Laufen, mit Springen, mit dem Lanzenwurf würde er sich freilich nicht befassen, sondern Gebrauch machen von seinem klugen Rat, von seiner vernünftigen Überlegung, von seinem Urteil.«
Es hängt offenkundig von der Blickrichtung des Betrachters ab, ob er nur Negatives oder auch Positives am höheren Lebensalter entdeckt. In dem bereits erwähnten Werk Der Staat schildert PLATO, dass Kephalos einmal dabei war, wie jemand dem Dichter Sophokles folgende Frage stellte: »›Wie sieht’s bei dir aus, Sophokles, mit der Liebe? Vermagst du noch mit einer Frau zu schlafen?‹ Der antwortete: ›Nimm deine Zunge in acht, Mensch; bin ich doch herzlich froh, dass ich davon erlöst bin, wie ein Sklave, der von einem tobsüchtigen und wilden Herrn erlöst worden ist!‹ Schon damals deuchte mir das wohlgesprochen und auch jetzt nicht minder: denn immerhin hat man im Alter in diesen Beziehungen vollkommenen Frieden und Freiheit.« Eine von vielen Menschen als Verlust eingestufte altersbedingte Veränderung stellt Kephalos offenbar als Gewinn dar mit dem Hinweis, dass er sich mit dem Absinken seiner Potenz nicht länger als Getriebener fühle, sondern vielmehr seine Freiheit genieße. Plato hat somit eine frühe Beschreibung dafür gegeben, was unter einem erfolgreichen Altern zu verstehen ist.
Bereits in der Antike schien es für Philosophen beachtenswert, dass Menschen sich darin unterscheiden, welche Einstellung sie zum Altern haben. Heute kann man nachweisen, dass allein diese Einstellung wesentlich mit darüber entscheidet, ob man erfolgreich altert oder nicht. Wenn Menschen im späten Erwachsenenalter das Altern positiv sehen, erholen sie sich verhältnismäßig schnell von erlittenen körperlichen Beeinträchtigungen61, auch Stress können sie im Falle einer positiven Einstellung zum Altern relativ gut abwehren62.
[31]Annahmen über ein erfolgreiches Altern