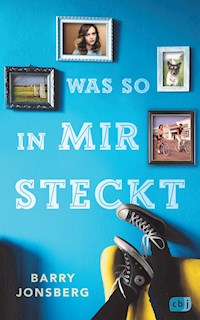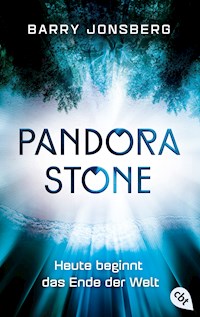
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Pandora Stone-Reihe
- Sprache: Deutsch
Stell dir vor, alle, die du kanntest, sind tot. Und du bist einer von nur 10.000 Überlebenden weltweit.
Als Pandora Stone im Krankenhaus erwacht, fühlt sie sich schwach und die Erinnerung an das Ende der Menschheit ist allgegenwärtig. Gemeinsam mit anderen jungen Überlebenden findet sie sich in einem ehemaligen Militärlager, der Akademie, wieder. Hier werden sie auf das harte Überleben in einer Welt vorbereitet, in der alles Leben von einem Virus ausgelöscht wurde.
Doch bald häufen sich merkwürdige Vorfälle und Pandora muss entscheiden, wem sie vertraut. Kann sie sich auf ihre Intuition verlassen?
Der packende Auftakt der Pandora-Stone-Trilogie von Barry Jonsberg.
Alle Bände der Pandora-Stone-Trilogie
Band 1 - Heute beginnt das Ende der Welt
Band 2 - Gestern ist noch nicht vorbei
Band 3 - Morgen kommt vielleicht nie mehr
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Barry Jonsberg
Heute beginnt das Ende der Welt
Aus dem Englischen von Bettina Obrecht
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Erstmals als cbt Taschenbuch Dezember 2020
© 2015 by Barry Jonsberg
© 2020 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Pandora Jones – Admission « bei Allen & Unwin, AUS
Aus dem Englischen von Bettina Obrecht
Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik & Typografie
Umschlagmotive © Getty Images (Andrea Comi, Xuanyu Han)
FK · Herstellung: AS
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-17830-7V001www.cbj-verlag.de
Prolog
Es dauerte keine acht Stunden, bis ganz Melbourne tot war.
Wenn Pandora Stone an jenen Tag zurückdachte – und das kam häufig vor –, taten sich in ihrer Erinnerung große Lücken auf. Sie erinnerte sich ganz deutlich daran, dass sie am Küchentisch gefrühstückt hatte und im Radio gerade die Nachrichten gelaufen waren, während ihre Mutter in der Küche hantierte und das Lunchpaket für ihren Bruder Danny packte.
Im Hintergrund plapperte der Reporter, aber sie beachtete ihn nicht. Danny jammerte, er fühle sich nicht wohl und wolle nicht zur Schule gehen. Sein Protest wurde immer lauter, denn seine Mutter bestand darauf, dass er gehen musste. Das Ganze hatten sie schon allzu oft durchgespielt. Danny wollte häufig nicht zur Schule gehen, und wenn er eine Begründung dafür suchte, war seine Fantasie begrenzt.
»Ich habe Halsschmerzen«, flehte er. »Und einen ganz schlimmen Husten.«
Er hustete, als wolle er seiner Behauptung mehr Gewicht verleihen. Ein wirklich schwacher Versuch, wie Pan fand: Es klang absolut nicht überzeugend.
Der Reporter berichtete jetzt von der Wahl eines neuen Papstes und darüber, wie die prominenten Kirchenmänner von Melbourne auf diese Ernennung reagiert hatten. Pan träumte sich weg, rührte mit dem Löffel in ihren Cornflakes.
»Keine Chance, Kumpel«, sagte Pans Mum. »Als ich diese Entschuldigung das letzte Mal geschluckt habe, hast du den ganzen Tag an deinem Computer gespielt.«
»Gar nicht den ganzen Tag.«
»Doch, den ganzen Tag«, widersprach Mum. »Du vergisst, Daniel, dass ich genau kontrollieren kann, wie lange du online warst. Leg mich einmal rein – Schande über dich! Leg mich zweimal rein – Schande über mich! Geh jetzt und mach dich für die Schule fertig.«
»Ich bin krank!« Aber er ging, stampfte die Treppen hoch, mit einer Energie, die zu seiner angeblichen Krankheit im Widerspruch stand.
Mum sah ihre Tochter an und hob die Augenbrauen. Pan lächelte. Dann nahm die Radiosprecherin mit den Worten »Gerade erreicht uns eine Nachricht …« ihre Aufmerksamkeit in Anspruch. Ganz genau hörte sie trotzdem nicht hin. Nicht direkt. Sie trug ihre Schüssel zur Spüle, wusch sie aus und stellte sie auf das Trockengestell. Dann öffnete sie ihre Schultasche, zog ihren Kalender hervor und überprüfte ihren Stundenplan für den heutigen Tag. Pan wusste, dass sie eine Doppelstunde Mathe hatte, aber sie erinnerte sich nicht mehr genau daran, ob es die beiden ersten Stunden waren. Die Stimme der Radiosprecherin drang verschwommen in ihr Bewusstsein.
… von der amerikanischen Ostküste, den Staaten Maine und Pennsylvania, werden Fälle bestätigt und anderen Berichten zufolge sind auch Teile von New Jersey besonders stark betroffen. Genaueres zu diesen Meldungen erfahren wir jetzt von unserem Amerikakorrespondenten, Mark McAllister. Mark?
Danke, Jeanette. Ich befinde mich hier in New York. Die Krankenhäuser der Stadt melden einen bedeutenden Anstieg der Einweisungen. Dieses Grippevirus – und ich muss darauf hinweisen, dass das Virus bis jetzt noch nicht offiziell identifiziert worden ist – scheint sich mit hoher Geschwindigkeit auszubreiten, sodass die Behörden die Situation aufmerksam verfolgen. Der Bürgermeister hat an die Bevölkerung appelliert, Ruhe zu bewahren.
Gibt es Berichte über Todesfälle, Mark?
Im Moment nicht von offizieller Seite, Jeanette, allerdings verdichten sich die Gerüchte, dass in Maine in den letzten Stunden mehrere Menschen gestorben sind, und es steht fest, dass die Behörden die Situation sehr ernst nehmen.
Was weiß man im Moment über das Virus?
Sehr wenig. Offenbar ist es erstmals in einigen Regionen von New England aufgetreten und hat sich sehr rasch ausgebreitet. Es sind noch keine vierundzwanzig Stunden vergangen, seit der erste Patient eingewiesen worden ist, daher konnte das Virus natürlich noch nicht abschließend untersucht werden. Es bleibt abzuwarten, was geschieht, und ich melde mich sofort, wenn es neue Erkenntnisse gibt.
Danke, Mark. Und pass auf dich auf.
Mark hustete. Nur ein Mal.
An andere Einzelheiten dieser Nachrichtensendung konnte sich Pan nicht erinnern. Sie konnte nicht mehr sagen, wie ihre Mutter auf diese Meldung reagiert hatte, ob Danny letztendlich zur Schule gegangen war oder nicht. Sie konnte sich nicht einmal mehr daran erinnern, wie sie das Haus verlassen hatte. Je angestrengter sie sich bemühte, desto schwieriger wurde es. Es war eine Lücke, eine hartnäckige Leerstelle.
Sie erinnerte sich erst wieder daran, wie sie an jenem Tag zu Fuß vom Bahnhof zur Schule gegangen war, nicht an die Zugfahrt davor. Sie erinnerte sich daran, dass ihr einen Kilometer von der Schule entfernt ein Mann durch eine Fußgängerzone gefolgt war. Sie erinnerte sich, dass es mit einem merkwürdigen Jucken zwischen ihren Schulterblättern begonnen hatte, einem Gefühl, als würde sie jemand beobachten. Das Gefühl war so deutlich, dass sie stehen geblieben war, sich umgedreht hatte, aber im ersten Moment hatte sie nichts gesehen. Dann erst hatte sie ihn entdeckt. Eine unauffällige Person, die sich nicht schneller und nicht langsamer bewegte als jede andere. Ein Mann Anfang dreißig, mit kurzen Haaren, im Anzug, weiße Kabel schlängelten sich aus seinen Jackentaschen bis in seine Ohren. An ihm war überhaupt nichts Ungewöhnliches. Er hielt den Blick auf den Boden gesenkt und sein Kopf bewegte sich leicht im Takt der Musik, die nur er hören konnte. Er sah Pan nicht einmal beiläufig an, aber sie wusste, dass an ihm etwas nicht in Ordnung war. Es war nur schwer zu sagen, woran genau das lag.
Wie immer morgens waren in der Fußgängerzone viele Menschen unterwegs. Einzelhändler sperrten ihre Läden auf, Geschäftsleute hasteten mit Kaffeebechern in der Hand vorbei. In der Anwesenheit so vieler Menschen konnte ihr nichts geschehen. Sie hatte also keine große Angst, aber sie hielt an, setzte sich auf eine Bank und öffnete ihre Schultasche. Sie wühlte in den Tiefen der Tasche herum, beobachtete aber aus den Augenwinkeln den Mann, der an ihr vorüberging. Sein Schritt verlangsamte sich nicht. Er ging einfach weiter. Nicht besonders schnell, nicht besonders langsam. Sah sie nicht an. Sie starrte auf seinen Rücken, als er sich durch die Menge fädelte, aber er wandte sich nicht um. Nach wenigen Augenblicken war er im Gedränge verschwunden.
Ihre Fantasie hatte ihr einen Streich gespielt – nicht zum ersten Mal. Ihre Mutter und ihre Lehrer kannten das von ihr nur zur Genüge. »Pandora ist mit einer fruchtbaren, schier grenzenlosen Fantasie ausgestattet«, hatte in ihrem letzten Englischzeugnis gestanden. »Aber sie täte gut daran, diese Fantasie besser zu zügeln.« Da war etwas Wahres dran. Das musste sie zugeben. Aber ihr war auch klar, dass sich allein durch eine überschäumende Fantasie nicht alles erklären ließ.
So etwas wie heute hatte sie schon mehrmals erlebt. Da war so ein Gefühl gewesen. Eine Eingebung. Intuition. Pan kannte kein Wort, das genau ausdrückte, was sie tief im Inneren empfand. Vielleicht hatte sie eine besondere Begabung dafür, in Gesichtern zu lesen, Körpersprache, Situationen, die Umgebung zu deuten. Aber sie konnte nicht so tun, als existierte ihre Begabung nicht. Es gab allzu viele Beweise dafür, dass sie sich das nicht einbildete. Zum Beispiel damals, als sie gleich gewusst hatte, dass ihre beste Freundin Joanne sich von ihrem Freund getrennt hatte. Pan hatte es gewusst, bevor Joanne etwas sagen konnte. Oder damals, als ihre Mutter ihre Schlüssel verlegt hatte und Pan genau vor sich sah, wo diese sich befanden. Und letztes Jahr ihr Mathelehrer. Er schien vor Gesundheit zu strotzen. Er kam jeden Tag im Dauerlauf zur Schule. Er hatte sogar am London Marathon teilgenommen und war dort unter die ersten Hundert gekommen. Aber eines Tages, als er vorne am Whiteboard stand, hatte Pan gespürt, dass in seinem Inneren etwas … nicht in Ordnung war. Sie hatte als eine unter vielen Schülern und Schülerinnen seiner Beerdigung beigewohnt. Aber wahrscheinlich war sie die Einzige unter den Trauernden, die sein plötzlicher, tödlicher Herzinfarkt nicht überrascht hatte.
Es funktionierte nicht immer. Manchmal gingen diese Ahnungen, diese Intuitionen, ins Leere. Und doch war Pan auch dann nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass sie falsch gelegen hatte.
Pan seufzte. Es hatte keinen Sinn, das alles wieder durchzugehen. Sie musste ihrem eigenen Gefühl vertrauen. Dieser Typ hatte sie gerade wirklich beobachtet. Dass er seinen Blick zu keinem Zeitpunkt offensichtlich auf sie gerichtet hatte, änderte nichts daran. Vielleicht war er einfach nur irgendein Perverser, einer, dem es einen Kick gab, sechzehnjährige Schulmädchen zu beobachten. So etwas kam vor.
Pan griff nach ihrer Schultasche. In der Menge tauchte ein Gesicht auf, ein lächelndes Gesicht. Joanne winkte ihr zu, Pan winkte zurück. Sie stand auf und ging hinüber zu ihrer Freundin.
Wieder eine Lücke. Wieder Leere. Pan saß im Unterricht, aber sie wusste nicht mehr, um welches Fach es sich handelte. Eine Aushilfslehrerin war da, eine große Frau mit einem auffälligen Leberfleck auf der rechten Wange. Pan hatte sie noch nie gesehen und dabei hatte sie gedacht, sie kenne alle Aushilfslehrer, die an ihrer Schule angestellt waren. Die Frau stand vor der Klasse und redete. Pan sah sich im Klassenzimmer um. Es fehlten so viele Schüler. Normalerweise waren sie fünfundzwanzig Mädchen und Jungen, aber heute waren nur sechs oder sieben davon anwesend. Als sie später versuchte, sich in Erinnerung zu rufen, welche es waren, war da nur eine Erinnerungslücke.
»Schlagt Seite hundertvierzig in eurem Buch auf und lest euch das Kapitel durch. Dann beantwortet die Fragen, die ich jetzt gleich an die Tafel schreibe. Schreibt sie in eure …« Die Frau hustete. Sie hielt sich die Hand vor den Mund und hustete noch einmal. Sie beugte sich dabei leicht vor und legte sich die andere Hand auf die Brust. In der Klasse war es still. Die Frau holte tief Luft und richtete sich wieder auf.
»Entschuldigung. Wie gesagt, …«
Der nächste Hustenanfall war heftiger. Diesmal legte sie sich beide Hände vors Gesicht, das eine blassblaue Farbe angenommen hatte. Ihre Augen traten aus den Höhlen. Das Husten schien sie zu zerreißen. Sie stolperte nach vorn und sank schwer auf einen der leeren Stühle in der ersten Reihe. Pan stand auf, unsicher, ob die Lehrerin Hilfe brauchte oder ob der Anfall von allein enden würde. Er tat es nicht. Jedes Husten schüttelte ihren Körper und sie rang ganz offensichtlich verzweifelt nach Luft. Ihr Gesicht wurde dunkler und ihr Körper krümmte sich so sehr, dass ihre Nase beinahe den Boden berührte. Pan rannte nach vorne. Undeutlich war ihr bewusst, dass sich außer ihr niemand gerührt hatte. Was tat man in so einer Situation? Der Frau auf den Rücken klopfen und hoffen, dass es vorüberging, oder im Sekretariat um Hilfe bitten? Sie wusste es nicht. Die Frau taumelte von ihrem Stuhl und lag jetzt auf der Seite. Noch immer wurde sie von ihrem Husten geschüttelt. Pan kniete sich neben sie. Die Augen der Lehrerin waren vor Angst weit aufgerissen. Sie nahm eine Hand vom Mund und streckte sie nach Pan aus, als suche sie Hilfe oder Trost. Pan packte die Hand. Es dauerte einen Moment, bis ihr bewusst wurde, dass die Hand der Lehrerin feucht und klebrig war. Instinktiv versuchte sie, sich loszumachen, aber die Frau hatte sie zu fest gepackt.
Es schien nicht mehr möglich, aber der Husten wurde noch schlimmer, heftiger, durchgehender. Auf einer Seite war das Gesicht der Frau blutverschmiert. Die andere Hand fiel von ihrem Mund, auch sie war rot verklebt. Pan wurde übel, aber sie konnte sich nicht bewegen. Die Frau hielt sie so fest, als versuche sie, Pan eine Art seltsamer Umarmung aufzuzwingen.
Der letzte Hustenanfall war nicht so heftig wie die anderen, aber er sprühte feine rote Tröpfchen in Pans Gesicht und ihre Haare. Sie zuckte zurück und der Griff der Frau lockerte sich. Pan hielt sich ihre Hände vors Gesicht und sah das Blut. Als sie wieder nach unten blicke, waren die Augen der Frau weit aufgerissen, als sei sie verwundert, und ihr glasiger Blick ging durch Pan hindurch.
Wieder eine Lücke. Pan ging eine Einkaufsstraße hinunter. Da waren Läden, Cafés, Tische und Stühle auf dem Bürgersteig, bunt leuchtende Markisen und Sonnenschirme. Vögel hüpften auf die Tische und pickten nach den Tellern. Die meisten Tische waren leer, nur vereinzelt saßen Menschen da, merkwürdig reglos. Pan legte sich eine Hand auf die Stirn. Sie war heiß, an ihrer Hand klebte Schweiß. Auch mit ihren Augen war etwas nicht in Ordnung. Die Welt sah ganz merkwürdig aus, als wäre das, was um sie herum geschah, ganz weit weg. Sie hatte Schwierigkeiten, scharf zu sehen, und am Rand ihres Sichtfelds schwammen wurmartige Flecken herum, wie Bakterien unter einem Mikroskop. War sie krank? Ihr kam es vor, als sei in jüngster Zeit noch jemand sehr krank gewesen, aber sie konnte die Erinnerung nicht zuordnen. Ihre Beine fühlten sich schwer an und sie musste sich regelrecht zwingen, einen Schritt nach dem anderen zu machen.
An der ganzen Situation stimmte etwas nicht, aber Pan konnte zunächst nicht genau sagen, was. Es hatte mit den Geräuschen zu tun. Das Gezwitscher der Vögel war so durchdringend. Unnatürlich laut in der sie umgebenden Stille. Sie konzentrierte sich mit aller Kraft. Das war es. Die Stille der Umgebung. Um diese Tageszeit – sie wollte noch einmal auf ihre Armbanduhr sehen, aber an ihrem Handgelenk befand sich nichts außer einem Streifen blasser Haut dort, wo das Sonnenlicht nie hingekommen war – herrschte doch gewöhnlich dichter Verkehr, Stimmengewirr, der ständige Tumult einer geschäftigen Stadt. Pan blieb stehen und sah sich um. Autos waren in verkehrswidrigen Positionen geparkt. Eine Straßenbahn hatte mitten auf der Fahrbahn angehalten, mit geöffneten Türen, und Pan konnte die Gestalt des Straßenbahnführers als dunkle Silhouette gegen das Sonnenlicht ausmachen. Er regte sich nicht. Eine plötzliche Bewegung weiter die Straße herunter erregte ihre Aufmerksamkeit. Jemand kam aus einem Laden gestolpert. Es war eine Frau. Ein Kleiderbündel hing über ihrem Arm. Mehrere Kleiderbügel hatten sich zu einer bunt schillernden Metallkette verhakt, die hinter der Frau her klapperte. Die Frau blieb stehen, stützte sich mit der Hand an einem Laternenpfahl ab und schien sich einen Moment zu sammeln. Sie drückte die Kleider eng an sich.
Ein Geräusch, eine Bewegung rechts von Pan. Sie wandte den Kopf, aber es fühlte sich an, als wollte sie mit Gewalt an etwas drehen, das sich verklemmt hatte. Sie spürte, wie ihre Halswirbel knirschten und krachten. Ein Auto fuhr wilde Schlangenlinien, allerdings mit maximal zwanzig, vielleicht dreißig Kilometern pro Stunde. Sonnenlicht spiegelte sich in seiner Windschutzscheibe und Pan zuckte zusammen, als die Lichtreflexe wie Dolche in ihre Augen stachen. Sie konnte den Fahrer nicht sehen. Der Wagen schabte an einem geparkten Auto entlang und verursachte ein schmerzhaftes Kreischen von Metall gegen Metall. Der Wagen hielt nicht an. Er prallte von dem geparkten Auto ab und streifte die Straßenbahn. Aber er hielt immer noch nicht an. Er fuhr weiter ganz langsam die Straße hinunter. Pan wusste, was passieren würde, aber sie verstand nicht, woher sie das wusste. Die Frau – eine Ladendiebin? Sie trug keine Taschen – trat auf die Straße. Sie hielt den Blick starr auf die andere Straßenseite gerichtet, als läge dort ihre Rettung. Sie sah nicht nach links oder rechts. Auch das Auto wich nicht aus. Es fuhr direkt gegen sie und die Frau flog hoch in die Luft, vollführte eine halbe Drehung. Die Darbietung war beinahe schön. Bis Pan das Geräusch hörte, mit dem der Kopf der Frau auf den Asphalt aufschlug. Selbst aus der Ferne hatte das Krachen etwas grauenvoll Endgültiges. Sofort breitete sich eine Blutlache unter dem zertrümmerten Schädel aus, bildete auf dem Boden ein unordentliches Muster.
Pan konnte sich nicht bewegen. Sie beobachtete, wie der Arm der Frau zuckte, wie die Hand nach dem Kleiderbündel griff. Ihre Hand krallte sich in den Stoff, dann erstarrte sie. Der Wagen fuhr noch dreißig oder vierzig Meter weiter die Straße hinunter und geriet dann auf den Gehweg. Er prallte gegen eine Parkuhr und verbog diese in einem grotesken Winkel, dann rauschte er in ein Schaufenster. Das Fenster zersprang und fiel in dicken Wolken aus Glassplittern in sich zusammen. Alles schien in Zeitlupe abzulaufen. Die Fahrertür sprang auf, aber niemand stieg aus. Pan sah noch minutenlang hin, aber es geschah nichts mehr. Es war wieder ganz still, bis auf das Gezanke der Vögel.
Pan war müde. Plötzlich war es unmöglich, sich zu bewegen. Am Rande ihres Bewusstseins tauchten Gedanken auf, aber sie entglitten ihr sofort wieder. Sie sollte helfen. Sie sollte eigentlich zu der Frau hinübergehen und prüfen, ob sie noch irgendetwas für sie tun konnte. Losgehen und nachsehen, wie es dem Fahrer des Wagens ging. Das tat man doch normalerweise in so einer Situation, oder? Aber es war alles zu anstrengend. Sie musste sich setzen, ihre Gedanken sammeln, Kraft schöpfen. Selbst das war schwierig.
Ihr wurde bewusst, dass sie sich neben einem Straßencafé befand. Unter den Sonnenschirmen, die mit Werbung für italienischen Kaffee bedruckt waren, standen Metallstühle. Sie musste sich setzen. Wenigstens einen Moment lang. Dann würde sie losgehen und nachsehen, ob sie irgendwie helfen konnte. Beinahe hatte Pan schon wieder vergessen, warum möglicherweise Hilfe erforderlich war. Hinsetzen. Wenigstens einen Moment. Sie zwang ihre Beine, sich zu bewegen, aber es war schwierig, sie unter Kontrolle zu halten. Sie wäre beinahe gefallen, musste eine Hand ausstrecken, um sich abzustützen. Endlich sank sie in einen Stuhl. Das kalte Metall fühlte sich auf ihren nackten Beinen herrlich an. Pan legte die Hände auf den Tisch und kämpfte gegen die Versuchung an, ihren Kopf auf die kühle Oberfläche zu legen. Da war so ein aufdringlicher Gedanken in ihrem Hinterkopf, der sie warnte: Wenn du dich jetzt ausruhst, stehst du vielleicht nie wieder auf. Aber sie schloss trotzdem die Augen. Das Licht schmerzte und da waren so viele Gedanken, die sie sortieren musste. Ein Ziel. Ein Ort, den sie erreichen musste. Zuhause. Genau, das war es. Sie musste nach Hause, nur hatte sie nicht die leiseste Ahnung, wo ihr Zuhause lag.
Als jemand ihr Handgelenk packte, zuckte sie nicht einmal zusammen. Sie schlug die Augen auf und musterte die fremde Hand gleichgültig. Sie war sehnig und hielt sich mit verzweifelter, trotziger Kraft an ihr fest. Sie sah, wie ihre eigene Hand immer blasser wurde, weil die Blutgefäße abgeschnürt waren. Pan ließ den Blick weiterwandern, sah erst das fremde Handgelenk, dann den Arm. Der Ärmelstoff, der allmählich in ihr Sichtfeld geriet, kam ihr irgendwie bekannt vor, aber wieder entglitt ihr jede Erinnerung. Sie hob den Blick.
Ein Polizist. Natürlich. Ein kleiner Teil von ihr spürte Erleichterung. Die Polizei regelte alles. Sie machte alles gut, stellte wieder Ordnung her. Pan war nicht klar, woher sie das wusste, aber dies war definitiv eine Situation, in der die Ordnung wiederhergestellt werden musste. Der Polizist war schätzungsweise Mitte dreißig. Er trug einen dünnen Schnurrbart und sein Gesicht war von Pickelnarben gezeichnet. Aber ihr Blick blieb an etwas anderem hängen: seinen Augen. In ihnen lag ein wilder Ausdruck, der sich schwer deuten ließ. War es Angst? Entsetzen? Sein Mund öffnete sich und Pan sah, dass aus seinem Mundwinkel Blut sickerte.
»Alle tot«, sagte der Mann.
Pan versuchte, sich daran zu erinnern, wie man sprach. Es war verblüffend schwierig. Zunächst konnte sie nur krächzen.
»Tot?«, sagte sie schließlich.
Der Polizist nickte heftig und Pan war froh, dass sie ihn verstanden hatte. Aus irgendeinem Grund hielt sie es für wichtig, auf den Mann so zu wirken, als habe sie die Situation im Griff.
»Wer?«, fügte Pan noch hinzu.
Der Mann ließ ihr Handgelenk los und gestikulierte in Richtung Straße.
»Alle«, sagte er.
Mit Mühe riss Pan sich von diesen Augen los und zwang sich, ihren Blick auf die Straße zu richten. Jetzt erkannte sie, was ihr zuvor entgangen war. Wie hatte sie das übersehen können? Wie hatte sie das Auto übersehen können, aus dessen Tür der Fahrer heraushing, sein Gesicht zerschrammt, die Augen weit aufgerissen mit leerem Blick? Und die Leichen mitten auf der Straße in einer großen Blutlache? Die Frau im Stuhl ihr schräg gegenüber, die sich zurückgelehnt hatte, als würde sie den Himmel betrachten, mit herabhängenden Armen, die Brust blutbefleckt? Ein Vogel saß auf ihrer Schulter. Während Pan ihn beobachtete, stieß er seinen Schnabel in die leblose Augenhöhle. Etwas zerplatzte und Pan wandte schnell den Blick ab.
Der Polizist erschauderte und setzte sich in den Stuhl neben Pan. Er hustete ein paarmal und hielt sich einen Ärmel vor den Mund. Als der Hustenanfall endete, klebte ein breiter Blutstreifen an seinem Arm.
»Meine Frau und mein Baby. Beide tot«, sagte er. Er begann lautlos zu weinen. Pan sah, wie Tränen über seine Wangen liefen. »Bin heimgefahren«, fuhr er fort. »Ich kann dir gar nicht erzählen, was ich unterwegs gesehen habe. Zu viele schreckliche Dinge. Zu viele. Ich habe sie im Bett gefunden. Tot. Meine Frau. Laura. Sie hatte das Baby im Arm. So klein. Ihr Leben hatte gerade erst angefangen, und jetzt ist sie tot. Ich kam zu spät, weißt du? Verstehst du? Ich kam zu spät. Ich konnte nicht mit ihnen sterben.«
»Es tut mir leid«, sagte Pan.
»Mir auch«, sagte der Polizist. Er hantierte an seinem Gürtel, aber Pan starrte wieder wie gebannt in seine vor Entsetzen geweiteten Augen und beachtete nicht, was er da tat. »Ich bin hierhergekommen«, fuhr der Mann fort. »Keine Ahnung, warum. Vielleicht, um nachzusehen, ob noch jemand lebt. Wer weiß?« Er sah Pan in die Augen. »Niemand wird da sein, um uns zu begraben, ist dir das klar? Das weißt du doch, oder? Wir werden einfach hier verfaulen.«
»Ich lebe«, sagte Pan.
»Nicht mehr lang«, sagte der Polizist. »Wir sind alle tot, nur dass manche von uns es noch nicht wissen.« Er hob die Hand und steckte sich etwas in den Mund. Es war lang und schwarz und es dauerte einen Moment, bis Pan verstand, worum es sich handelte. Selbst wenn sie die Energie aufgebracht hätte, es zu versuchen, hätte sie ihn nicht aufhalten können. Der Schuss war laut und im selben Moment umgab sie ein Geruch nach verbranntem Fleisch und Schießpulver. Sein Hinterkopf explodierte in einer Nebelwolke aus Blut und Knochensplittern. Einen Sekundenbruchteil lang saß er so da, den Blick immer noch auf Pan gerichtet. Dann fiel er vom Stuhl.
»Tut mir leid, aber ich muss jetzt nach Hause«, sagte Pan. »Meine Mutter und mein Bruder warten auf mich.« An den Namen ihres Bruders konnte sie sich nicht erinnern, aber sie rechnete fest damit, dass er ihr im richtigen Moment wieder einfallen würde.
Lücken. Zusammenhanglose Erinnerungsstücke. Ein Flugzeugabsturz? Hatte sie das gesehen? Ein kreischender Lärm, der sie dazu veranlasst hatte, den Blick in den Himmel zu richten. Ein Flügel, der einen Wolkenkratzer köpfte, verbogenes Metall, das durch die saubere Luft wirbelte. Eine Explosion und eine schwarze Rauchwolke. War das eine Erinnerung?
Die Toten, die überall im Park herumlagen. Jemand, der mit einer Pistole in der Hand die Straße heruntergestolpert kam, in die leeren Ladengeschäfte hineinschoss und über den Lärm der zerberstenden Schaufenster lachte. Ein Auto, das in einen Brückenpfeiler raste und bei dem Aufprall zerfetzt wurde. Etwas flog durch die Windschutzscheibe. Ein Mädchen in einem weißen Kleid, das am Straßenrand saß, mit einer Puppe spielte, hustete. Die Hand einer Frau hielt, die reglos neben ihr lag. Ein Körper, der aus einem Fenster im ersten Stock baumelte, zusammengenknotete Laken um den Hals. Pan konnte nicht sagen, was real war, was nur ein Fiebertraum.
Sie erinnerte sich nicht daran, wie sie dort hingekommen war, aber plötzlich war da eine vertraute Straße und ein vertrautes Haus. Die Haustür stand offen und einem Teil von ihr kam das merkwürdig vor. Pan stolperte von einem Raum in den anderen, aber es war niemand da. Der Fernseher lief, aber es gab kein Bild. Nur statisches Rauschen, ein zischender Sturm. Sie ging in den nahen Park. Manchmal ging ihre Mutter in den Park und ein anderes Ziel fiel Pan nicht ein. Es war, als hätte sie in einem Moment die Entscheidung getroffen und sich im nächsten Moment schon zwischen den Bäumen auf einem der gewundenen Wege befunden. Die Sonne tauchte alles in gesprenkeltes Licht. Etwas weckte ihre Aufmerksamkeit – ein entferntes Geräusch, vertraut und doch schwer fassbar. Dann erkannte sie darin das Quietschen von Ketten. Sie ging auf das Geräusch zu, bog vor dem kleinen See ab und schob sich durch einen Vorhang aus tief herunterhängenden Zweigen.
Ein Spielplatz. Das Kettenquietschen stammte von einer sich bewegenden Kinderschaukel. Ein Junge schwang sich vor und zurück. Seine Knie bogen sich, wenn er Schwung nahm, er schaukelte höher und immer höher. Eine Frau saß in seiner Nähe auf einer Bank. Sie hielt sich die Hand vor den Mund. Pan nahm an, dass die Frau ihre Mutter war, der Junge ihr Bruder. Aber sie war sich nicht ganz sicher. Sie ging ein paar Schritte weiter, auf die beiden zu.
Die Frau wurde regelmäßig von der vorüberschwingenden Schaukel verdeckt, aber sie sah auf und lächelte. Es war ein ganz und gar müdes, trauriges Lächeln.
»Ich wusste, dass du kommst«, sagte sie.
Dann hustete sie – ein abgehacktes Bellen – und hielt sich die Hand vor den Mund. Die Frau fing sich, sah Pan entschuldigend an. Die Schaukel schwang an ihrem Gesicht vorüber, regelmäßig wie ein Metronom.
Der zweite Hustenanfall war heftiger. Sie krümmte sich, ihr Kopf berührte beinahe ihre Knie. Diesmal wurde sie vom Husten schmerzhaft geschüttelt. Und es hörte nicht auf. Sie rang nach Luft, aber der nächste Anfall kam zu schnell. Pan sah, wie ihr Gesicht anschwoll und sich blutrot verfärbte, wie ihre Hände den Mund verdeckten, wie ihr Körper sich verkrampfte, als ihre Lungen kurz vor dem Platzen standen.
Pan ging an dem Jungen auf der Schaukel vorbei. Sie setzte sich neben die Frau auf der Bank, nahm sie in den Arm und klopfte ihr mit der Hand den Rücken. Nichts änderte sich, außer dass das Husten doppelt so heftig wurde. Es war, als würde die Frau einfach entzweigerissen. Ein Blutstropfen drang zwischen ihren Fingern hindurch, fiel zu Boden, eine hellrote Münze zwischen ihren Füßen. Ein weiterer und noch ein weiterer folgten. Die Tropfen zeichneten einzelne, leuchtende Kreise. Dann verbanden sie sich, bildeten eine Pfütze. Vor Pans Augen dehnte sich die rote Fläche aus. Die Tropfen fielen jetzt nicht mehr einzeln aus den Händen der Frau, sondern zogen lange Fäden. Sie sah hoch zu dem Jungen auf der Schaukel.
Der Bogen, den die Schaukel beschrieb, wurde allmählich flacher. Der Junge hustete, aber sie konnte ihn nicht hören. Die Frau war zu laut. Der Junge nahm eine Hand von der Schaukelkette und rieb sich über den Mund. Er hustete jetzt ununterbrochen. Als er die Hand wegnahm, war sie rot verschmiert. Pan stand da, hin und her gerissen zwischen den beiden – der Frau auf der Bank, dem Jungen, der durch die Sommersonne schaukelte.
Vielleicht legte sich Pan im Park ins Gras, gefangen zwischen dem Sterben der beiden Menschen. Vielleicht streckte sie sich aus, hielt ihr Gesicht in die flimmernde Sonne. Nach einer Weile nahm sie nur noch Stille wahr. Möglicherweise schlief sie ein. Oder wurde bewusstlos. Nichts ergab einen Sinn. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass jemals etwas einen Sinn ergeben hatte. Die Stille legte sich auf sie wie eine Decke und sie gab sich ihr hin.
Zeit hatte keine Bedeutung. Aber es musste einige Zeit vergangen sein, bis ihr bewusst wurde, dass sich die Stille verändert hatte. Etwas brummte. Ein vertrautes Geräusch, aber sie war viel zu müde, um es zu deuten. Es sollte einfach nur verschwinden, dieses lästige Insekt, das ihre Träume störte. Es verschwand nicht. Es wurde lauter. Das Brummen wurde zu einem lauten Dröhnen. Ein kleiner Teil von ihr bemerkte den Luftzug in ihrem Gesicht. Es war keine angenehme Brise. Es roch nach Öl und Staub und sie musste husten. Dann eine letzte Erinnerung. Sie wurde hochgehoben. Jemand redete mit ihr, auch wenn sie die einzelnen Worte nicht unterscheiden konnte. Das Gefühl von Bewegung, das Dröhnen von Rotoren und die Gewissheit, dass sie höher und höher in den Himmel gehoben wurde, dass der Park unter ihr schrumpfte. Man brachte sie fort von der Welt.
Ihr Kopf war voller Horrorbilder. Sie wollte nur noch abschalten. Aber ein Bild nagte an ihr, dumpf wie ein schmerzender Zahn. Nicht ihre Mutter, die sich auf einer Parkbank die Seele aus dem Leib hustete, nicht die blutgetränkte Hand ihres Bruders. Nicht der Sprühnebel aus Hirnmasse, erzeugt von jener Kugel, die sich der Polizist durch den Kopf geschossen hatte. Keines dieser merkwürdig zerstückelten Bilder des Todes.
Stattdessen dachte sie an den Mann in der Fußgängerzone, jenen Mann, den sie verdächtigt hatte, ihr zu folgen. Es war die belangloseste Erinnerung überhaupt, aber sie spürte, dass sie wichtig war. Nicht nur wichtig. Entscheidend.
Pan ergab sich der Dunkelheit.
1.
Ein Garten. So etwas in der Art.
Blumen sprossen aus bunten Töpfen. Der Boden bestand aus rauem, blankem Fels. Hier und da hatten Flechten in einer Ritze Halt gefunden und kämpften ums Überleben, sonst war alles kahl und öde. Der Garten lag auf einer Bergkuppe, an einer halbwegs flachen Stelle. Es sah so aus, als habe jemand die oberste Spitze einer Pyramide nachlässig abgesäbelt und auf diese Weise ein unregelmäßiges Areal von ein paar Hundert Quadratmetern Fläche geschaffen. Wenn man in der Mitte dieses Gartens stand, konnte man nichts weiter sehen als diese steinige Ebene, über die in unregelmäßigen Abständen Pflanztöpfe mit unterschiedlichen Blumen verteilt waren. Überwiegend wuchs in den Töpfen rosa blühendes Heidekraut, eine widerstandsfähige Pflanze, die sich gegen Kälte und Eis behaupten konnte, aber da waren auch noch andere Blumen, die sie nicht kannte, rote und grüne und gelbe. Es war wie eine graue, wild mit leuchtenden Farbtupfern bekleckste Leinwand. Der Garten glich einem abstrakten Gemälde.
Pandora Stone stand in der Mitte. Die Kälte kroch in ihre Knochen und ein scharfer Wind durchdrang wie die Klinge eines Skalpells ihr leichtes, knöchellanges Gewand. Er presste den Stoff gegen ihren Körper. Ihre nackten Füße auf dem Fels brannten. Sie hatte keine Ahnung, wie sie hierhergekommen war. Ihr Kopf war leer – keine Erinnerung, die diese kalte Gegenwart mit irgendetwas Vorherigem verband. Ganz allmählich kam sie zu sich. Ihre Sinne schalteten sich nacheinander wieder ein. Der messerscharfe Wind, der harte Fels unter ihren Füßen, die Farben, die sich ihren Augen aufdrängten.
Sie bewegte sich, ohne bewusst nachzudenken. Ihr rechter Fuß hob sich, machte einen Schritt. Und ihr linker Fuß beugte sich am Knöchel, hob sich, sobald der rechte auf dem Fels Halt gefunden hatte. Ihr Körper gehorchte Befehlen, die sie ihm nicht bewusst gab. Sie bewegte sich auf einen grauen Horizont zu, die Stelle, an welcher der Fels mit dem schlammfarbenen Himmel verschmolz. Nach und nach, mit jedem Schritt, wurde mehr von der umgebenden Landschaft sichtbar. Fünf Schritte vor einem Abgrund hielt sie an und sah sich um. Nur rein mechanisch begann ihr Verstand alle Eindrücke zu verarbeiten. Ihre Augen nahmen Einzelheiten wahr, aber sie bedeuteten nichts. Im Zentrum ihres Bewusstseins stand eine Abfolge von grauenvollen Bildern, aber irgendwie schienen sie weit entfernt. Wie ein Albtraum, an den man sich nur undeutlich erinnerte, vor dem der Verstand zurückschreckte.
Der Berg, auf dessen Gipfel sie stand, war schwindelerregend hoch, aber erst jetzt konnte sie seine Höhe wirklich einschätzen. Hinter ihr lag ein Gebirgsmassiv, vor dem ihr Berg vergleichsweise winzig wirkte, als wäre er nur ein Kind der gewaltigen Felsmasse, das sich schutzsuchend an die riesigen Verwandten schmiegt. Ihre Gipfel verschwanden in den Wolken und es ließ sich nicht sagen, wie hoch sie wirklich waren. Sie durchstießen den grauen Himmel und verschwanden. An ihren steilen Abhängen rührte sich nichts bis auf kleine Vogelschwärme, die von Zeit zu Zeit in die Höhe wirbelten, winzige Punkte gegen die Schnee- und Eisflächen. Die Gebirgskette überstieg ihr Vorstellungsvermögen und so richtete sie ihren Blick auf etwas, das leichter zu verstehen war. Etwas Kleineres. Pan starrte hinunter auf die Welt, die sich unter ihr erstreckte.
Der Gebirgszug umfasste die Landschaft von links nach rechts, so weit sie sehen konnte, unfassbar steile Ränder einer Schüssel, deren andere Seite zu einem fernen Meer abfiel. Darauf richtete sie nun ihren Blick. Selbst aus dieser Entfernung konnte sie sehen, wie die Wellen sanft gegen eine Felsenküste schlugen. Kleine weiße Flecken, die Wellenkämme, befanden sich in ständiger Bewegung, und dadurch wirkte die graue Wasserfläche irgendwie lebendig. Dann entdeckte sie eine Stelle, an der sich die Küste zu einer Bucht öffnete, ein schmaler Streifen Land, der sich schützend um das in dieser Bucht enthaltene Wasser legte. In der Bucht verankert lagen mehrere Boote, vielleicht ein Dutzend insgesamt. Sie wirkten wie Kinderspielzeug. Und dicht am Wasser erkannte Pan dicht zusammengedrängte Gebilde, vielleicht Hütten, und weitere, größere Gebäude. Eine Art Dorf, das um den Hafen herumgebaut worden war. Der Anblick war vertraut und gleichzeitig vollkommen fremdartig.
Sie richtete ihren Blick auf das, was etwas weiter im Landesinneren lag. Von Sekunde zu Sekunde spürte sie die Kälte deutlicher. Was sie als Nächstes entdeckte, verwirrte sie. Es war nichts, was sie auf Anhieb einordnen konnte Ihr Verstand musste daran arbeiten. Etwa einen oder zwei Kilometer vom Dorf aus landeinwärts erhob sich ein merkwürdiges Bauwerk. Ihr erster Gedanke war, dass es sich um eine Mauer handelte, aber falls das zutraf, war sie wirklich riesig. Sie verband die Bergkette links mit dem Gebirgsmassiv zu ihrer rechten Seite. Sie trennte das Meer und das Dorf am Strand vom Hinterland ab. Es gab keine Möglichkeit, das Wasser zu erreichen, ohne die Mauer zu überwinden. In regelmäßigen Abständen sprossen schlanke Türme aus dem Gemäuer, ihre Spitzen ragten in den Himmel. Das Bauwerk strahlte etwas Ungutes, ja, Bedrohliches, aus. Sollte es Schutz bieten vor dem, was außerhalb lag? Oder sollte es das, was sich auf seiner Innenseite befand, gefangen halten? Sie hatte nicht die Energie, diesem Gedanken weiter nachzugehen. Aber sie bewahrte die Fragen auf, um sie später genauer zu untersuchen.
Auf ihrer Seite der Mauer befand sich eine verwirrende Ansammlung von Gebäuden, die sich überall am kahlen Fels festklammerten. Merkwürdige Bauwerke, einige groß mit vielen Nebengebäuden. Es war fast unmöglich, ihre Dimension richtig einzuschätzen. Das Felsplateau, auf dem sie stand, lag hoch über den Gebäuden und die Höhe spielte ihrer Wahrnehmung einen Streich. Sie ließ ihren Blick darüber schweifen, versuchte, sich zu orientieren. Die Anlage wirkte chaotisch. Einige Gebäude drängten sich dicht aneinander, als bildeten sie eine besondere Gemeinschaft. Andere lagen abseits. Dünne Spuren führten zwischen den einzelnen Häusern hin und her, bildeten ein Labyrinth von Pfaden, die wahrscheinlich als Straßen dienten. Zu ihrer Linken befand sich ein Fluss, dessen Ufer mit Häusern zugebaut war. Die Monotonie der Gebäude wurde ab und an von ein paar grünen Stellen aufgelockert. Ein kleiner, üppiger Wald duckte sich am Ausläufer jenes Berges, an dem der Fluss zu entspringen schien.
Es wäre Pans Aufmerksamkeit beinahe entgangen, dass jemand einen Mantel über ihre Schultern legte. Sie war so intensiv damit beschäftigt, sich ein Bild ihrer Umgebung zu machen, dass sie kaum darauf achtete. Erst als ihr plötzlich wärmer wurde, schrak sie zusammen. Sie wandte sich um.
Der Mann lächelte ihr zu. »Hallo«, sagte er. »Dir ist bestimmt kalt.«
Sie zog den Mantel dichter um sich und nickte. Ihr Gesicht fühlte sich im Wind noch immer taub an, aber sie spürte schon, wie die neue, schützende Hülle ihren Körper erwärmte. Ihr war schwindlig, als erwache sie aus einem tiefen Schlaf. Es gab Fragen, die sie unbedingt stellen musste, aber es war zu schwierig, sie zu formulieren. Also nickte sie erneut und sah wieder hinunter ins Tal.
»Das ist eine Aussicht, was?«, sagte der Mann. Pan schwieg.
»Deswegen bin ich so froh darüber, dass das Spital hier oben liegt«, sagte der Mann. »Die schönste Aussicht, die man hier haben kann, meiner bescheidenen Ansicht nach. Ich komme so oft wie möglich hier heraus, wenn das Wetter gut ist … was es, ehrlich gesagt, bisher noch nicht war. Und die Blumen sorgen für ein bisschen Farbe. Lebewesen. Schönheit in dieser Ödnis. Der Garten auf dem Dach der Welt. Das muntert mich auf.«
Die Worte brummten in Pans Kopf. Sie waren lästig und sie wollte sie gerne wegscheuchen. Aber stattdessen, ohne dass sie es beabsichtigt hatte, löste sich das Wort von ihren Lippen. Es ließ einen eigenartigen, metallischen Geschmack in ihrem Mund zurück.
»Spital?«
»Ja. Ein Krankenhaus. Es liegt hinter dir. Wo du geschlafen hast. Zumindest habe ich gedacht, du würdest da schlafen. Bis ich meinen Rundgang gemacht habe und feststellen musste, dass dein Bett leer war. Es freut mich, dass du aufgewacht bist, aber ich glaube, du solltest dich wieder hinlegen. Du holst dir hier draußen den Tod. Das ist meine Meinung als Arzt.«
Pan beobachtete einen schwarzen Punkt, der durch die Luft wirbelte, auf dem Wind dahinglitt. Er war so weit weg, dass Pan nicht erkennen konnte, was für ein Vogel es war.
»Was ist das hier?«, fragte sie.
»Das alles? Was du da unten siehst? Das ist die Akademie.«
Pan nahm seine Worte zur Kenntnis, aber sie ergaben keinen Sinn. Sie nickte und zog den Mantel dichter um sich. Der Mann trat direkt vor sie und sah ihr in die Augen.
»Weißt du noch, wie du heißt?«, fragte er.
»Pandora. Pandora Stone.«
»Sehr gut.« Er lächelte. »Manchmal bleiben bei unseren Patienten Gedächtnislücken zurück. Ich bin froh, dass du dich daran erinnerst.«
Pan schwieg.
»Pandora«, fuhr der Mann fort. »Ein klassischer Name. Pandora brachte das Unglück in die Welt.« Er schmunzelte. »Ich hoffe nur, dass du nicht viel Unglück in diese Welt hier bringst. Darf ich dich einfach Pan nennen?«
»Okay«, sagte sie. Der schwarze Punkt am Himmel war verschwunden. Pan versuchte, weitere Vögel zu entdecken, aber es gelang ihr nicht. Kälte drang unter den Mantel und sie zog ihn noch enger um sich.
»Was ist mit mir passiert?«, fragte sie.
Der Mann nahm ihre Hand und Pan betrachtete sein Gesicht. Es war von Falten durchfurcht, um seine Augen herum und über der Stirn. Ein Gesicht, das zum Lachen gemacht ist, dachte Pan. Er war klein und dick und trug eine halbrunde Brille auf der Nase. Seine Wangen waren rund und rosig, und er hatte sich einen Scheitel gezogen – ein misslungener Versuch, eine breite, kahle Stelle zu verbergen. Als er den Mund öffnete, erspähte sie gelbliche Zähne. Er schob seine Finger über ihr Handgelenk, fühlte ihren Puls. Pan starrte auf die weiße Binde um ihren Unterarm. Ihre Hüfte schmerzte.
»Kannst du dich an das erinnern, was da draußen vorgefallen ist?«, fragte er.
Pan dachte über diese Frage nach. Bilder stürzten über sie herein und sie schloss die Augen. Sie holte rasch Luft und versuchte, die Erinnerungen abzuwehren.
»Ja, offenbar erinnerst du dich«, sagte der Mann. »Du hast eine Menge durchgemacht, Pandora Stone. Wie alle hier. Aber du hast jetzt Zeit, darüber hinwegzukommen. Wenn das überhaupt möglich ist. Vorerst brauchst du Wärme und Ruhe, meine Liebe. Komm jetzt. Komm mit.«
Pan ließ zu, dass er sie umdrehte und vom Felsabbruch wegführte. Vor ihr lag jetzt ein flaches, hell erleuchtetes Gebäude, das sich an die steile Bergwand anschmiegte. Vor dem Gebäude befand sich ein gepflasterter Platz mit Tischen und Stühlen, aber es war kein Mensch zu sehen. Unmittelbar an diesen Platz angrenzend führte eine Doppeltür ins Gebäude. Eine der Türen stand offen und bewegte sich sachte im Wind. Der Mann führte sie an den Terrassenmöbeln vorbei durch die offene Tür hindurch.
Eine Krankenstation. Sie ließ ihren Blick durch den Raum wandern. An der Rückwand gegenüber der zweiflügligen Glastür und den Fenstern rechts und links davon standen acht Betten. Alle Betten waren leer. Der Mann führte Pan zu einem Bett, das offensichtlich ihres war. Die Laken waren zerknäult, vermutlich hatte Pan sie zurückgeschlagen, als sie aufgestanden war. Sie ließ zu, dass der Mann ihr zurück ins Bett half. Sie war wirklich müde. Erschöpfung übermannte sie, als er die Decke wieder zurechtzog und das Kopfkissen aufschüttelte.
»Ich denke mir, du brauchst ein bisschen Hilfe, um wieder einzuschlafen«, sagte der Mann. Er öffnete eine Ledertasche, die neben dem Bett stand, und entnahm ihr eine kleine Schachtel. Pan sah aus dem Fenster. Von hier aus konnte sie die weiß verhüllten Berggipfel gegen den schlammfarbenen Himmel erkennen. Das Bild verschwamm, während sie noch hinsah. Ihre Augen waren zu müde, um es wieder scharfzustellen.
»Nein!« Sie setzte sich aufrecht hin, drückte den Rücken gegen das feste Kopfteil des Betts. »Gehen Sie damit weg!«
Der Mann zögerte. Er hatte gegen die Spritze geklopft, um eine Luftblase zu entfernen. Die Augen des Mädchens waren weit aufgerissen, ihre Arme, mit denen sie sich vom Bett hochdrückte, zitterten. Er warf einen Blick auf die Spritze, verbarg sie dann hinter seinem Rücken.
»Pan«, sagte er, »alles in Ordnung. Du kriegst keine Spritze, wenn du keine willst. Es ist in Ordnung. Keiner wird dich zwingen, irgendetwas zu tun. Schau, ich packe sie weg.«
Aber Pan hörte erst auf zu zittern, als er die Tasche fest geschlossen hatte. Sie sank hinunter aufs Bett und zog sich die Decke übers Gesicht. Der Mann beugte sich über sie.
»Ruh dich ein bisschen aus«, flüsterte er. »Und keine Spaziergänge mehr, ja?«
»Hoffnung«, sagte Pan.
»Hoffnung?«
Das Gesicht des Mannes verschwamm vor ihren Augen. Ihre Lider klappten nach unten. Ihre eigenen Worte schienen von weit weg zu kommen.
»Pandora brachte Unheil und das Böse in die Welt, aber sie brachte auch die Hoffnung.«
»Das stimmt«, sagte der Mann. »Ja, das stimmt.«
Aber Pan war schon eingeschlafen.
2.
Sommerregen.
Sie hielt ihr Gesicht in den Himmel, ließ sich vom Regen waschen. Sie schmeckte die Tropfen auf ihrer Zunge, spürte die Tropfen auf der Haut wie Nadelstiche. Sie schloss die Augen.
Jemand rief nach hier. Er rief ihren Namen, aber der Klang war verschwommen, undeutlich. Sie machte die Augen auf und versuchte zu erkennen, woher die Stimme kam. Ein ganzes Stück rechts von ihr stand ein Baum in der Ecke eines Parks. Er war riesig, seine Äste bildeten eine gewaltige Kuppel, durch die nur ab und zu ein Stück Himmel aufblitzte. Am Fuß des Baumes saß eine Frau auf einer großen, karierten Decke. Ein Junge kauerte neben ihr. Er war blond und spielte mit etwas in seiner Hand. Die Frau winkte Pan zu. Komm zu uns. Komm aus dem Regen, stell dich hier unter.
Der Park erstreckte sich in alle Richtungen. Das Gras unter ihren Füßen war strohig und gelb. Der Regen ließ die Blätter hüpfen. Das Mädchen hatte die Arme ausgebreitet und die Handflächen nach oben gedreht. Die nassen Kleider klebten an ihrem Körper. Sie lachte über den düsteren Himmel. Dann rannte sie zum Baum hinüber, schüttelte ihre nassen Haare trocken wie ein Hund. Sie ließ sich auf die Decke sinken. Die Frau sah verärgert auf, aber der Ärger saß nicht tief.
»Wage es ja nicht, mich nass zu spritzen. Halt Abstand.«
Der Junge sah zu ihr auf. Er schmollte, aber da war auch ein kleines Lächeln. Seine Miene war seltsam zweideutig – halb verärgert, halb spitzbübisch.
»Das ist unfair«, jammerte er. »Ich wollte durch den Regen rennen, aber sie hat es mir nicht erlaubt.«
»Wer ist sie?«, fragte die Frau. »Die Katzenmutter?«
Jetzt musste der Junge erst recht grinsen, aber er wehrte sich dagegen.
»Ich habe Hunger«, sagte sie.
»Du hast immer Hunger«, antwortete die Frau.
Und dann, auf diese seltsame, wenig überraschende Weise wie stets in Träumen, sah sie sich selbst von außen. Sie sah ein Mädchen, schmal wie ein Windhund, mit unscheinbarem Gesicht. Sie sah ihre Haare, braun mit ein paar natürlichen blonden Strähnen, die nass an ihren dünnen, knochigen Schultern klebten.
Alles war vollkommen vertraut und gleichzeitig vollkommen fremd. Sie rückte weiter von der kleinen Gruppe ab, die im Sommerregen saß und picknickte. Sie schrumpften zu kleinen Punkten in der Landschaft zusammen und verschwanden nach und nach, bis nichts blieb.
Sie spürte, dass sie ganz nah an etwas dran war. Namen zupften an ihrem Bewusstsein. Doch je mehr sie sich konzentrierte, desto mehr entglitten sie ihr. Die Erkenntnis lag zum Verzweifeln nah. Sie schmeckte sie wie einen Wassertropfen auf der Zungenspitze. Sie hob ihr Gesicht zum weinenden Himmel, schloss die Augen und streckte die Zunge heraus, die in der Wärme der Sonne schnell trocknete. Sie rannte im blendenden Sonnenschein eine Straße hinunter. Ihr Schatten folgte ihr, eine schräge schwarze Fläche, die neben ihr dahinhuschte. Als sie aufsah, stand da ein Polizist. Er trug einen Schnurrbart. Als er lächelte, blitzte ein Goldzahn auf.
»Das wollte ich schon immer mal sagen«, erklärte der Polizist. Lachend ließ er eine Hand auf ihre Schulter fallen.
Mit einem schmerzhaften Ruck schreckte sie aus dem Schlaf. Ihr Herzschlag hämmerte laut in ihren Ohren.
Keuchend sah sich Pan im Raum um. Die Betten, die an der Wand standen, die Flügeltüren, die Terrassenmöbel, die schneebedeckten Gipfel. Ihr Name war Pandora Stone. Sie erinnerte sich daran, dass sie an einer Steilkante gestanden hatte. Die Akademie. Ein Mann mit einem lachenden Gesicht. Da waren auch andere Erinnerungen, ältere Erinnerungen. Eine Explosion aus Blut, der Flügel eines Flugzeugs, der ein Gebäude streifte, eine Lehrerin, die im Klassenzimmer zusammengebrochen war. Es hätten Bilder aus einem Film sein können, aber sie waren grob aneinandergeklebt ohne Rücksicht auf eine Handlung. Irgendwo verbarg sich eine Geschichte, aber sie war nur bruchstückhaft zu erkennen, blieb konfus.
Sie schob ihre Bettdecken zur Seite und stand auf. Einen Moment lang fürchtete sie, ohnmächtig zu werden. Sie hatte so weiche Knie. Aber dann richtete sie sich auf. Ein Morgenmantel lag am Fußende ihres Bettes. Sie schlüpfte hinein und verknotete den Gürtel. Abgesehen von den Glastüren, die nach draußen führten, gab es nur einen Ausgang, eine Tür links von ihr. Pan ging darauf zu und ihre Beine fühlten sich zunehmend kräftiger an. Als sie die Tür durchschritt, war alle Schwäche aus ihrem Kopf gewichen.
Sie trat in einen kurzen Flur mit sauberen Bodenkacheln. Die Wände waren hellrosa gestrichen. Sie nahm einen Geruch wahr, den sie kannte. Desinfektionsmittel mit seinem künstlichem Tannennadelaroma und darunter der Geruch von Krankheit. Nach Luft, die tausendmal in keuchende Lungen eingesogen, ausgestoßen und wiederaufbereitet worden war. Dieser seltsame Krankenhausgeruch, in dem sich Zerfall und sterile Reinheit mischten. Nirgendwo wies ein Schild in eine bestimmte Richtung, aber Pan wandte den Blick nach links und entdeckte nicht mehr als fünf oder sechs Meter weiter eine Schwesternstation. Hinter dem Tresen saß eine Frau in einer hellblauen Uniform. Sie notierte etwas in einer Akte. Als Pan auf sie zutrat, sah sie auf.
»Na hallo«, sagte sie. »Unser Dornröschen ist aufgewacht. Wie fühlst du dich, Kind?«
»Ich brauche Antworten«, sagte Pan.
»Du brauchst Ruhe, Schätzchen. Die brauchst du. Bevor die Akademie dich aufnimmt. Dann wirst du dich nicht mehr ausruhen können. Glaub mir. Wie wäre es, wenn ich dich wieder ins Bett bringe, damit du dich beruhigst? Später bleibt immer noch Zeit für Fragen und Antworten.«
»Nein«, beharrte Pan. »Jetzt. Ich brauche die Antworten jetzt.«
Das Lächeln der Schwester erstarrte einen Moment lang, aber sie erholte sich rasch.
»Ich rufe Dr. Morgan an«, sagte sie. »Setz dich, Pandora, bevor du noch umfällst. Du bist sehr krank gewesen, weißt du, und es dauert eine Weile, bis dein Körper sich erholt hat. Du solltest dich nicht gleich überanstrengen.«
Pan lehnte sich auf die Theke, sagte aber nichts mehr. Die Stuhlreihe zu ihrer Linken beachtete sie nicht.
Die Schwester runzelte die Stirn, nahm ihr Telefon und gab eine Nummer ein. Die Finger ihrer rechten Hand trommelten einen Rhythmus auf der Theke.
»Dr. Morgan? Clare hier. Unsere Patientin Pandora steht hier an der Rezeption … Ja, es geht ihr offenbar gut. Sie scheint aber ein wenig aufgeregt … Sie möchte dringend mit jemandem reden … Genau … Gut. Ich richte es ihr aus. Okay. Dankeschön, Dr. Morgan.«
Sie legte auf.
»Dr. Morgan wird gleich hier sein, Pandora. Aber jetzt setz dich bitte hin.«
Die Schwester erhob sich, marschierte um die Theke herum und nahm Pans Arm. Pan ließ sich zu einem Stuhl führen. Das Schwindelgefühl war zurückgekehrt und mit ihm die Kraftlosigkeit.
»Möchtest du etwas trinken?«
Erst in dem Moment, in dem ihr die Frage gestellt wurde, bemerkte Pan, wie durstig sie war. Ihr Mund fühlte sich dick und belegt an. Als sie schluckte, schmerzte ihre Kehle.
»Wasser, bitte«, sagte sie.
Die Schwester lächelte. »Ich hole dir welches. Bin gleich wieder da.«
So allein an der Rezeption zurückgelassen, verspürte Pan einen beinahe unwiderstehlichen Drang, hinter die Theke zu schleichen und nachzusehen, was in dieser Akte stand, sich die zu einem Bündel verschnürten Tabellen und Ordner anzusehen. Aber da war dieser Schmerz, ein Druckgefühl hinter ihren Augen, und sie war einfach zu müde. Eine Minute später kehrte die Krankenschwester mit einem Wasserglas und einer Karaffe zurück.
»Hier, Pandora.« Sie reichte Pan das Glas. »Du bist wahrscheinlich dehydriert. Wir haben versucht, dir intravenös so viel Wasser wie möglich zuzuführen, aber du warst sehr lange bewusstlos. Trink so viel du kannst, meine Liebe. Aber nicht alles auf einmal. Nippe dran. Kleine Mengen. Leider haben wir kein Eis.«
Pan, die gerade das Glas an den Mund hob, erstarrte: »Wie lange war ich denn bewusstlos?«
Die Krankenschwester machte ein verlegenes Gesicht. Sie stellte die Karaffe auf den Tisch neben den Stühlen und ging wieder an ihren Platz hinter der Theke zurück. »Du bist sehr krank gewesen«, sage sie. »Auf jeden Fall wird der Arzt jeden Moment hier sein und ich bin mir sicher, dass er dann alle deine Fragen beantwortet. Aber jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss wieder an die Arbeit.«
Pan widerstand der Versuchung, auf Antworten zu drängen. Stattdessen nahm sie einen großen Schluck Wasser. Es schmeckte wunderbar. Ein bisschen warm, aber sauber und rein.
Hinter der Schwesternstation ging eine Tür auf und der Mann, den sie am Vortag getroffen hatte – war es am Tag zuvor gewesen? –, betrat den Empfangsbereich. Hinter ihm erschien eine Frau mit leuchtend roten Haaren, die sie sich aus dem Gesicht gekämmt und zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst hatte. Beide trugen Arztkittel. Beide lächelten.
»Pandora!«, sagte der Mann. »Du siehst erstaunlich gut aus. Ich bin Dr. Morgan – dein Arzt. Und das ist meine Kollegin, Dr. Macredie, unsere Psychologin und Beratungslehrerin hier in der Akademie.«
Die Frau streckte lächelnd die Hand aus. Pan schüttelte sie automatisch.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: