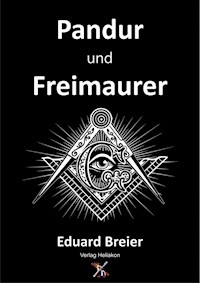
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er blickte spähend umher, zog den Edelherrn rasch an sich, sodass dessen Ohr an seine Lippen zu ruhen kam, und lispelte ihm einige Worte zu. Herr von Werhotitz stieß einen Schrei des Entsetzens aus, taumelte mehrere Schritte nach rückwärts und sank sinnverwirrt in einen Armstuhl.« In diesem Moment gelangte Roswitha zum Bewusstsein schlug wie aus einem schweren Traume erwachend die Augen aus und rief mit leiser Stimme: »Vater, mein Vater!« Der Ruf seines geliebten Kindes erweckte den Greis aus der Betäubung, sein Auge suchte den Fremden, aber er war fort; was er zurückließ, war die zu neuem Leben erwachte Jungfrau und das Papier, auf dem die Worte standen: »Emanuel von Swedenborg.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 775
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pandur und Freimaurer
Historischer Roman
Eduard Breier
Verlag Heliakon
Bild Cover: Pixabay
Umschlaggestaltung: Verlag Heliakon
Vertrib: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
2018 © Verlag Heliakon, München
www.verlag-heliakon.de
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Erster Teil
Das Wunder im Herrnhof zum Frainspitz
Fortsetzung der Szene im Herrnhof zu Frainspit
Ein Wiener, der in Brünn auf Werbung ausgeht
Eine Bekanntschaft auf der Straße
Eine Unterhaltung im Wagen
Der Leser lernt den Baron Trenk kennen
Die weiße Rose
Im Komödienhaus am Kärntnertor
Was sich im Komödienhaus weiter begab
Der Leser lernt Swedenborg etwas näher kennen
Eine Verhandlung unter vier Augen und sechs Ohren
Eine alte Geschichte, die ewig neu bleibt
Gelegenheit macht nicht nur Diebe, sondern auch Liebeserklärungen
Die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft
Der Baron Trenk in der Falle
Im oberen Gut
Guido und Roswitha
Zweiter Teil
Oh, mein lieber Augustin, das Geld ist hin, alles ist hin!
Bei Itzig Wolf auf der Brandstätte
Die Gräfin Fuchs und der Herr Hofrat von Managetta
Das Fräulein von Schwerin als Zeuge
In welchem der schlauche Herr Rudolf beim Seiltänzer auf der Freiung eine schwache stunde hat
Der Besuch im Stockhaus
Zerstörtes Glück
Herr von Managetta greift zu einem außergewöhnlichen Mittel, um dem Diebe der Brillantrose auf die, spur zu kommen
Noch ein Besuch bei Swedenborg
Die Loge zum ewigen Feuer
Ein guter Rath, welcher viel Held wert ist, aber auch viel Held kostet
Die Sentenz der Keuschheitskommission
Das Fräulein von Schwerin marschiert in die Position
Wie es dem Fräulein von Schwerin beim ersten Angriff ergeht
Auf dem Neumarkt
Ein Vormittag der Kaiserin
Baron Trenk in floribus
Dritter Teil
Wie der Schimmel Michel einem Auftrag des Herrn Hofrat von Managetta nachkommt
Der Schimmel Michel in der Studentenherberge
Der Taucher
Bei dem Fräulein von Schwerin fängt das Blatt sich zu wenden an
Der Prozess des Baron Trenk
Das Fräulein von Schwerin vor der Revisionskommission
Weiterer Verlauf des Trenkschen Revisionsprozesses
Im Krankensaal bei den Elisabethinerinnen
Nachwirkungen
In welchem der Präfekt und der Polizeidirektor sich verschwören
In welchem der Präfekt der Hofbibliothek und der Polizeidirektor die Frucht ihrer Verschwörung ernten
Sätze und Lehren des Mystikers
Der arme Student
Bei der Gräfin Fuchs
Der Prozess des Obristen Baron Trenk geht zu Ende
Vierter Teil
Eine Allianz zu Schutz und zu Trutz
Baron Trenk auf dem Spielberg
In welchem der Leser erfährt, wie der schlaue Herr Rudolf, von seiner Gattin unterstützt, bisher manövriert hat
Eine Begegnung, welche Ludmilla Gelegenheit verschafft, ihr Talent abermals glänzen zu lassen
Vorbereitungen
In welchem der Trenk vom Spielberg entflieht
Wirkungen der misslungenen Flucht unterhalb des Spielbergs
Im Herrenhof zu Frainspitz
Baron Trenk wird wieder überrascht
Baron Trenk fasst einen Entschluss
Ludmilla liefert einen Beleg, dass manchmal auch die besten Schwimmer ertrinken
Baron Tranke macht sein Testament
In welchem Rudolf sich wieder — jedoch mit einem glücklicheren Erfolg — rächt
Die große Tragikomödie des Baron Trenk auf dem Spielberg
Erste Abteilung – Der Pandur und sein Beichtvater
Zweite Abteilung – Das Wunder des Baron Trenk
In welchem der Autor noch eine kurze Umschau hält und den Roman schließt
Erster Teil
Das Wunder im Herrnhof zum Frainspitz
Im Herrnhof zu Frainspitz — dem letzten links an der Straße gelegenen Orte, wenn man von Znaim nach Brünn reist — herrschte große Trauer.
Eines der Gemächer, wo noch kürzlich Anmut und Lieblichkeit heimisch waren, wo Jugend und Tugend in einem Wesen vereint, schalteten und walteten, dieses Gemach — einen Tempel hätte man es nennen dürfen — war in eine düstere Totenkapelle umgewandelt und statt wie früher mit dem Odem des Lebens wurde es jetzt mit dem Dunstqualm zahlreicher Wachskerzen geschwängert, die ein Totengerüst umstanden und umschwebten.
Der Tod ist nichts als der Eintritt in ein besseres Leben, warum also umgeht Ihr ihn mit Schauern, warum bekleidet Ihr Wände und Decken mit schwarzem Tuch, warum umhängt Ihr Euch mit Blumen, warum jammert und klagt Ihr?
Warum betrauert Ihr den, der es überstanden hat, warum nicht lieber Euch, die Ihr es noch überstehen müsst?
Dort auf dem Gerüst ruht eine Jungfrau.
Wenn je die Seele eines Weibes mit himmlischen Formen umkleidet war, so war es die ihre; blicket sie an und Ihr werdet jetzt noch, wo sie aufgebahrt liegt, beben vor Wonne ob der Vollendung solchen Liebreizes und solcher Herrlichkeit.
Weiße Schleier umhauchen ätherisch den starren Leib, außer dem Antlitz sind nur die kleinen Marmorhände, ein Kruzifix haltend, sichtbar.
Aber welch ein Antlitz ist dies!
Selbst im Tod ist es noch lieblich; die Lippen lächeln, die Stirne ist glatt; das Auge sanft zugeweht; sie ist nicht eine unter dem Frosthauche einer Nacht entblätterte Rose, sondern eine Knospe, die nächtlicher Weile sich schützend schließt, um am Morgen um so schöner sich zu öffnen.
Lichtblondes Haar umwallt seidenweich das, wie im sanften Schlummer eingewiegte Wesen, der Totenkranz schmiegt sich traulich an die Stirne.
So jung und schon tot!
An das Alter braucht der Sterbeengel nur sachte seine Hand zu legen, die reife Frucht fällt ab, die Seele löst sich ohne Kampf vom Körper und das Leben entgleitet ungehört, fast unbemerkt dahin; man will es kaum glauben, bis man sich überzeugt, dass der Greis keinen Atem mehr hat, um einen Kristall zu trüben.
Bei der Jugend aber da muss der Tod unbarmherzig seine ganze Kraft geltend machen, hier kämpft das Leben mit Energie um seine Existenz, jedes Glied, jede Muskel wehrt sich des Daseins, die Brust keucht, die Nerven zucken, das Herz wogt und wellt, die zugeschnürte Kehle röchelt, und die kalten Tropfen, welche Stirne und Wangen bedecken, sie sind nicht kalter Schweiß, wie die Menschen behaupten, sondern sie sind die Tränen, die der Körper der scheidenden Seile nachweint. Und weil in solchen Augenblicken das Leben vom Herzen bereits entschwunden ist, so sind auch diese Tränen ohne Leben, sie sind kalt.
Wenn Ihr aber die aufgebahrte Jungfrau anblickt, so gewahrt Ihr im Äußeren nicht jene Merkmale, zeugend von einem Kampf zwischen dem Leben und dem Tode; ja noch mehr. Ihr vermisst sogar die Verwüstungen tödlicher Krankheiten, die sonst dem Leben die Kraft rauben, seinem Feinde widerstehen zu können; Ihr habt eine Leiche vor Euch, bei der sich der schreckliche Spruch erfüllt zu haben scheint: »Heute rot, morgen tot!«
… Und zu Füßen des Katafalks kniet betend ein stattlicher Greis, aus seinem Haupt lastet der Jahre Schnee, in seinem Herzen nagt der Wurm des Schmerzes.
Je leidenschaftsloser aber die Brust ist, je ruhiger das Blut wallt, desto verheerender ist die Wirkung solch nagenden Grams; im alten Schrank bohrt sich der Holzwurm ohne Mühe ein, nur am frischen Baum, wo noch Säfte kreisen, versucht er seine Kraft vergebens.
Der Betende — Casimir von Werhotitz ist sein Name — kniet an der Leiche seines einzigen Kindes.
Wollt Ihr die volle Größe seines Schmerzes begreifen, so müsst Ihr vernehmen, dass der Greis außer diesem Kind auf der ganzen Erde keine verwandte Seele besaß; so bald man dieses Kind in die stille Gruft versenkt, stand er allein da, allein mit seinem Alter, mit seinem Gram.
Was nützte ihm nun sein Reichtum, was sein Ansehen? Wer teilte dieses mit ihm, wem konnte er jenen vererben?
Warum gefiel es dem Himmel, ihn an seinem Liebsten zu strafen? Womit hatte er es verschuldet?
Aber nicht nur der Vater trauerte um die Jungfrau und betete für sie, auch die Bewohner des Ortes und die Bekannten des Herrn von Werhotitz wallten herbei, um ihre Teilnahme und ihren Kummer an den Tag zu legen, und so kam es, dass das Totengemach des Nachmittags hindurch selten leer war, und die Stimme des Kapuziners, der eigens aus Brünn herausgeholt wurde, an der Leiche zu beten, fand immer einen Widerhall bei einem oder dem anderen der Anwesenden.
Der Vater zu Füßen des Katafalks kniend, der Mönch seitwärts an einem schwarz tapezierten Betstuhl, die Andächtigen unsern der Tür haltend und laut die Gebete des Paters nachsprechend, das ist die Szene, die wir antreffen. —
Die ganze? Nein!
Unter den Bett ragt ein bejahrter Mann hervor, ausgezeichnet durch die Stattlichkeit seiner äußeren Erscheinung, so wie durch die Fremdartigkeit seines Wesens.
Schnitt und Form seiner Reisegewänder gehörten der französischen Mode an, was jedoch die Stoffe und deren Farben betraf, so schienen sie mehr dem Norden zu entstammen.
Ein blauer Rock, kurzes schwarzsamtenes Schnallenbeinkleid, ein dreispitziges Hütlein, weiße, jedoch auf der Reise etwas zerknitterte Manschetten und Jabots, ein nett gearbeiteter Stahldegen, endlich eine Allongeperücke, bildeten die Hülle des Fremden.
Sein markiges, kraftvolles Äußere ließ auf ein Alter von kaum vierzig Jahren schließen, wenn sein bereits gefaltetes Antlitz dem nicht widerspräche und einen Sechziger kennzeichnete.
Die Physiognomie des Fremden ist ausdrucksvoll, sein dunkles Auge schaut frei und offen umher, die schön gewölbte Stirne verrät den Denker, der Lippenschnitt lässt ein stetiges Lächeln schauen und das hübsch geformte Kinn mit dem Grübchen verleiht dem Ganzen eine fast weibliche Grazie.
Das Auge des Fremden ist seit seinem Eintritt unverwandt auf das Antlitz der Leiche gerichtet, er hat für den Schmerz des greifen Vaters keinen Blick und für das Gebet des Mönchs kein Ohr — die feurigen Strahlen seiner Pupille schießen wie spitze Pfeile ihrem Ziele zu und bohren sich dort langsam aber stetig immer tiefer ein.
Und wer den Fremden in diesem Momente beobachtete, hätte bemerkt, wie seine Augäpfel sich immer mehr erweiterten, wie das Feuer seines Blickes sich immer intensiver gestaltete, wie die Stirne sich in tiefere Falten legte, kurz, wie aus seinem Antlitze die Überraschung sich verzeichnete, die eine unvermutete Wahrnehmung jederzeit hervorbringt.
Nur ein kurzes Besinnen folgte diesen sichtbaren Symptomen, dann trat er leisen Schrittes hervor, näherte sich dem Herrn von Werhotitz und tippte ihn leise auf die Schulter.
Der Greis hielt ein im Gebet und wendete den Kopf nach dem Fremden.
»Mit Verlaub, edler Herr«, lispelte dieser ihm zu, »dass ich Sie in ihrer Andacht störe, ich wünschte, ein paar Wörtchen mit ihnen zu sprechen.«
Der Greis erhob sich und trat, dem Fremden höflich den Vortritt lassend in ein Nebengemach.
»Nur wenige Worte, mein Herr«, begann dieser mit einer Flüchtigkeit, die seine Eile beurkundete, »was mich zu dieser Zwiesprache veranlasst, ist bei Gott nicht Neugierde, sondern der Drang, vielleicht ein entsetzliches Unglück zu verhüten. Ich befinde mich auf der Reise nach Wien. Im hiesigen Gasthaus abgestiegen, hörte ich von dem Tod ihres Kindes sprechen, der von einem seltenen Umstande begleitet gewesen sein soll. Das erregte meine Wissbegierde, ich begab mich hieher und was ich so eben sah, erregt meine Verwunderung noch mehr. Ich bin ein Gelehrter, mein Herr, ich habe in meinem Leben der Leichen schon viele gesehen, jedoch eine wie diese sah ich noch nicht. Was fehlte dem Fräulein? Wie lange lag es darnieder?«
»Mein armes Kind«, seufzte der unglückliche Vater, »vorgestern am Abend saß sie frisch und wohlauf an meiner Seite; wohl hatte seit einiger Zeit ein unbekannter Kummer den reinen Spiegel ihrer Seele in etwas getrübt, allein ich achtete nicht darauf und freute mich ihrer Liebe wie sonst. Ahnungslos ging ich zu Bett, doch gestern am Morgen war ich aufs Höchste erstaunt, das Mädchen nicht wie alltäglich im großen Gemache anzutreffen, ich wartete, Roswitha kam noch immer nicht, endlich wurde mir bange, ich ging zu ihr und fand sie tot im Bett. Mein Wagen wurde schleunigst nach der Stadt gesandt, um von dort ein paar Doktoren zu holen, sie kamen jedoch nur, um mir mein Unglück, ihr Ableben, zu bestätigen. Der Tod war kein gewalttätiger, der Engel schlief in dieser Welt ein, um in der anderen zu erwachen. Woran mein Kind starb? Darüber wussten mir die Doktoren keine Auskunft zu geben. Das, mein Herr, ist alles, was ich weiß.«
Der Fremde hörte diese Mitteilung aufmerksam an, schüttelte den Kopf und murmelte: »Sonderbar, höchst sonderbar!«
Dann, als hätte er eben einen Entschluss gefasst, sagte er:
»Mein Herr, wollen Sie mir gestatten, mit der Leiche ihres Kindes fünfzehn Minuten allein zu sein?«
Herr von Werhotitz blickte jetzt den Fremden zum ersten Mal aufmerksam an, misstrauen beschlich seine Seele und er fragte dann:
»Zu welchem Zwecke wünschen Sie dies?«
»Forschen Sie nicht«, lautete die entschiedene Antwort, »ich muss ihnen, um ihrer selbst willen, den Zweck verheimlichen; gewähren Sie mir den Wunsch, und vergessen Sie nicht, dass ich vorhin sagte, es gelte ein entsetzliches Unglück, zu verhindern.«
Herr Casimir begriff das sonderbare Verlangen nicht und blieb unentschlossen eine Antwort schuldig.
Der Fremde fuhr dringend fort:
»Wir zählen heute den sechzehnten Tag des Weinmonats im Jahre des Herrn 1746, fügen Sie sich meinem Begehren, Herr von Werhotitz, und dieser Tag wird vielleicht der merkwürdigste ihres ganzen Lebens werden.«
»Sie wünschen also …«
»Mit der Leiche Ihres Kindes durch fünfzehn Minuten allein zu sein!«
Der Edelherr fing an sich mit dem Gedanken, dem Fremden den Wunsch zu gewähren, zu befreunden, denn schon erwachten Bedenken gegen die Hindernisse, die ihm in diesem Fall entgegen standen.
»Sie wollen mit der Leiche allein sein«, sagte er; »was die Leute aus dem Ort betrifft, so brauche ich nur den Hof abzuschließen, um ihnen den Eintritt zu verwehren, allein der Kapuziner?«
»Der Pater«, erwiderte der Fremde, »mag bleiben, wo er ist, seine Anwesenheit fällt mir nicht lästig, beseitigen Sie nur die Übrigen, und befehlen Sie, den Eingang des Herrnhofes zu bewachen.«
Der Greis versprach, die Anordnungen zu besorgen.
Man kehrte wieder in das Totengemach zurück.
Der Edelherr benützte die erste Pause, wo keiner der Ortsbewohner anwesend war, sich unbemerkt aus dem Trauergemach zu entfernen und die Tür leise hinter sich abzuschließen.
Der Fremde und der Mönch waren jetzt allein mit der Leiche.
Ersterer stand eine Minute lang wie im stillen Gebet versunken da, dann gleichsam um eine religiöse Pflicht ganz zu erfüllen, näherte er sich dem Weihbrunnen, tauchte den Weihwedel in denselben, zog ihn heraus und goss unbemerkt den Inhalt einer kleinen Phiole darauf, dann aber, statt, wie die fromme Sitte es erheischt, die Leiche zu besprengen, spritzte er die an dem Wedel haftende Flüssigkeit gegen den Betstuhl.
Der Priester, bevor er noch Zeit gewann, sich über diese Störung seiner Andacht zu entrüsten, fühlte, wie seine Sinne sich umflorten, seine Lippen verstummten, er suchte sich aufzuraffen, blieb aber an dem Bettstuhl wie kleben und ohne seine Stellung zu verändern ließ er lautlos das Haupt wie ein Schlafender auf das Pult sinken.
»Jetzt erst«, murmelte der Fremde, »bin, ich allein mit ihr!«
Fortsetzung der Szene im Herrnhof zu Frainspit
Der Fremde näherte sich rasch der Leiche der Jungfrau und begann so wie früher seinen Blick auf sie zu richten.
Die Stille im Gemache wäre eine vollständige gewesen, hätte das regelmäßige Atmen des schlafbefangenen Mönchs dies gestattet; daran kehrte sich jedoch der Fremde nicht, sein Auge war zu beschäftigt, alle Geister seines Lebens vereinigten sich in seinen Pupillen, sodass die übrigen Sinne wie abgestorben ruhten.
Er stand ganz nahe bei der Leiche, der über den Sarg herabwallende Schleier berührte seinen Körper, sein Augenstrahl fiel fast senkrecht auf das Antlitz der Toten.
Nah an fünf Minuten verharrte er mit eiserner Ausdauer in dieser anstrengenden, ermüdenden Lage, dann aber neigte er sich, sodass sein Antlitz sich jenem der Toten näherte.
So beugt sich eine liebende Mutter zu ihrem kranken Kinde herab, um dessen leise gelispelten Wünschen zu horchen.
Hierauf begann er zu sprechen mit lauter, wohlklingender Stimme.
Schauer hätten denjenigen durchrieselt, der diese trauliche Ansprache des Mannes, an eine fremde Leiche gerichtet, mit anhörte.
Er sagte: »Roswitha, armes Kind, höre mich! Ich will, dass du mich vernehmest, darum höre, höre! — Du bist von den Bandes eines Todes umfangen, der nicht der wahre, der wirkliche Tod ist. Er hat dich deines tierischen Willens beraubt, hat deine Glieder in Banden geschmiedet und dein Blut erkalten und erstarren lassen. Du bist tot und lebst trotzdem, weil dieser falsche Tod über deinen Geist keine Macht hat. Dein Auge ist geschlossen und du siehst. Deine Glieder sind starr, aber du hörst, du weißt genau, was um dich vorgeht.
»Armes Kind! Du hörtest jeden Klagelaut deines Vaters an deiner Leiche und dir fehlte die Kraft zu sprechen, zu seufzen, zu atmen. Du fühltest, wie man dich mit Leichengewändern umkleidete, und warst unfähig, dich zu wehren; du konntest es nicht verhindern, dass man dich hier aufsargt, hörtest die Gebete um dein Seelenheil, siehst noch jetzt mit deinem geistigen Auge die Wachskerzen flammen und musst alles, alles geschehen lassen, trotzdem, dass das Gefühl des Lebens und das Bewusstsein desselben dich beseelt.
»Roswitha, höre mich, höre mich weiter. Was du bis jetzt weißt, ist noch wenig, die Pein, die du bis jetzt erduldet hast, ist noch gering gegen jene, welche dir bevorsteht. Man wird deine vermeintliche Leiche zu Grabe tragen, du wirst hören, wie man den Sarg über dich schließen wird, das Trauergeläute, der düster bange Ton der Leichenmusik werden in dein Ohr dringen, das Bewusstsein: »Dies alles gilt mir!« Wird dich durchfluten, deine Seele wird sich entsetzen vor den Qualen, welche sie voraussieht und sie wird sich nicht zeitig genug der Fesseln entwinden können.
»Man würde dich in das Grab versenken, man würde Erde auf den Sarg schütten und du wärst lebendig begraben — darum höre mich, Roswitha, höre mich.«
»Ich will deiner gefesselten Seele zu Hilfe kommen, unterstütze mich durch deinen Willen, ich will dich erwecken vom Tod, damit du jetzt schon erwachest und nicht erst dann, wenn Sarg und Grab bereits geschlossen sein werden, denn dann wäre es zu spät, zu spät.«
Und nachdem der Fremde diese Worte gesprochen, wobei die Strahlen seines Auges unausgesetzt auf das Antlitz der Toten fielen, öffnete er weit seinen Mund und hauchte ihr dreimal seinen Odem zu, hierauf umkränzte er ihr Gesicht mit seinen zehn Fingerspitzen und leitete dem erstarrten Wesen einen Strom jener geheimnisvollen Materie zu, die allbelebend und allwirkend sogar auf wirkliche Leichen einen gewissen Einfluss üben.
Und siehe da, schon nach wenigen Minuten des beharrlichsten Willens und der innigsten Überzeugung, dass sein Werk gelingen werde, fühlte er die feine Wangenhaut sich sanft erwärmen; durch eine unglaubliche Anstrengung seinen Willen und seine Lebensgeister sammelnd, führte er rasch der Jungfrau einen verstärkten Strom der Materie zu und gewahrte gleich, wie die Wärme sich steigerte und die Erstarrung zu weichen anfing.
So löst sich die Eisdecke des Stromes unter dem warmen Hauche des Windes, unter der Strömung des belebenden Sonnenstrahls.
Ohne die geheimnisvolle Lebensleitung zu lösen, neigte er sein Ohr an das Herz der Jungfrau, horchte emsig, bis er den ersten leisen Schlag desselben vernahm und als dies eintrat, erhob er rasch das Haupt und verdreifachte den Strom durch Blick, Hauch und Berührung.
Nun fühlte er das Steigen der natürlichen Wärme, er gewahrte das Zucken der Muskeln, die Augenwimpern vibrierten so rasch, wie der Schmetterling, der eben gefangen wurde, mit den Flügeln schlägt.
»Es ist vollendet«, murmelte der Fremde in freudiger Erregung und eilte rasch zur Tür, um den Edelherrn von dem freudigsten Ergebnisse in Kenntnis zu setzen.
Herr Casimir, vor Freude fast außer sich, schloss den Fremden stürmisch in seine Arme.
Dieser wehrte die Freundschaftsbezeigung sanft ab und sagte: »Lassen Sie Ihr Kind eiligst aus der Totenstube entfernen, damit die Einwirkung der frischen Luft ihr Erwachen beschleunige und damit der Anblick dieser Trauerstätte ihre Seele nicht verwirre.«
Roswitha wurde hieran in das anstoßende Gemach zu Bett gebracht und der Leichenschmuck beseitigt.
Der Fremde blieb beobachtend an ihrem Lager, der Vater, zitternd vor Freude, ihm zur Seite.
»Ihr Kind wird zu neuem Leben erwachen«, lispelte der Retter, »doch verhüten Sie, dass Sie vor ihrer vollkommenen Genesung ja nicht erfahre, was mit ihr vorging, eine jede heftige Gemütsbewegung würde Sie nur noch mehr abschwächen.«
Ein Geräusch in dem früheren Leichengemach zog die Aufmerksamkeit der beiden Herren auf sich.
»Es ist der Pater, der aus seinem Schlaf erwacht«, sagte der Fremde, »entfernen Sie ihn freundlicherweise und sagen Sie ihm, ihr Kind sei während seines Schlafes wieder zum Leben gekommen, denn was die Ärzte für Tod gehalten, sei nur ein Starkrampf gewesen.«
Der Edelherr tat nun wohl, was der Fremde wünschte, allein dem Kapuziner wollte das Gesagte nicht recht einleuchten, er entsann sich des Fremden und der rätselhaften Betäubung, die ihn nach der Besprengung mit Weihwasser befiel; da indessen der Edelherr zu den Freunden seines Klosters gehörte, so vermied er es, seinem Zweifel Worte zu leihen und verließ gutmütig den Herrnhof.
Als Herr von Werhotitz in das Krankengemach zurückkehrte, fand er den Fremden wegfertig.
»Sie wollen sich schon entfernen?«, fragte er betroffen.
»Mein Werk ist vollbracht«, entgegnete dieser, »für mich gibt es hier nichts mehr zu vollbringen. Ihr Kind wird in wenigen Minuten zum Bewusstsein gelangen, und es ist dann die Aufgabe der Ärzte, deren Körper zu stärken und sie vollkommen genesen zu machen.«
»Und Sie, mein Herr, Sie vermöchten so schnell von hier zu scheiden, ohne den Dank meines vor einem fürchterlichen Ende bewahrten Kindes abzuwarten? Ohne den Dank eines Vaters anzunehmen, dem Sie das einzige Kleinod seines Lebens wieder gegeben haben?«
Der Fremde versetzte:
»Ich habe kein Recht, einen Dank entgegen zu nehmen, der nicht mir gebührt, sondern Dem, der mir die Kraft verlieh, solche Wunder zu üben, und Der mein Auge mit der Macht ausstattete, in die Zukunft zu schauen und das heute schon zu wissen, was die Zeit nach Monaten erst erzeugen wird. Um Sie nicht enttäuschen zu müssen, wenn mein Werk misslungen wäre, verschwieg ich ihnen vorhin, was ich seitdem vollbrachte; jetzt, da es gelungen, können Sie sich ungeschmälerter Freude überlassene.«
»Sie wollen, dass ich mich freue«, klagte der Edelherr, »und sind dabei selbst so frostig, so gemessen, dass ich ihre jetzige Stimmung eben so wenig begreife, wie ihr Geheimnis, durch welches Sie die Tote zum Leben erweckt haben.«
Der Fremde blickte den Greis teilnehmend an und sagte:
»Es ist wahr, ich kann mich dessen, was ich an ihrem Kinde getan habe, nicht von Herzen freuen; was mir die Freude verbittert, sind Wolken, die ich über dem Haupt Ihrer Tochter auftauchen sehe —«
Herr Casimir, bis zu Tod erschreckt, stierte den rätselhaften Fremden an.
»Mäßigen Sie ihre vorzeitige Angst«, fuhr dieser fort, »denn was ich ihnen verkünde, sind wohl Gefahren, in denen man untergehen kann, die aber bei gehöriger Vorsicht auch überwunden werden können, daher ich Sie im Voraus warne und darauf aufmerksam mache. Vielleicht erscheint einst der Tag, wo mir ihr Dank zustattenkommt, vielleicht auch führt das Geschick Sie in meine Nähe; für diese Fälle reiche ich ihnen dieses Papier, welches meinen Namen enthält. Mein Auge sieht schwarz, ich kann der Rettung ihrer Tochter wegen der neuen Gefahr, die ihr droht, nicht froh werden; halten Sie ihr Auge wach, damit der Tag der Not Sie gefasst und gewappnet finde. Tun Sie es aber nicht, dann, — dann —«
Er blickte spähend umher, zog den Edelherrn rasch an sich, sodass dessen Ohr an seine Lippen zu ruhen kam, und lispelte ihm einige Worte zu.
Herr von Werhotitz stieß einen Schrei des Entsetzens aus, taumelte mehrere Schritte nach rückwärts und sank sinnverwirrt in einen Armstuhl.«
In diesem Moment gelangte Roswitha zum Bewusstsein schlug wie aus einem schweren Traume erwachend die Augen aus und rief mit leiser Stimme:
»Vater, mein Vater!«
Der Ruf seines geliebten Kindes erweckte den Greis aus der Betäubung, sein Auge suchte den Fremden, aber er war fort; was er zurückließ, war die zu neuem Leben erwachte Jungfrau und das Papier, auf dem die Worte standen:
»Emanuel von Swedenborg.«
Ein Wiener, der in Brünn auf Werbung ausgeht
Zur nämlichen Zeit, wo die eben erzählten Vorfälle im Herrnhof zu Frainspitz sich abspielten, begab sich in Brünn in einem kleinen Haus nächst der damals kaum sechzehn Jahre alten Minoritenkirche folgende, dem Anschein nach sehr einfache, wegen ihrer Folgen aber bedeutungsschwere Szene.
Das erste und zugleich einzige Stockwerk jenes Haus, welches freilich nur zwei Gemächer umfasste, war von einem jungen hübschen Mädchen gemietet, welches seit einigen Monaten sich in Brünn niedergelassen hatte.
Der Name dieses Mädchens was Ludmilla Prokop.
Eine einzige bejahrte Dienerin bildete den ganzen Haushalt der Schönen, deren Alleinsein ihrer Jugend wegen auffiel; von dieser abgesehen, gab sie keine Veranlassung zu nachteiligen Bemerkungen, sondern lebte dem Anschein nach zurückgezogen und eingeschränkt, so, dass ihrem Ruf keine böse Nachrede zur Last fiel.
Ihre Wohnung war bürgerlich, aber sehr anständig eingerichtet, sie galt in den Augen ihrer Brünner Nachbarn für die Waise eines im Kriege gegen die Preußen gebliebenen Offiziers, welche jetzt von einem Gnadengehalt lebte, den ihr die Milde der Kaiserin zufließen ließ.
Die schöne Ludmilla tat nichts, um diesen Glauben Lügen zu strafen, ging vielmehr allen indirekten Forschungen klug aus dem Wege und bemühte sich, das Geheimnis ihrer Existenz aufrechtzuerhalten.
An dem Nachmittag, wo die bereits geschilderten Szenen vorstellen, befand sich Ludmilla in ihrer Wohnung, und zwar mit einer Stickerei beschäftigt, welche Arbeit sie mehr zum Zeitvertreib als des Nutzens wegen zur Hand nahm.
Betrachten wir sie genauer.
Kaum achtzehn Jahre alt, schlank, mit einem hübschen Gesichtchen, der feine weiße Teint, durch glänzendes, dunkelbraunes Haar noch mehr hervorgehoben, dabei zierlich, mit graziösen Manieren und Bewegungen, Gewänder von feinen Stoffen und nach damaligen Geschmack gefertigt, für wahr, man musste auf den Gedanken geraten, sie gehöre einem höheren als dem Bürgerstande an.
Die eintretende Dienerin unterbrach die trauliche Stille des Gemachs und meldete die Ankunft eines unbekannten Herrn, der die Mademoiselle zu sprechen wünsche.
Die dunklen Augen des Mädchens verfinsterten sich und sie heischte der Alten zu:
»Sie weiß, dass ich nie Besuche empfange, warum also diese Belästigung?«
»Ich habe dies dem fremden Herrn bedeutet«, erwiderte die Alte, allein er ließ sich trotzdem nicht abweisen, sondern sagte, »er müsse mit Ihnen sprechen, denn er sei deshalb eigens von Wien hieher gekommen.«
»Von Wien!«, rief Ludmilla mir einem Ausdruck, der leicht erkennen ließ, dass sie nun dem Wunsche des Fremden nicht länger widerstehen werde, »nun gut, er trete ein, wir wollen hören, was der Herr uns aus Wien zu erzählen hat?«
Der Eintretende war ein großer, überaus starker Mann, dessen Perrücke an den Schläfen mit zwei niedlichen Löckchen aufgeschniegelt war, die zu der vierschrötigen Figur und dem vollen, breiten Gesicht in so großem Missverhältnis standen, dass die Frisur einen höchst lächerlichen Eindruck hervorbrachte.
Er war nahe an vierzig Jahre alt und trug sich bürgerlich gekleidet.
Nichtsdestoweniger trat unser Mann mit vieler Zuversicht auf, und grüßte freundlich, blieb vor der Dame stehen und schien zu erwarten, dass sie ihn erkenne.
Da dies nun nicht der Fall war, lächelte er freundlich und fragte:
»Mademoiselle belieben sich meiner nicht mehr zu erinnern?«
Das flüchtige Erröten Ludmillas verriet, dass sie sich seiner jetzt erst entsann, sie verzog den Mund zu einem spöttischen Schnäbelchen und antwortete mit dem Tone, der einige Geringschätzung zur Schau trug:
»Sie sind es, Herr Rudolf! Ich hätte Sie beinahe nicht wieder erkannt.«
»Mademoiselle belieben zu scherzen?«
»In allem Ernste, Herr Rudolf, Sie kommen mir ganz fremd vor, ich weiß nicht, sind Sie seit der Zeit, dass ich Sie nicht sah, länger oder breiter oder beides zugleich geworden?«
»Entschuldigen Sie, Mademoiselle, keines von allen! Ich halte noch immer mein altes Grenadiermaß und was dies Dicke belangt, so wiege ich nicht ein Quäntchen mehr denn ehedem — was Ihnen jedoch an meiner Wenigkeit fremdartig vorkommen mag, ist das glatte Gesicht …«
»Richtig, richtig, Sie sind jetzt ganz glatt, während dem Sie sich beim Bataillon durch einen unbändigen zausigen Schnurrbart auszeichneten!«
»War Ihnen aber doch angenehm, wenn dieser unbändige zausige Schnurrbart, wie Sie sich auszudrücken belieben, am Gagentag zu Ihnen in die Stube trat und Ihnen von Seiner Gnade dem Herrn Hauptmann Baron Krippenda.
»Schweigen Sie«, fiel ihm Ludmilla unwirsch ins Wort, »erinnern Sie mich an den Treulosen nicht.«
»Habe mir es damals gleich gedacht«, bemerkte Rudolf mit vieler Wichtigkeit, »der Herr Hauptmann werden bald aus der Attacke abrücken.«
»Ich wollte, der Herr Baron hätten die Gnade gehabt, auf dieses Abrücken ein Bein zu brechen«, rief das Mädchen im höchsten Unmut aus.
»Bah«, versetzte der ehemalige Grenadier trocken, »was hätte es Ihnen genützt? Er wäre auch mit einem Bein in ein anderes Lager übergegangen. Wenn ein Frauenzimmer eines Liebhabers ganz sicher sein will, muss Sie so operieren, dass er den Kopf verliert, dann kann Sie die Viktoria blasen.«
Über diesen seinen eigenen Scherz beliebte Herr Rudolf, in ein sehr heroisches Gelächter auszubrechen.
»Wie ich wahrnehme«, bemerkte Ludmilla, »sind Sie im Zivilstand ein wenig gewitzter geworden?«
»War auch notwendig, denn es ist ein großer Unterschied zwischen der Existenz im Zivil und im Militär. Als Soldat marschiert man seinen Weg, geradeaus nach dem Reglement, observiert man dies, oder sammelt man sich gar noch einige Meriten, dann ist man ein gemachter Mann, der wenig zu prätendieren, aber auch nichts zu riskieren hat; im Zivil dagegen, da ist es ganz anders, da heißt es nicht: „Geradeaus, marschiert!“ sondern: „Windet Euch und kriecht!“ Man kann ein Weinschlauch und Nasskittel sein, man kann unzüchtige Raupen und Possen treiben und man steht sich gut dabei, wenn man es hübsch im Geheimen treibt und keine Seele in Allarm bringt. Als Seine Exzellenz der Herr Graf von Löwenwalde mich aus dem Bataillon zu sich als Kammerdiener nahmen, beliebten Hochdieselben zu sprechen: „Rudolf, ich nahm Ihn zu mir ins Haus, er wird ein anständiges Gehalt erhalten, er wird keinen Soldatenkittel mehr tragen, aber die Militär Disziplin bleibt mir gegenüber aufrecht; begriffen? Mit dem anderen Leuten kann er es halten, wie er es will, schau er, wie er daraus kommt, je schlauer er ist, desto feiner wird er es haben.“ So sprach Ihre Exzellenz und ich habe mir die gräflichen Worte mit Akkurate hinters Ohr geschrieben, ich bin ein schlauer Zivilist geworden, ja ich bin sehr schlau, aber versteht sich, immer mit Diskretion.«
Ludmilla lachte sichtbar erheitert über den glatt geleckten Bären und sagte dann:
»Sie befinden sich also jetzt in Privatdiensten des Graf Löwenwalde?«
»Zu Befehl, Mademoiselle, ich habe die Ehre, Seiner Exzellenz Kammer- und Leibdiener zu sein«, und — der Schlaue sah sich sehr vorsichtig um und setzte geheimnisvoll und mit gedämpfter Stimme hinzu: »ich bin in auf Sein Befehl hier!«
Eine freudige Bewegung durchfuhr das Mädchen, doch war auch sie nicht minder schlau als Herr Rudolf, sie zwang daher rasch ihre Freude hinter die spanische Wand der Grandezza und sagte mit einem Ton, den sie vergebens in Eis zu hüllen suchte:
»Welche Neuigkeit? Der Herr Graf belieben sich, um mich zu kümmern? Der Herr Graf kennen mich ja gar nicht?«
»Entschuldigen Sie, Mademoiselle«, antwortete der gräfliche Leibdiener, »wenn Sie behaupten, Seine Exzellenz haben Sie noch nicht gesehen, dann sind Sie im Schritt; allein man braucht eine Person nie zu sehen und kennt Sie deshalb doch. Ein Regimentsinhaber wohnt in Wien, sein Regiment garnisoniert am Rhein, er hat die Mannschaft nie gesehen und kennt Sie doch, genau, sehr genau! Dies wird bewirkt nicht etwa durch Hexenkunst und Zauberei, sondern im, Wege Rechtens und des Dienstes durch die Verhaltenslisten, die ihm eingesendet werden und aus denen er Mann für Mann Hochseines Regiments genau kennenlernt; es ist höchst wahrscheinlich der Fall, dass Seine Exzellenz der Herr Graf von Löwenwalde auch Ihre Verhalten eingesendet erhielt.«
»Entschuldigen Sie, Herr Rudolf«, parodierte die Schöne verletzt, »erstens bin ich kein Regiment und zweitens sind der Herr Graf nicht mein Inhaber —«
»Aber der Herr Baron Krippenda waren es«, bemerkte der Schlaue, »und da mag es wahrscheinlich gekommen sein, dass er Sie Seiner Exzellenz empfahl …«
»Ich bedarf der Empfehlung des Herrn Barons nicht«, fiel ihm Ludmilla heftig in die Rede, »ich lasse mich überhaupt nicht empfehlen, am allerwenigsten von einem Ungetreuen, der seine Geliebten wie die Wachtstuben wechselt.«
»Mademoiselle, ich bitte Sie Ihre Beherrschung nicht zu verlieren, sondern bevor Sie Allarm blasen, mich anzuhören. Mademoiselle, Sie sind kein gewöhnliches Weibsbild, sondern eine schöne, eine kluge Person. Sie haben bis jetzt aus Ihrer Schönheit Vorteil gezogen, tun Sie es nun aus Ihrer Klugheit. Die Rosen auf den Wänglein werden gar leicht marod, das Feuer in den Äuglein verraucht wie der Schuss einer alten Hakenbüchse, der Glanz rostet wie die Politur einer Säbelklinge, wenn Sie feucht wird, mit einem Worte die Schönheit retiriert im Sturmlauf und wird mit der Zeit wirkungslos, wie ein altes demontiertes Wallstück; die Klugheit dagegen die bleibt, die Klugheit nimmt durch das Alter an Wert zu, so wie der Wein durch die Klugheit kann man noch immer Geld erwerben, wenn die Schönheit schon längst mit Abschied fortgegangen ist. Ich bin daher beauftragt, an Ihre Klugheit zu appellieren, und hoffe, dass Sie darauf reflektieren werden.«
»Sie machen mich sehr neugierig, Herr Rudolf.«
»Geduld, Mademoiselle, ich werde gleich in die Front ausmarschieren. Ich bin ermächtiget, Ihnen eine sehr respektable Ausgleich zu bieten …«
»Wofür?«
»Pro primo, dass Sie nach Wien übersiedeln —«
»Das lässt sich hören.«
»Pro secundo, dass Sie dort ein schönes Haus führen, versteht sich, nicht aus eigenem Geld.«
»Die letztere Bemerkung war höchst überflüssig. Weiter!«
»Pro tertio, dass Sie für die Dauer Ihres Aufenthaltes in Wien Ihren Namen ablegen.«
»Meinen Namen ablegen? Herr Rudolf, ich fange an zu fürchten, dass es sich um eine Schelmerei handelt!«
»Ei, ei«, versetzte der Schlaue, »haben Sie etwa gar geglaubt, dass man den Leuten heutzutage viel Geld schenkt, damit Sie ehrlich bleiben?«
»Schon gut — nur weiter — ich werde also meinen Namen ablegen.«
»Pro quatra, werden Sie den Namen und Charakter eines Frauleins von Schwerin akzeptieren.«
Ludmilla sah den gräflichen Leibdiener mit großen Augen an.
»Wer ist dieses Fraulein von Schwerin?«
»Die Grafen von Schwerin sind eine sehr respektable preußische Familie.«
»Und ich sollte mich für eine Preußin ausgeben? Jetzt, wo wir mit Preußen in Krieg und Feindschaft leben? Nimmermehr! Der Wiener Polizeidirektor Herr von Managetta ließe mich mit Gendarmen über die Grenze bringen oder wenn es ihm beliebte, mich als Spionin zu verhören, so könnte ich auch auf dem Hohenmarkt mit dem Staubbesen Bekanntschaft machen, was schier noch schlimmer wäre.«
»Oho, oho, wo denken Sie hin! Mit der Tochter eines Generals geht man nicht so um. Doch wenn man auch darauf keine Rücksicht nähme, so sollen Sie, trotzdem, dass Sie für eine Preußin gelten werden, dennoch von der Polizei ungeschoren bleiben.«
»Wie so dies?«
»Sie sollen es gleich vernehmen. Pro quinto, Sie sind als Fraulein von Schwerin im heutigen Sommer aus den preußischen Staaten entflohen, Sie sind demnach eine Feindin Preußens oder vielmehr des preußischen Königs.«
»Des Königs? Warum das vielmehr?«
»Weil Sie, pro sexto, als Fraulein von Schwerin seine intime Freundin waren und Se. Majestät Sie verstoßen hat.«
»Herr Rudolf, ich fange an zu fürchten, dass es sich hier nicht um eine gewöhnliche, sondern um eine sehr gefährliche Schelmerei handeln wird.«
»Ich habe vorhinein die Schelmerei zugestanden; was jedoch die Gefährlichkeit betrifft, muss ich Sie entschieden in Abrede stellen. Die Angaben, die Sie zu machen haben, sind falsch, das ist Betrug, richtig, dafür werden Sie rekompensiert, wo aber steckt die Gefahr? Etwa darin, dass Sie den König Friedrich ins Spiel bringen? Er ist unser Feind, man wird die Sache nicht so subtil nehmen, außerdem vergessen Sie nicht, dass diejenigen, die Ihre Officia in Anspruch nehmen, auch nicht ohne Autorität sind, dass Dispositionen zu Ihren Gunsten getroffen werden, um Sie im Notfall zu retten.«
»Aber wozu dieses Gewebe von Lügen, wozu diese Maskerade und Komödie?«
»Auch darüber will ich Sie aufklären, doch erst dann, wenn Sie sich verpflichten, diese Angaben nicht nur einfach machen, sondern auch im nötigen Falle mit einem Jurament zu bekräftigen.«
Ludmilla erschrak.
»Herr Rudolf«, rief sie, »das Versprechen wäre ja ein falsches!«
»Natürlich, und deshalb erhalten Sie das viele Geld; Versprechen, die nicht falsch sind, muss man umsonst ablegen und man erhält oft nicht einmal ein Vergelts Gott dafür, viel weniger aber fünfhundert bare Gulden.«
»Fünfhundert Gulden?«, fragte die Schöne angenehm überrascht.
»Fünfhundert Gulden«, bestätigte der Leibdiener und außerdem kostenfreien, standesgemäßen Aufenthalt in Wien, der sich, nebenbei bemerkt, durch mehrere Monate erstrecken kann, was höchst wahrscheinlich zweimal so viel kosten wird.«
Die für die damalige Zeit beträchtliche Summe zerstreute alle etwaigen moralischen Bedenken und Ludmilla Prokop erklärte, die Rolle des Frauleins von Schwerin zu spielen.
Herr Rudolf, der seine Mission sehr schlau ausgeführt hatte, war sichtbar erfreut und brachte noch am selben Abend den merkwürdigen Handel zum Abschluss.
»Fräulein«, sagte er beim Abschiede mit einer Reverenz wie sie einer Komtesse von Schwerin gebührte, »ich empfehlen mich Ihre Gnaden auf das angelegentlichste und werde zu Wien vermelden, dass Ihre Ankunft längstens binnen vierzehn Tagen dort erfolgen wird.«
Er schritt feierlich hinaus.
Ludmilla Prokop kündete schon am nächsten Tage ihre Wohnung, veräußerte ihre bürgerliche Einrichtung, versah sich mit eleganten Gewändern und trat acht Tage später in einer schwerfälligen Postkutsche, von vier Kleppern gezogen, die Reise nach Wien an, um dort als Fraulein von Schwerin auf dem Schauplatz der Begebenheiten zu erscheinen.
Eine Bekanntschaft auf der Straße
Die Szenen im Herrnhofe zu Frainspitz und im Haus nächst der neuen Minoritenkirche in Brünn ereigneten sich, wie bereits bekannt, am Tage Sanct Galli, das ist am sechzehnten Oktober 1746.
Am folgenden Abend, nämlich am Abend des Siebzehnten, fuhr eine mit vier kleinen ungarischen Rösslein bespannte Reisekalesche auf der Straße von Znaim gegen Ober-Hollabrunn.
Teils das heraufgezogene Dunkel der Nacht, noch mehr aber ein dichter, stinkender Nebel verbreiteten eine so undurchdringliche Finsternis, dass die Reise auf der damals noch ungebauten Straße nicht ohne Gefahr war.
Der Lenker jener Kalesche glaubte daher im Interesse und zur Sicherheit seiner Herrschaft zu handeln, wenn er seine Rösslein zügelte und sie statt im Trab, im Schritt durch Nacht und Nebel ziehen ließ.
Mit dieser Vorsichtsmaßregel war man jedoch in der Kutsche nicht einverstanden.
Eine kräftige Männerstimme, der man am ersten Ruf abhörte, dass ihr das Kommandieren geläufig sei, rief in slawonischer Sprache aus dem geschlossenen Wagen heraus:
»Janko, was ist das für eine Schneckenpost?«
»Herr«, antwortete der Kutscher in dem nämlichen Idiom, »die Finsternis ist so dicht, dass die Augen ganz überflüssig geworden sind, und da dachte ich …«
»Räuberischer Hund, du hast an gar nichts zu denken, sondern im Trab zu fahren.«
»Herr, sehen Sie sich die Finsternis nur an, es ist nicht möglich —«
»Wenn ich einmal dazukomme, den Wagen halten zu lassen«, schrie die vorige Stimme heraus, »dann kannst du auf fünfzig Prügel rechnen, die alle Heilige dir nicht mehr herabnehmen sollen. Fahr zu, Hund!«
Dieser interessante Wortwechsel wurde geführt, ohne dass der Wagen hielt. Herr und Diener schrien so laut, dass Sie sich trotz der geschlossenen Kutsche verstanden, ohne dass der Herr seinen Sitz und Janko seinen Sattel verließ.
Die Drohung mit den fünfzig Prügeln war keineswegs in den Wind oder besser in den Nebel gesprochen, Sie war keine leere Phrase, denn auf dem Bock vorne saß ein Haiduck, der keine Sekunde lang Anstand genommen hätte, die Exekution auf offener Straße zu vollziehen, was ihm — beiläufig bemerkt — in der Praxis gar oft vorgekommen war.
Janko, dem Prügelfrieden nimmer trauend, versetzte die Rösslein in Trab und grummelte dabei in den Bart:
»Meinetwegen, wenn Er es haben will, so sei es. Ich leide keinen Schaden, wenn ein Pferd den Fuß bricht oder die Kutsche in Trümmer geht!«
Gegen diese Logik legte aber der Herr im Wagen sein Veto ein; denn nach einigen sehr unangenehm empfundenen Stößen ließ er seine mächtige Stimme abermals erschallen und schrie, wo möglich noch drohender als früher, hinaus:
»Verdammter Kerl, aufgepasst! Achtung! Wenn ein Pferd oder der Wagen zu Schaden kommt, so lass ich dir hundert aufzählen, dass dich die Engel im Himmel pfeifen hören sollen!«
Diese zweite vermehrte Auslage schien den armen Janko, obwohl er des Schreibens und Rechnens unkundig war, doppelt so gefährlich wie die erste; er ging daher mit sich zu Rat, ob es besser sei, langsam zu fahren und sichere fünfzig in Empfang zu nehmen oder im Trab zu bleiben und hundert zu riskieren?
Nach einigem Besinnen entschloss er sich zu Letzteren, da ihm hier wenigstens die Hoffnung blieb, wenn das Geschick ihn begünstigte, mit gesunden Pferden und unbeschädigten, Wagen davon zu kommen, während im anderen Fall die Fünfzig unausbleiblich waren. Janko kannte seinen Gebieter und wusste, dass er nie pünktlicher Wort hielt, als wenn er jemanden Prügel versprach. Infolge dieser Betrachtungen ließ er die Rösslein forttraben, richtete die weit offenen Augen unablässig auf die Straße, um den Löchern und Gruben zeitlich genug auszuweichen, was aber der Finsternis wegen ein eitel Bemühen blieb, denn er gewahrte die Unebenheiten und Hindernisse erst, bis der Stoß sie ihn fühlen ließ, wobei er jedes Mal unter Herzklopfen: »Jai, jai!«1 rief, als ob er den Ersten der Hundert schon verspürte.
Und kein Mensch kann seinem Schicksale entgehen, auch der arme Janko war ein Mensch und sein Schicksal schien es zu sein, heute geprügelt zu werden.
Seit dem letzten Stoß war es indessen eine Weile ruhig fortgegangen, Janko atmete schon leichter und ruhiger auf und hoffte, das Fuhrwerk werde in dieser Weise friedlich, fortrollen, als plötzlich ein Rad desselben mit vier Pferdekraft an einen mächtigen Stein gerissen, sich spitzte und zerbrach; das Geräusch und die Erschütterung machten die Pferde scheu, sie schleppten die dreirädrige Kalesche eine Strecke fort, wodurch auch die Achse mit lautem Krachen in Trümmer ging.
Janko hatte Mühe die Pferde zum Stehen zu bringen.
»Da haben wir es«, begann er jetzt laut zu schimpfen, »das Unglück ist nun fertig, der Teufel hole die ganze Wirtschaft, jetzt ist mir’s schon einerlei, geprügelt werde ich so wie so; ob ich einige Streiche mehr bekomme, daran liegt mir wenig, wer hundert verträgt, erstickt auch an den nächsten Zwanzig nicht.«
Während dieser verzweifelten Expektoration war der Haiduck vom Bock gesprungen, der Kutschenschlag flog auf und aus dem Wagen stürzte ein Mann, von dem wir ob der undurchdringlichen Finsternis nichts wahrnehmen können, als dass er in einen Kapuzenmantel gehüllt und über sechs Schuh lang ist.
»Hund, Räuber, vermaledeiter Lump!«, schrie er dem armen Janko mit einer Stimme zu, die erkennen ließ, dass er der Mann mit der mächtigen Lunge sei, der vorhin aus dem Wagen drohte, »herunter vom Pferd, nieder auf die Erde, Mischko — das war der Name des Haiducken — zähle ihm hundert Hiebe auf, aber tüchtige, damit er noch daran denke, wenn ihm einst der Teufel das Licht ausbläst.«
Die Leidenschaftlichkeit, welcher der Koloss sich überließ, gab nicht nur die Heftigkeit seines Temperaments, sondern auch den Ernst der Situation zu erkennen, und die Gefahr, in welcher Janko schwebte.
Der Arme war vom Pferde gestiegen und nahm nun zu Bitten seine Zuflucht.
»Herr, ich bin unschuldig.«
»Nieder auf die Erde!«
»Man sieht ja nicht einen Schritt weit —«
»Nieder auf die Erde!«
»Herr, Du hast ja befohlen, dass ich schnell fahre.«
»Nieder auf die Erde!«
Der Bedrängte mochte was immer einwenden, er bekam nichts zu hören als: »Nieder auf die Erde!«
Janko seufzte, blickte scheu und furchtsam um sich, als erwarte er irgendeine unvorhergesehene Hilfe, vergebens, er gewahrte nichts, als seinen Busenfreund, den Mischko, per wie ein Strafengel mit dem drohenden Stocke neben ihm stand, seinen Schnurrbart wirbelnd und der trotz der warmen Gefühle, die ihn beseelten, doch keinen Anstand nahm, seinem Freunde und Landsmann das Lederzeug anzustreichen.
»Jai, jai, Herr, ich bin unschuldig!«
»Nieder, auf die Erde!«, wiederholte der Koloss und stampfte dabei zur Abwechslung mit einem Fuße die Erde. Der Kutscher erkannte die Steigerung der herrschaftlichen Wut und um nicht noch mehr zu wagen, begann er sich in sein Schicksal zu fügen und wollte sich eben auf die kotige Muttererde niederlassen, als Wagengerassel und Posthornklang durch die Nacht erscholl, und zwar in derselben Richtung, woher auch die jetzt zerbrochene Kutsche gekommen war.
Janko schöpfte Hoffnung — vielleicht rettete ihn diese Kutsche, er wusste zwar nicht, wie? Aber er hoffte dennoch. Die Geschichte von dem Ertrinkenden, der sich an einen Strohhalm klammert, ist zwar alt, aber sie wiederholt sich so oft, dass sie ewig frisch und ewig jung bleibt.
Auf den Herr — ein merkwürdiger Gegensatz zwischen Diener und Herr — brachten das Wagengerassel und die Posthornklänge gerade die entgegengesetzte Wirkung hervor, während sie jenen zögern ließen, trieben sie diesen zur Beschleunigung an und er schrie:
»Auf die Erde nieder, Hund! Was hältst du uns auf? Mache mich nicht grimmig — oder —«
Janko fing entsetzlich zu heulen an und stellte sich als befolge er die Befehle seines Herrn.
In diesem Moment langte die Postkutsche auf dem Schauplatze an und machte Halt. Eine lodernde Fackel, von dem Diener auf dem vorderen Bock gehalten, brachte einiges Licht auf die Szene.
Aus diesem Wagen stieg nun ebenfalls ein Herr und fragte:
»Was fällt hier vor? Warum der Aufenthalt? Was gibt es für einen Lärm auf der Straße?«
Der Fackelträger näherte sich der verunglückten Kalesche, sein Herr folgte ihm.
»Was gibt es hier?«, fragte er nochmals.
»Einen unliebsamen Aufenthalt!«, antwortete der Koloss unwirsch, »verursacht durch die Nachlässigkeit dieses Schurken.«
»Warum schrie dieser Mensch so entsetzlich? — Wenn ich mich nicht täusche, so droht ihm eine körperliche Züchtigung?«
»Sie entgeht ihm nicht, dieses Hundevolk kann nicht selig werden, wenn es nicht geprügelt wird.«
»Es mag eine hübsche Seligkeit sein, die eingeprügelt werden muss. Indessen ist es meine unvorgreifliche Meinung, es wäre zweckmäßiger, wenn möglich, das zerbrochene Gefährte notdürftig herzustellen, zum Prügeln lassen blieb Ihnen später noch immer Zeit genug.«
»Der Teufel hole den Wagen!«, polterte der Andere, »ein Rad ist zerschellt, die Achse gebrochen, was lässt sich damit auf offener Straße beginnen?«
»Wohin führt Ihre Reise, wenn es zu fragen erlaubt ist?«
»Nach Wien!«
»Mein Weg geht ebenfalls dahin. Wenn Sie es rätlich erachten, den Wagen Ihrer Dienerschaft anzuvertrauen, so bin ich bereit, Ihnen einen Sitz neben mir anzubieten.«
Die augenblickliche Verlegenheit des Mannes im Kapuzenmantel musste ihm das Anerbieten höchst willkommen erscheinen lassen und er nahm es auch ohne Zögern an.
Janko wurde pardoniert, Mischko erhielt die Weisung, am Wagen eine Schleife anzulegen, die Kutsche bis nach Hollabrunn zu bringen, wo der Herr im Wirtshaus die Ankunft der Equipage abzuwarten versprach.
Hierauf begab sich der Koloss zu der Postkalesche, welche der andere Reisende mittlerweile schon bestiegen hatte und sagte sehr manierlich:
»Mein Herr, ich nehme Ihr Anerbieten mit Dank an und bin bereit, die Hälfte der Kosten zu tragen.«
»Davon darf keine Rede sein«, versetzte der Andere feierlich, »ich bin Kavalier!«
»Auch ich bin es!«
»Um so besser!«
»Darf ich wissen, mit wem mir die Ehre wurde zu reisen?«
»Ich bin der königlich schwedische Assessor beim Bergwerkskollegium Emanuel von Swedenborg.«
»Und ich«, erwiderte der Koloss, »ich bin Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Theresia Pandurenoberst Franz Freiherr von der Trenk.«
Eine Unterhaltung im Wagen
Der Assessor war der erste, der das Wort ergriff.
»Herr Baron«, sagte er, »es freut mich, auf so unerwartete Weise Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, jetzt erst kenne ich Sie vollkommen. Sie müssen nämlich wissen, Herr Oberst, dass ich schon so viel von Ihren Abenteuern und Kriegsfahrten erzählen hörte, dass ich immerhin behaupten darf, ich habe Sie zum Teil gekannt, bevor ich Sie sah.«
»Man spricht also von mir auch im Ausland?«, fragte Trenk sichtbar geschmeichelt.
»Ihr militärisches Talent, Ihr Unternehmungsgeist, Ihre Verwegenheit werden allerorts gerühmt. Sie haben Ihrer Souveränin respektable Dienste geleistet.«
»Und die Kaiserin«, versetzte Trenk mit Genugtuung, »hat meinen Verdiensten auch volle Anerkennung gezollt. Ich bin kaiserlicher Oberst und hoffe noch weiter zu avancieren.«
»Hoffen Sie dies wirklich, Herr Baron?«, fragte Swedenborg mit einer Stimme, die seinen Zweifel verriet.
»Mein Herr!«, rief Trenk fast beleidigt.
»Ohne Aufbrausen, Herr Baron! Ich bitte, lassen Sie uns ruhig und mannhaft miteinander sprechen. Sie zählen erst zweiunddreißig Lebensjahre, ich dagegen achtundfünfzig. Sie haben bereits viel erlebt, ich dagegen habe viel gelernt. Ihnen gegenüber bin ich ein alter Mann, dem Sie wohl zutrauen werden, dass er nur mit Bedacht spricht und handelt. Ich werde vielleicht Vieles sagen, was Ihnen unangenehm sein wird, aber nichts, was Sie später nicht bestätigt finden werden. Sind Sie geneigt, mich anzuhören?«
»Sprechen Sie, Herr Assessor!«, versetzte der Oberst mit dumpfem Tone.
Der Schwede fuhr fort:
»Ich will aufrichtig sein, Herr Baron, und bekennen, dass unsere Bekanntschaft keine zufällige ist. Meine Reise nach Wien galt nebst Anderen auch Ihnen.«
»Mir?«, fragte Trenk überrascht.
»Ja, Herr Baron, Ihnen. Sie kehren jetzt aus dem nicht sehr glücklichen Feldzug in den Niederlanden, während die Armee die Winterquartiere bezog, nach Wien zurück und — merken Sie sich wohl was ich Ihnen sage — Sie sind in Gefahr, die Armee, so wie Ihre Panduren nie wieder zu sehen.«
Der Assessor fühlte, wie der Oberst an seiner Seite sich heftig hin und her bewegte.
Der Assessor fuhr daher rasch fort:
»Wenn unsere heutige Zusammenfahrt für Sie und für mich einen Erfolg haben soll, so müssen Sie, Herr Baron, Ihres Naturells Meister werden und jede Heftigkeit mit Gewalt unterdrücken. Ich sagte vorhin, meine Reise nach Wien gelte zum Teil auch Ihnen. Ein Zufall kam mir zustatten, ich finde Sie ein paar Tage früher, um so besser, Warnungen kommen nie früh genug.«
»Sie haben also die Reise von Schweden nach Wien unternommen, bloß um mich zu warnen?«
»Um Vergebung, Herr Baron, Ihr Spott ist nicht am Platz, Ihre Behauptung ist falsch. Ich sagte, meine Reise gelte nebst Anderen auch Ihnen. Außerdem geht meine Absicht dahin, ·nicht allein Sie zu warnen, sondern auch mit Ihnen einen Bund zu schließen.«
»Eine Allianz?«, fragte Trenk.
»Reiche alliieren sich, Edelleute verbünden sich, der Pöbel rottet sich zusammen.«
»Was soll die beabsichtigte Verbindung bezwecken?«
»Das Glück der Menschheit!«
»Unser beider Bund sollte das Glück der Menschheit anstreben?«, fragte Trenk lächelnd.
»Ein Glied und noch ein Glied bilden keine Kette, das ist wahr, wenn man jedoch viele Glieder ineinanderfügt, dann entsteht Sie. Ein Glied reicht hin, zwei getrennte Teile zu einem Ganzen zu verbinden, und wären ihre Enden weit voneinander entlegen, dann fügt man solange Glied in Glied, bis alle eine Kette bilden. Eine solche Kette durch alle Länder des Weltteils gezogen, ein und dasselbe Ziel verfolgend, muss es erreichen und wären die Hindernisse, gegen welche Sie anzukämpfen hat, noch so zahlreich.«
»Sie meinen also, dass auch ich ein Glied einer Kette werden soll …«
»Die schon besteht!«
»Ihr Antrag würde mich in Staunen versehen«, entgegnete der Pandürenoberst, hätte ich nicht schon manches von einem geheimen Bunde flüstern hören, der sich über Deutschland herüber nach Österreich zieht und auch in unseren Land sich zu verbreiten strebt. Ich habe mich nie darum bekümmert, denn mein Soldatenblut inkliniert nicht zu solchen Extravaganzen, ich liebe die geheimen Konventikel nicht, wo man entweder mystischen Firlefanz oder Verschwörungen treibt.«
»Herr Oberst«, erwiderte Swedenborg mit dem Ton leisen Vorwurfs, »würden Sie die Zwecke des Bundes, dem beizutreten ich Sie einlade, näher kennen, Ihr Urteil wäre milder ausgefallen; würden Sie die Macht nur ahnen, die der Bund jetzt schon besitzt, den Beistand, den er Ihnen in der Gefahr, der Sie entgegen gehen, zu leisten vermag, Sie würden die dargereichte Hand nicht stolz von sich weisen, sondern sich mit Freuden uns anschließen.«
Trenk schwieg einige Augenblicke, dann sagte er:
»Sie fordern mich zum Beitritt in einen geheimen Bund auf, dem auch Sie angehören; sind Sie dazu ermächtigt?«
»Ja, Herr Oberst.«
»Von wem?«
»Von einem Oberen des Bundes.«
»Gilt die Ermächtigung bloß für meine Person?«
»O nein, Sie gilt auch Anderen.«
»Was erwarten Sie, was erwartet der Bund von mir? Warum fiel Ihre Wahl gerade auf mich?«
»Weil Sie in der Lage sind, den Bund aufs Kräftigste zu unterstützen und dessen Gedeihen, dessen Erweiterung zu fördern. Herr Baron, Sie sind ein der Kriegswissenschaft kundiger Soldat, Sie werden jedoch zugestehen, dass diese Wissenschaft das Wohl der Menschheit nicht befördert, dass Sie keine Selbstständige ist, vielmehr in anderen Wissenschaft derart wurzelt, dass ihr Fortschritt von dem der anderen bedingt ist. Jene Wissenschaft im großen Ganzen zu verbreiten, zu verallgemeinern, allen Schichten der Gesellschaft zugänglich zu machen, durch Sie Licht und Aufklärung in die Welt zu senden und solcher Art das Glück der Menschheit zu fördern, das ist der Zweck des Bundes. Um diesen erhabenen Zweck zu erreichen, muss sich die Wissenschaft mit der Macht, mit der Tatkraft vereinigen, diese muss den Bund schützen, muss seine materielle Existenz ermöglichen, jene muss ihn erleuchten, muss ihr in schlaflosen Nächten erworbenes Wissen zum Gemeingut werden lassen. Betrachten Sie mich und Sie, Herr Baron, das Beispiel im Kleinen wird genügen, um auf die Wirkung im Großen zu schließen. Ich bin ein Mann der Wissenschaft, mein Vaterland schätzt mich als einen seiner gelehrtesten Männer. Philologie, Mathematik, Philosophie, alle Naturwissenschaften, Astronomie, usw. gehören in das Bereich meines Wissens; ich habe Werke ediert, denen die Bewunderung der gelehrten Welt zu Teil wurde; mein Vaterland hat alles anerkannt, hat mich belohnt, allein welchen Nutzen schöpft die Menschheit im großen Ganzen aus meinem Wissen? Die gelehrte Welt steht noch zu isoliert, sie greift nicht ein in die Massen, sie bildet eine Zunft und bereichert selten mit ihren Schätzen jene, die außerhalb des Gelehrtenkreises sich befinden. Denken Sie sich aber einen innigen Bund, geschlossen zwischen mir und Ihnen! Sie besitzen, was mir mangelt, Macht, Reichtum, Sie können im Kreise Ihrer Untertanen, Ihrer Untergebenen, Ihrer Freunde und Verwandten das verbreiten, was ich durch ein langes Leben erlernt und erforscht, Sie können auf fruchtbarem Boden den Samen ausstreuen, den ich gesammelt, damit er zum segensvollen Korn der Aufklärung heranreife; wir Beide vereint würden erzwecken, was keiner von uns allein vermöchte. Übertragen Sie dieses Verhältnisse ins Große, erweitern Sie die Wirkung ins Massenhafte und Sie werden Ihre letzte Frage, warum unsere Wahl auf Menschen Ihres gleichen fällt?, beantwortet erhalten.«
Die in der Kutsche herrschende Dunkelheit ließ den Assessor die Miene des Pandürenoberst nicht sehen, sonst hätte er es wahrhaftig unterlassen, das Gespräch fortzuführen, da er aus dem Gesichte des Barons das Vergebliche seiner Bemühung nur zu deutlich herausgelesen hätte.
»Wenn indessen die Finsternis die Macht des Auges verkümmerte, so blieb doch die des Ohres ungeschwächt und der höhnische Ton in der Antwort Trenks verriet dem Schweden hinlänglich, was die Dunkelheit ihm entzog.
»Sie laden mich ein«, sagte er, »in Gemeinschaft mit Ihnen Aufklärung zu verbreiten und rechnen dabei auf meinen Einfluss, meine Macht und meinen Reichtum; haben Sie aber auch bedacht, ob es wirklich in meinem Interesse liegt, dass Aufklärung verbreitet werde? Ich bin Kavalier und zähle auf meinen slawonischen Gütern zahlreiche Untertanen, Geschöpfe, die mir unbedingt gehorchen müssen, und keinen anderen Willen haben dürfen, als den meinen; angenommen, es läge im Bereiche der Möglichkeit, auch in dieses Volk die Aufklärung hineinzuprügeln, denn anders würde man wohl damit nicht zustande kommen, meinen Sie, dass ich etwas dabei gewänne? Aufgeklärte Leute sind schlechte Untertanen; als der Teufel der Aufklärung in die Köpfe der Bauern fuhr, haben Sie zu rebellieren angefangen.«
»Um Vergebung, Herr Baron«, fiel ihm der Assessor in die Rede, »an den Rebellionen der Bauern trug nicht die Aufklärung die Schuld, sondern die Bedrückungen, der Egoismus der Grundherrschaften; dass Einzelne durch die Aufklärung der Massen nur verlieren werden, will ich gerne glauben, allein ich denke, es ist die Pflicht jedes Redlichen, sein Interesse dem des Ganzen unterzuordnen.«
»Ja diesem Fall«, versetzte Trenk trocken, »halte ich es mit den Unredlichen und bin erbötig, jedem, der es mir öffentlich verübeln würde, das Genick zu brechen.«
»Das heißt, Sie würden Ihr Unrecht durch Gewalt verdecken wollen; man bringt aber die Wahrheit nicht so leicht zum Schweigen; reißt man ihr die Zunge aus, so bleiben ihr die Finger und schnitte man ihr auch diese ab, so ist jeder vergessene Blutstropfen ein neuer Zeuge, der für Sie spricht. Herr Baron, versündigen Sie sich nicht an der Wahrheit, es dürfte vielleicht eine schwere Zeit der Prüfung für Sie kommen, wo Ihre Feinde, Ihnen zum Schaden, der Wahrheit ins Angesicht schlagen und Sie mit Füßen treten werden, während Sie gefesselt die Macht nicht besitzen werden, zu verhindern, dass die Lüge den Sieg davon trage.«
»Sie wollen mich durch Schreckschüsse in Ihr Netz treiben, eitle Mühe! Der Baron Trenk lässt sich nicht hin und her scheuchen wie ein gehegter Hase, ich fürchte keine Drohung und bin Mann genug, jede Gefahr von mir abzuwenden.«
»Ob Sie dies wirklich vermögen, wird sich zeigen.«
»Sie tun, als ob Sie wer weiß, wie genau von meinen Schicksalen unterrichtet wären.«
»Hören Sie, ob ich es bin oder nicht? Im Februar 1745 zogen Sie in Wien wie im Triumphe ein. Sie kamen mit Ruhm beladen aus dem Feldzug, hatten eine Fußwunde und wurden am Hof mit aller Distinktion empfangen, die Kaiserin empfing Sie aufs Liebreichste und gewährte Ihnen die Gnade, sich in Höchst ihrer Gegenwart niedersetzen zu dürfen.
»Die kaiserliche Auszeichnung, der Jubel der Wiener, Ihre großen Verdienste erbitterten Ihre zahlreichen Feinde, die Ihnen teils der Neid, teils aber, lassen Sie mich aufrichtig sein, Herr Baron, Ihre Fehler zuzogen. Sie kümmerten sich jedoch darum nicht, machten den nächsten Feldzug mit und mochten nicht wenig erstaunt sein, als Sie nach anerkennenswerter beendeter Kampagne nach Wien eilen mussten, um Ihre gekränkte Ehre nachdrücklich zu verteidigen. Zahlreiche Klagen wurden gegen Sie erhoben, man beschuldigte Sie der Gewalttaten gegen Offiziere, des Atheismus, der Freigeisterei, des Kirchenraubes in Bayern, der Plünderungen; es gab Leute, welche behaupteten, Sie hätten in der Schlacht bei Sorr, als Sie das Zelt des preußischen Königs überfielen, diesen persönlich gefangen genommen, ihn aber gegen ein ungeheures Lösegeld entschlüpfen lassen, ja, Ihre ärgsten Feinde meinten sogar, Sie sammeln deshalb so ungeheure Reichtümer, weil Sie im Plan hätten, die slawonischen Länder zu revoltieren und sich von Ihrer Majestät Regierung unabhängig zu machen.
»Die Kaiserin gab diesen Anklagen anfangs kein Gehör, allein Ihre Feinde allarmierten den Pöbel, erbitterten sogar die Gebildeteren; die gute Kaiserin wurde überlaufen und fand sich endlich auf Ihr eigenes Ansuchen bewogen, eine Untersuchung anzuordnen. Feldmarschall Cordua, einer der rechtschaffensten Männer Wiens, leitete dieselbe und entschied in einem an die Kaiserin gerichteten Gutachten:
»Dass alle angebrachten Klagen von solcher Art wären, dass Sie kein Kriegsrecht erforderten. Trenk habe hin und wieder gegen Offiziere gefehlt, indem er Sie gar zu eigenmächtig kassiert hätte. Um diese alle abzufertigen, sollte er zwölftausend Gulden bezahlen. Alle übrigen Anzeigen hätten den Geruch der Rachgier und Verleumdung; wären auch nicht wert, dass man einen Mann in Wien mit Prozessen aufhielte, der so notwendig bei der Armee wäre. Man müsse übrigens in Ansehung seiner wichtigen Dienste bei Kleinigkeiten durch die Finger sehen, usw.
»Diese günstige Entscheidung wurde von Ihnen in so ferne missachtet, dass Sie sich weigerten, die den Offizieren zugesprochene Summe zu bezahlen und stattdessen mit Extrapost auf Ihre Güter nach Slawonien fuhren. Der im heurigen Frühjahr begonnene Feldzug rief Sie wieder zur Armee, und nun, da die Winterquartiere bezogen sind, reisen Sie abermals nach Wien, wo Ihre Feinde mittlerweile nicht untätig geblieben sind. — Sie haben sich nun überzeugt, »Herr Oberst, dass ich mit Ihren Schicksalen vollkommen vertraut bin, und wenn es mir beliebte, den Wahrsager zu spielen, so würde ich Ihnen Dinge prophezeien, die Ihre kühne Zuversicht nicht wenig erschüttern würden. Ihre Lage ist keine beneidenswerte, in mancher Beziehung sogar eine gefährliche, und dennoch getraue ich mich, Ihnen eine glückliche Umschiffung der Klippen zu verheißen, wenn Sie sich mit uns verbinden und unserem Bunde beitreten. Wir kennen Ihre, Feinde, wir werden Sie unschädlich machen und Sie sollen aus der Anklage rein und vollkommen gerechtfertigt hervorgehen.«
»Das werde ich auch ohne Sie und ohne Ihren Bund«, rief Trenk, dessen Geiz und Stolz sich gegen die Zumutung des Assessors empörten; »bleiben Sie mir mit Ihrem geheimen Firlefanz, mit Ihrer leidigen Aufklärung vom Leibe und kümmern Sie sich um meine Angelegenheiten nicht fürder; meine Sache ist gerecht, einmal habe ich bereits über meine Feinde triumphiert, ich werde Sie jetzt zum zweiten Mal ihrer Lügen und Verleumdungen überweisen, dazu bedarf ich jedoch keiner Verbündeten, dazu bin ich mir selbst Mann genug. Unsere Wege, unsere Interessen gehen weit auseinander, Herr Assessor; wir beide können nicht Hand in Hand gehen, mir als Soldat ist der Krieg alles, Ihnen als Gelehrter der Friede; Sie sind Freimaurer, ich bin Pandur, Wasser und Feuer können sich nicht mengen, bleiben wir getrennt und warten wir die Zukunft ab, um zu sehen, wer von uns eher sein Ziel erreicht und wer von uns Ursache haben wird, über den Anderen zu triumphieren!«
Der Wagen hielt. Man war in Hollabrunn angelangt.
Der Oberste dankte dem Assessor für die Fahrt und schied von ihm, nicht ohne Trotz, nicht ohne Hochmut, bauend auf seine Kraft, auf seine Verdienste.
Der Leser lernt den Baron Trenk kennen





























