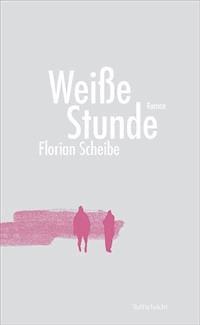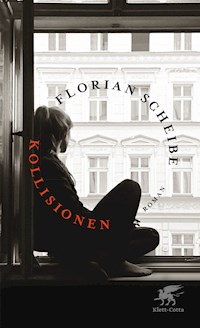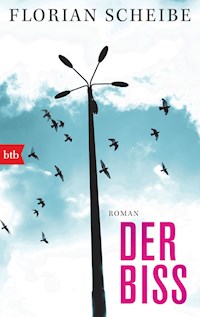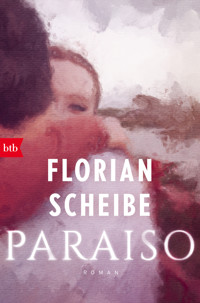
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Last Exit Ehetherapie - ein Paar kämpft um sein Überleben: erschütternd, fesselnd, gnadenlos ehrlich
In Aldea Paraiso, einem abgelegenen Dorf in Südspanien, haben zehn Paare ein exklusives Beziehungs-Coaching gebucht. Unter ihnen sind auch Manon und Thomas, die hier den letzten Versuch unternehmen, ihre Ehekrise in den Griff zu bekommen und ihre Familie zu retten. Anfangs sind sie befremdet von dem seltsamen Setting und dem unkonventionellen Ansatz, den der Leiter, Professor Blumberg verfolgt. Aber die Therapie scheint zu fruchten. Sie kommen einander wieder näher. Doch je länger ihr Aufenthalt dauert, desto mehr Fragen bedrängen sie: Woher weiß der Therapeut so gut über ihre Gefühle Bescheid? Was ist mit den Drohnen, die ständig über dem Dorf kreisen? Und was hat es mit dem Paar auf sich, das sie eines Abends zu sich einlädt? Noch ahnen sie nicht, dass die Nacht, die auf diesen Abend folgt, alles verändern wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
In Aldea Paraiso, einem abgelegenen Dorf in Südspanien, haben acht Paare ein exklusives Beziehungs-Coaching gebucht. Unter ihnen sind auch Manon und Thomas, die hier den letzten Versuch unternehmen, ihre Ehekrise in den Griff zu bekommen und ihre Familie zu retten. Anfangs sind sie befremdet von dem seltsamen Setting und dem unkonventionellen Ansatz, den der Leiter, Professor Blumberg verfolgt. Aber die Therapie scheint zu fruchten und sie kommen einander wieder näher. Doch je länger ihr Aufenthalt dauert, desto mehr Fragen bedrängen sie: Woher weiß der Therapeut so gut über ihre Gefühle Bescheid? Was ist mit den Drohnen, die ständig über dem Dorf kreisen? Und was hat es mit dem Paar auf sich, das sie eines Abends zu sich einlädt? Noch ahnen sie nicht, dass die Nacht, die auf diesen Abend folgt, alles verändern wird ...
Zum Autor
Florian Scheibe, geboren 1971 in München, hat Kulturwissenschaft, Geschichte und Filmregie studiert. Er lebt mit seiner Familie in Berlin, wo er als freier Autor arbeitet. Zuletzt erschien bei btb sein dritter Roman Der Biss.
Florian Scheibe
PARAISO
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Dies ist eine Fiktion. Alle Verweise auf reale Begebenheiten, Institutionen, Orte oder Personen dienen lediglich dazu, ein fiktives Universum zu erschaffen.
Originalausgabe Juni 2024
Copyright © 2024 by Florian Scheibe
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © plainpicture/Oksana Wagner
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
MN ∙ Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-29531-8V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Manon
Eins
Alles beginnt mit dem Boot. Aber noch ist es kein Boot, sondern nur ein dunkler Fleck am Horizont.
Manon liegt auf der Luftmatratze, ihr Körper mit einem offenen Schlafsack bedeckt, und blinzelt gegen das Licht. Sie ist noch halb in ihrem Traum. Sie hört das Rauschen der Wellen, spürt die Wärme der Sonne und den Wind, der vom Meer herkommt. Aber vor allem spürt sie, dass sie allein ist. Gerade eben war er noch da, ganz nah, so nah wie seit Jahren nicht mehr. Und nun ist er weg. Wie verschluckt von der Sonne, dem Wind, den Wellen.
Sie hebt den Kopf. Betrachtet die kleine Bucht, den weißen Sand, die schützenden Felsen rechts und links und die steilen Klippen in ihrem Rücken. Vor sich sieht sie das offene Meer und an der Grenze zum Himmel diesen dunklen, tanzenden Fleck.
»Thomas?«
Entgegen ihrer Gewohnheit ruft sie seinen Namen auf Französisch. Ihre Muttersprache, die genau genommen die Sprache ihres Vaters ist, kommt von tief innen, ihre Stimme ist weich und vibriert in ihrem Brustkorb. Der Wind und die Wellen ersticken den Klang nach wenigen Metern. Sie ruft noch einmal, diesmal auf Deutsch, mit kurzem A und scharfem S, und nun schneidet der Name durch die Elemente – militärisch. Eine Befehlstonsprache, wie Manon sie oft nennt.
Keine Antwort.
Thomas bleibt verschwunden.
Plötzlich fühlt sie sich nackt in ihrem Slip und dem Unterhemd. Sie überlegt, ob sie sich anziehen soll. Stattdessen legt sie sich den Schlafsack um die Schultern, steht auf und geht auf das Meer zu. Der Sand ist warm, nur wenn sie die Zehen hineinsteckt, spürt sie noch den kühlen Morgen vor dem Sonnenaufgang, als Thomas und sie ihr kleines Lager in der Bucht aufgeschlagen haben.
Erst jetzt fällt ihr auf, dass Thomas’ Kleidung nicht mehr auf dem großen Stein liegt. Er hat sich angezogen und ist gegangen.
Der Fleck am Horizont ist näher gekommen. Manon beschattet ihre Augen mit der flachen Hand, kneift sie gegen die Sonne zusammen. Und mit einem Mal ist da kein Fleck mehr, sondern das Boot. Es ist ein Schlauchboot. Dicht gedrängt sitzen Menschen darin, schwarze Männer, mit dunklen Jacken, Kapuzen und orangefarbenen Schwimmwesten. Die meisten von ihnen sind ihr abgewandt. Aber einer steht aufrecht und schwenkt etwas, das aussieht wie eine schwarze Fahne.
Eine Welle überspült Manons Füße und greift nach ihren Knöcheln. Manon erschrickt, macht einen Schritt zurück. Zugleich will sie nach vorn, will winken und rufen, auf einen Felsen klettern und sich bemerkbar machen. Sie will sich hinter den Klippen unter ihrem Schlafsack verstecken und die Luft anhalten. Sie will sich ins Meer stürzen. Sie will zur Straße rennen, Hilfe holen, will fliehen.
Sie will, dass Thomas endlich zurückkommt.
»Thomas! Thomas!«
Sie steht hinter einem der großen Felsen und schaut hinauf zu der Steilküste. Sie sucht den Weg ab, den sie am frühen Morgen von der Straße gekommen sind. Aber Thomas ist nirgendwo zu sehen. Als sie sich wieder dem Meer zuwendet, ist das Boot verschwunden, und einen Moment lang glaubt sie, sie hätte sich das alles nur eingebildet. Dann taucht das Boot kurz noch einmal auf. Sie erkennt, dass es sich bei der Fahne um eine Jacke oder ein Sweatshirt handelt. Die beiden Ärmel sind an einem Ruder festgebunden, der Rumpf bläht sich im Wind. Kurz darauf ist das Boot wieder aus ihrem Blickfeld verschwunden, verdeckt von der großen Felsformation, die die Bucht nach Osten hin einfasst.
Manon geht zu dem Stein, auf dem ihr Kleid und die Sandalen liegen, und zieht sich an.
Unschlüssig steht sie neben der Luftmatratze. Sie greift nach ihrem Handy. Thomas’ Mutter hat über den Familienchat ein Foto vom Frühstück geschickt. Léonie hat noch mehr Haare verfilzen lassen, ihr Lächeln ist gezwungen, es sagt: Ich hasse es, hier zu sein, vielleicht sogar: Ich hasse alles. Noahs Lächeln ist schief, offenbar hat er den Mund voll. Auf seinem Teller liegt ein angebissenes Schinkenbrötchen, eine Wespe sitzt darauf.
Sie wischt zu Thomas’ Nummer, ihr Daumen schwebt darüber. Aber sie kann sich nicht überwinden und tatsächlich darauf tippen.
Also lässt sie das Handy sinken und schaut erneut aufs Meer. Ein leerer Horizont, nur die Wellen und die Sonne, die auf ihnen glitzert.
Am liebsten würde sie sich auf die weiche Luftmatratze fallen lassen, in den Schlafsack kriechen und den Reißverschluss nach oben zuziehen.
»Manon!«
Sie dreht sich um.
Thomas kommt mit seinem kleinen Rucksack von Westen die Bucht entlang. Das Fleece hat er sich um die Hüften gebunden. Sein Gesicht ist gerötet, Schweiß glänzt auf seiner Stirn. Er lächelt.
»Ich wollte dich gerade anrufen«, sagt sie.
»Ich bin ein wenig über die Klippen geklettert.«
Etwas Jungenhaftes umspielt seine Augen, einen Moment lang sieht er aus wie Noah.
Sie will ihm von dem Boot erzählen, von den orangefarbenen Rettungswesten, dem im Wind geblähten Sweatshirt. Von ihrem Gefühl, helfen zu müssen und zugleich wegrennen zu wollen. Doch bevor sie die richtigen Worte findet, wühlt er in seinem Rucksack und hält ihr etwas hin.
»Schau mal!«
Im ersten Moment sieht sie den Schädel eines Tieres, einer Katze oder eines Marders. Dann erkennt sie, dass es sich um eine Muschel handelt. Eine Schneckenmuschel, weiß und erstaunlich groß.
»Für mich?«
»Ja.«
Seine Augen leuchten. Sie weiß nicht, was sie sagen soll. Er schenkt ihr oft etwas. Aber es ist Ewigkeiten her, dass er ihr etwas Gefundenes mitgebracht hat.
»Danke.«
Sie nimmt die Muschel, dreht sie in der Hand, die Oberfläche ist rau. Kleine Stacheln stehen in alle Richtungen. Einen Moment lang ist sie ganz ergriffen von dem Wunderwerk, das die Schöpfung hier vollbracht hat. Dann denkt sie an ein Spielzeug, das Thomas ihr vor ein paar Monaten aufs Bett gelegt hat – ein kleiner spitz zulaufender Vibrator mit Noppen.
»Ist das nicht herrlich?« Thomas schaut aufs Meer.
Manon denkt an das Gefühl des Alleinseins, als sie aufgewacht ist. Vor ihrem inneren Auge sieht sie noch einmal das Boot.
»Ja«, sagt sie.
Er tritt von hinten an sie heran und legt seine Arme um ihren Bauch.
»Das war schön vorhin«, sagt er. Sein Mund ist nah an ihrem Ohr.
Sie nickt. »Das fand ich auch.«
Es stimmt, es war tatsächlich schön, sehr schön sogar. Aber sobald sie es ausgesprochen hat, kommt es ihr vor wie eine Lüge.
Thomas drückt sich von hinten an sie heran. Sie umgreift die Muschel etwas fester.
»Am liebsten würde ich noch einmal auf die Matratze.« Seine Stimme ist sanft.
Sie muss ein Stöhnen unterdrücken, so schmerzhaft sind die Muschelstacheln an ihrem Handballen.
Thomas löst sich von ihr. »Ich spring kurz ins Meer, kommst du mit?« Er sagt es leicht, ohne jeden Vorwurf.
Sie schüttelt den Kopf. »Aber ich setze mich auf einen Felsen und schau dir zu.«
Er lächelt. »Das klingt gut.«
Obwohl Thomas nach wie vor schlank ist, hat er um die Hüfte etwas angesetzt: ein kleiner Schwimmring. Sein Schwanz ist noch leicht erigiert von der Berührung mit ihrem Hintern. Das Schamhaar ist grau geworden.
Er läuft bis zur Wassergrenze und lässt seine Füße von den Wellen umspülen.
»Uh«, sagt er. »Kälter, als ich dachte.«
Er geht ein paar Schritte zurück, schiebt seine Fußsohlen in den Sand, stellt sich in eine Art Startposition.
Manon hebt den Arm. »À vos marques!«
Thomas macht einen übertrieben fokussierten Gesichtsausdruck und stützt seine Hände mit abgespreizten Fingern in den Sand.
»Prêts!«, sagt sie.
Thomas reckt seinen nackten Hintern in die Höhe. Seine Hoden baumeln zwischen den Beinen. Manon muss lachen, es kommt von tief innen. Sie verzögert, verharrt in dem Gefühl. Dann holt sie tief Luft und sagt: »Et … par…tez!«
Sie lässt den Arm fallen. Thomas rennt los. Sein Schwimmring bebt. Sein Schwanz tanzt willenlos hin und her, fliegt links und rechts gegen die Hüfte und nach oben in Richtung Bauchnabel. Manon will weiter lachen, aber das Komische ist verschwunden.
Als Thomas den Ausläufer einer Welle erreicht und das kühle Wasser seinen Bauch berührt, schreit er. Noch drei, vier Schritte gegen die Strömung, dann taucht er mit einem Hechtsprung unter und schwimmt davon.
Von ihrem Felsen aus schaut Manon in die Richtung, in der das Boot verschwunden ist, doch sie ist nicht hoch genug, um die nächste Bucht und den weiteren Küstenverlauf sehen zu können. Thomas schwimmt auf dem Rücken, die Wellen schwappen ihm ins Gesicht. Er lacht und winkt ihr zu. Sie winkt zurück.
Wieder muss sie an Noah denken. Und dann an Léonie. Daran, wie sie mit ihr in einem nach Chlor stinkenden Hallenbad beim Babyschwimmen waren: Thomas auf dem Rücken, Léonie auf seiner behaarten Brust, die damals noch nicht grau war.
Vor vierzehn Jahren.
Eine halbe Ewigkeit.
Und doch erst gestern.
Erst jetzt bemerkt Manon, dass sie die Muschel noch in ihrer Hand hält. Sie überlegt, sie ins Meer zu werfen, dorthin, wo sie hergekommen ist, wo sie hingehört. Sie verlagert ihr Gewicht, streckt ihren Arm nach hinten und holt aus. Dann denkt sie an das Leuchten in Thomas’ Augen und bricht die Bewegung ab.
Hinter den Klippen haben die Wellen noch keine Richtung. Sanfte Hügel und breite Täler, die sich scheinbar ziellos hin und her bewegen.
Thomas krault inzwischen. In seinen Bewegungen erkennt man den geübten Schwimmer: die gestreckten Füße, die so gleichmäßig paddeln, als wären sie an der Hüfte aufgezogen worden. Die Arme, die in stoischer Ruhe ihre Kreise ziehen, die gestreckten Hände, die seitlich eintauchen und dann gedreht werden, damit sie so viel Wasser verdrängen wie möglich. Vor allem aber der Kopf, der immer zwei Armrunden unter Wasser bleibt, bevor er zur Seite hin auftaucht, um dem Körper neuen Sauerstoff zuzuführen: zwei Arme, rechts, zwei Arme, links, zwei Arme, rechts – unerschütterlich wie ein Uhrwerk. Sie erinnert sich daran, wie sie Thomas das erste Mal schwimmen sah, in einem Brandenburger See, vom Ufer aus, ein paar Tage nachdem sie zusammengekommen waren, vor einundzwanzig Jahren.
Damals wusste sie noch nicht, dass er seine ganze Jugend über im Verein gewesen war: Leistungsschwimmen, viermal die Woche Training, Wettkampf, deutsche Jugendmeisterschaft und Olympiaträume. Und sie wusste erst recht nichts von seiner Kiste mit den Medaillen und Urkunden, die es auch heute noch gibt. Die all ihre Umzüge überstanden hat und nun auf dem Dachboden ihres Landdomizils in der Uckermark gelandet ist.
Damals war sie nur erstaunt, wie selbstverständlich er sich im Wasser bewegte. Und vor allem war sie angezogen von seinem Körper, der schmalen, schlanken Hüfte, aus der rechts und links die Knochen herausragten. Die kräftigen Schultern ohne sichtbare Blätter. Er hatte klar definierte Muskeln, die nicht hart und knotig wirkten, sondern weich und dehnbar, weil sie nicht durch das Gewicht von Hanteln oder gegen den Widerstand von Trainingsmaschinen entstanden waren, sondern im Wasser – in diesem wundervollen, rätselhaften Element, über dem in der Genesis der Geist Gottes schwebt.
Thomas ist nun im offenen Meer.
Manon überlegt, ob er von dort das Boot sehen könnte. Wenn es noch zu sehen ist. Wenn es überhaupt jemals zu sehen war.
Hat es denn ein Boot gegeben?
Ja, natürlich!
Auf einmal ergreift sie eine Unruhe. Sie hat genug vom Strand, dem Wind, den Wellen. Sie steigt von der Klippe und geht zu der Luftmatratze, öffnet das Ventil und packt die Sachen zusammen. Sie drückt und faltet die Matratze. Sie kniet darauf, presst die letzte Luft mit den flachen Händen heraus.
Sie verstaut die Matratze zusammen mit der Standpumpe in der grauen Tasche.
Zwei
Sie sitzen im Auto. Die Klimaanlage läuft, es ist angenehm kühl, während draußen die Hitze flirrt. Manon hört ein Flugzeug – nicht weit von ihnen brennt der Wald. Bei ihrer Anreise vier Tage zuvor haben sie die Rauchwolken gesehen. In den Nachrichten ist immer wieder von der Trockenheit die Rede, die noch schlimmer sei als in den Jahren zuvor. In dem Wald, in dem ihr Dorf liegt, regnet es im Oktober normalerweise regelmäßig, es müsste viel Nebel geben, der vom Meer herkommt. Aber in diesem Jahr ist es zu trocken. So wie in vielen anderen Regionen der Welt auch.
In Deutschland war es bereits kühl, es hatte sogar ein paar Tage lang geregnet. Doch auf ihrer Fahrt von Heidelberg nach Lyon wurde es schon vier oder fünf Grad wärmer, und als sie am nächsten Tag in Barcelona ankamen, war plötzlich Hochsommer, dreißig Grad und eine Trockenheit, die selbst Spanien so nur selten erlebt hat.
Manon entdeckt eine rote Stelle an Thomas’ linkem Handgelenk und wundert sich, dass sie ihr erst jetzt auffällt.
»Was ist mit deinem Arm?«, fragt sie.
»Aufgeschürft. Beim Klettern über die Klippen.«
Er sagt es, als ob es sich bei ihrem Strandausflug um ein Sportevent gehandelt hätte, um einen Wettbewerb und nicht um einen Programmpunkt im Rahmen ihres Beziehungscoachings.
»Hat das nicht gebrannt im Meer?«
»Ein bisschen. Aber Salzwasser ist gut. Es desinfiziert.«
Manon spürt Thomas’ Stolz auf seine Männlichkeit. Es ist eine Haltung, die sie seit vielen Jahren von ihm kennt, die aber seit ihrer Beziehungskrise deutliche Risse bekommen hat. Sie ist ein wenig lächerlich, aber nicht unsympathisch. So war er schon immer, von Anfang an. Und wenn ihr sein Stolz in diesem Moment nicht so unpassend erscheinen würde, könnte sie sich vielleicht sogar darüber freuen. Der alte Thomas, ein Stück Normalität.
Thomas fährt mit beiden Händen am Lenkrad. Er hat es sich angewöhnt, seit sie den neuen Wagen haben. Vor dem Kauf hat er ihr die Verbrauchsdaten vorgelegt: Von ihrer Wohnung im Prenzlauer Berg bis zu ihrem Haus in die Uckermark braucht der Skoda Octavia Hybrid bei voller Akkuladung gerade einmal 1,8 Liter, was einem Ausstoß von 35 Milligramm CO2 entspricht. »Weniger CO2 geht nicht!«, hat Thomas gesagt, und sie hat geschwiegen. Erstens, weil sie den alten Mercedes so gern mochte, und zweitens, weil sie jedes Milligramm CO2 zu viel findet und am liebsten gar kein Auto mehr hätte. Aber natürlich weiß sie, dass sie ein Auto brauchen.
Anfangs hat sich Thomas über das Lenkrad noch lustig gemacht: »Ein Lenkrad mit Heizung! Was für ein Schwachsinn!« Aber als es Ende September in Berlin kühl wurde, hat er es ausprobiert und zugeben müssen, dass es recht angenehm ist. Manon weiß nicht mehr genau, ob er erst seitdem mit beiden Händen am Lenkrad fährt oder ob er es schon vorher getan hat. Sie weiß nur, dass er in dem alten Mercedes Kombi, den sie fünfzehn Jahre lang gefahren sind, immer nur eine Hand am Lenkrad hatte und manchmal gar keine, weil er stattdessen mit den Oberschenkeln gelenkt hat.
Manon hat den Mercedes als Teil der Familie geliebt. Sie mochte seine freundlichen Augen und die Rücklichter, mochte den grünen Lack und die glänzenden Chromleisten. Sie mochte es, die Scheiben herunterzukurbeln, etwas dafür zu tun, damit etwas passiert. Der Mercedes war eine kleine, verständliche analoge Welt. Der Skoda ist ein digitales Rätsel: Er hängt an einer Cloud, empfängt und sendet unablässig Daten, und wenn er zur Werkstatt muss, wird nicht einmal mehr die Motorhaube geöffnet, sondern ein Laptop angeschlossen, um etwaige Fehler auszulesen.
Vor allem mag Manon die Erinnerungen, die an dem Mercedes hängen. Zu zweit mit einem Zelt an der Kurischen Nehrung, mit der schreienden Léonie im Kindersitz an der Loire, zu viert an einer Landstraße in der Toskana, nachdem Noah sich übergeben hat. Mit dem Skoda verbindet sie noch nichts, außer die immer gleichen Ausflüge in die Uckermark und nun diese Fahrt hier nach Spanien.
»Wollen wir Musik hören?« Thomas’ Haare sind noch feucht. Sie sehen dadurch dunkler aus, beinahe so, als hätte er sie getönt. Er hat nach wie vor dichtes Haar, das er länger trägt als die meisten Männer in seinem Alter. Es steht ihm. Es lässt ihn jünger aussehen.
»Lieber nicht«, sagt sie. Sie schaltet die Klimaanlage aus und öffnet das Fenster. Die warme Luft drückt herein. Sie streckt die Hand hinaus, der Fahrtwind spreizt ihre Finger. Nach einer halben Minute schließt sie das Fenster, und sofort stellt Thomas die Klimaanlage wieder an.
»Ich habe ein Boot gesehen«, sagt sie.
Er wendet sich ihr zu, abrupt, beinahe ruckartig. Eine seltsame Bewegung, die sie sich nicht erklären kann.
»Was für ein Boot?«, fragt er.
Manon schweigt. Sie möchte sagen, dass es ein Fischerkahn war und Möwen darüber gekreist sind. Dass dieses Boot sie an einen Urlaub mit ihrer Mutter und ihrem Vater am Atlantik erinnert hat, als sie fünf Jahre alt war. Den letzten gemeinsamen Urlaub, bevor ihre Mutter gestorben ist, und dass dieser Anblick sie traurig gemacht hat.
»Es war ein Flüchtlingsboot«, sagt sie.
»Ein Flüchtlingsboot?«
»Ja.«
Thomas Hände umklammern das Lenkrad. Es kommt ihr vor, als ob er sich daran festhält.
»Wie kommst du darauf?«, fragt er.
»Was meinst du?«
»Dass es ein Flüchtlingsboot war.«
»Wie ich darauf komme? Es war ein schwarzes Schlauchboot. Und es saßen Menschen darin. Männer. Mit Rettungswesten. Einer von ihnen hatte eine Art Fahne in der Hand.«
»Vielleicht war es nur ein Ausflugsboot. Whalewatching. Delfine. Solche Touren werden hier überall angeboten.«
Unwillkürlich wechselt sie in die Sprache ihres Vaters. Auch weil sie weiß, dass Thomas es nicht mag, wenn sie Französisch mit ihm spricht. »Tu ne m’écoutes pas! Je te dis que c’était un zodiac! Et il y avait une trentaine de personnes à bord! Et un type qui tenait comme un drapeau!«
»Aber vielleicht gibt es irgendeine andere Erklärung dafür.«
»Warum glaubst du mir nicht?«
»Ich glaube dir ja, aber …«
»Wenn du es gesehen hättest, würdest du bestimmt nicht sagen, dass es eine andere Erklärung gibt.«
Er starrt auf die Straße. »Und warum erzählst du mir das erst jetzt?«
Sie schweigt. Die Kälte der Klimaanlage ist ihr unangenehm. Sie mag das Prinzip nicht: eine kleine, künstlich heruntergekühlte Welt inmitten einer großen, viel zu heißen. Sie muss wieder an die Waldbrände denken. An die Trockenheit. An den Klimawandel. An die große Krise, in der sich die Menschheit befindet. Und an die private Krise, die Thomas und sie an diesen Ort geführt hat und von der sie nicht sagen kann, ob sie groß oder doch eher klein ist.
»Manon?«
»Ja.«
»Ich habe dich etwas gefragt.« Thomas’ Stimme ist nun wieder weich. Das Verständnis ist zurückgekehrt. Oder war es die ganze Zeit da, und sie hat es nur nicht hören wollen?
»Was?«
»Warum hast du mir das von dem Boot nicht vorhin erzählt?«
»Ich … weiß es nicht. Es hat irgendwie … nicht gepasst.«
Er schweigt einen Moment lang. Schüttelt dann den Kopf und seufzt. »Ich dachte, wir wollten offener miteinander sein.« Seine Stimme ist nach wie vor weich, aber auf eine unangenehme Weise auch väterlich.
Sie wendet sich ihm zu, sieht ihn von der Seite an. Er dreht den Kopf, kurz treffen sich ihre Blicke, und wie so oft ist sie erstaunt darüber, wie hell seine Iris ist. Regenbogenhaut, hat ihre Großmutter dazu gesagt.
Dann ist der Moment vorbei, Thomas schaut wieder nach vorn auf die Straße.
»Warum hast du mich allein gelassen?«, fragt sie.
»Was?« Ein erneuter Seitenblick. Gerade lang genug, dass sie darin das Unverständnis sieht, die Verwunderung.
Sie schweigt.
»Was meinst du?«, fragt er. »Wann?«
Er weiß es wirklich nicht. Sie sieht es an seinem Gesicht, hört es an seiner Stimme. Sie hat damit gerechnet, dass er sich ertappt fühlt, die Situation herunterspielt. Aber dass er wirklich nicht weiß, wovon sie spricht, schockiert sie dann doch. Er hat sie allein gelassen, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken.
Sie schweigt weiter, hat keine Lust, das Offensichtliche auszusprechen, es ihm vorzukauen.
»Meinst du vorhin, am Strand?« Wieder ist da dieses Väterliche in seiner Stimme. In der Art, wie er fragt, offenbart sich seine Haltung. Ihr Gefühl ist kindisch. Es ist irrational, übertrieben, so wie sie immer alles übertreibt.
»Ja«, sagt sie.
»Du hast geschlafen. Ich wollte dich nicht wecken. Aber ich wollte mich ein wenig bewegen. Den Strand erkunden. Es tut mir leid, wenn du dich allein gelassen gefühlt hast.«
Allein gelassen gefühlt.
Sie will ihm widersprechen. Will ihm sagen, dass es eine Bedeutung hat, wenn er plötzlich einfach weg ist. Ein Jahr lang hatten sie keinen Sex, seit fünf Jahren ist körperliche Intimität – ja, überhaupt jede Intimität – ein Reizthema zwischen ihnen. Sie sind deswegen zu Beziehungsberatungen gegangen und waren mehrfach kurz davor, sich zu trennen. Es ist der Grund, warum sie hier sind. Und nun hat sich dieser Knoten einmal gelöst, das erste Mal seit Ewigkeiten waren sie sich nah, wirklich nah, und dann ist Thomas einfach verschwunden. Wie kann er denken, dass das keine Bedeutung hat?
Im selben Moment kommt sie sich albern vor. Thomas ist aufgewacht, sie hat geschlafen, er wollte sich bewegen. Er hat recht. Er kann nichts dafür, dass sie sich allein gefühlt hat. Und für das Boot kann er auch nichts.
»Manon?«
Sie wendet sich ihm zu.
»Hast du gehört, was ich gesagt habe?«
Sie nickt.
Die Sonne wirft Stroboskopflecken durch die Fenster. Ein Bild wie aus einer Autowerbung: ein neuer silberner Wagen auf einer gewundenen Straße in einem Zauberwald. Im Reiseführer hat sie gelesen, dass es sich bei dem Wald um einen der letzten natürlichen Mischwälder in Südspanien handelt: Hier gibt es bis zu 25 000 verschiedene Pflanzenarten, gut viermal so viele wie im übrigen Europa. 13 000 von ihnen sind endemisch. Zwischen Pinien, Steineichen, Korkeichen und Eschen wachsen unzählige Kräuter, Farne und Hülsenfrüchte. Im Herbst sprießen die Pilze. Tatsächlich war der Wald neben den wunderschönen Fotos des Dorfs und den begeisterten Berichten von den Coaching-Erfolgen – »Jahrelang haben wir alles versucht, um unsere Beziehung wiederzubeleben, dann kamen die Tage bei Professor Blumberg und haben uns gerettet!« – einer der Hauptgründe, warum Manon sich zu diesem Trip durchgerungen hat. Der Wald hat etwas Urtümliches, ein großer in sich abgeschlossener Organismus. In den vergangenen Jahren hat sie mehrere Bücher über das Zusammenleben der Bäume gelesen, über die Gemeinschaft, die sie bilden, und die Art, wie sie miteinander kommunizieren. Über das, was manche die Seele der Bäume nennen. Es hat etwas Beruhigendes für Manon, dass außerhalb der menschlichen Gemeinschaft, die so viel von der Umwelt zerstört und dabei sich selbst zu zerstören droht, Welten existieren, die vollkommen autark sind. Mehrmals war Manon in den vergangenen Tagen im Wald spazieren, und jedes Mal hatte sie dieses befreiende Gefühl: Die Menschen sind nicht so wichtig, wie sie sich nehmen. Die Welt wird ohne sie weiterexistieren.
Doch nun hat sie am Strand ein Flüchtlingsboot gesehen, und die Menschen haben sich wieder in den Vordergrund gedrängt – so wie sie sich immer in den Vordergrund drängen.
»Was glaubst du, was mit den Leuten geschieht?«
Er schaut sie fragend an.
»Ich meine die Menschen auf dem Boot, das ich gesehen habe.«
»Du meinst, wenn es wirklich ein Flüchtlingsboot war?«
Manon spürt, wie eine heiße Welle aus ihrem Bauch über ihr Zwerchfell in ihren Kopf schwappt. Am liebsten würde sie ihm ins Gesicht schlagen. Seine Hände vom Lederlenkrad reißen und ihm die Fingernägel in den Hals graben.
»Mais je te dis que c’était un bateau de migrants, j’en suis sure!«
Er zuckt mit den Schultern und schiebt die Unterlippe nach vorn. Sie kennt diese Mimik gut: abwiegeln, herunterspielen, rationalisieren.
»Entweder sie werden in ein Auffanglager gebracht, oder sie schaffen es über die Straße ins Hinterland.«
Hinterland, l’hinterland auf Französisch, ein seltsames Wort. Manon ist davon überzeugt, dass sie es noch nie aus Thomas’ Mund gehört hat. Warum benutzt er dieses Wort? Für sie klingt es hart, unbarmherzig, militärisch – wie so viele Wörter, die es von ihrer Mutter- in ihre Vatersprache geschafft haben: l’aurochs, la blitzkrieg, le waldsterben.
»Hinterland«, wiederholt sie. »Du meinst also hierher. In den Wald.«
»Ja«, sagt er. »Vielleicht.«
Die Straße steigt deutlich an. Manon spürt den Druck auf den Ohren. Sie muss an den Strand denken, den Sonnenaufgang, daran, wie Thomas und sie sich geküsst haben. Jede Berührung hatte einen Hallraum, der die vielen Jahre, die sie miteinander verbracht haben, umfasste. Alles hat sich gut angefühlt, schön, richtig. So, wie sich schon die gemeinsame Fahrt nach Spanien gut, schön und richtig angefühlt hat. Trotz aller Hindernisse. Oder genau deswegen. Die Autobahn mit ihren vielen Baustellen. Die unfreundlichen Menschen an den deutschen Raststätten, die etwas freundlicheren Franzosen. Die Nacht in Lyon in einem Hotelzimmer, dessen Fenster auf einen Innenhof mit stinkenden Mülltonnen hinausging. Das Frühstück in Barcelona, für das sie über vierzig Euro bezahlen mussten. Die viel zu volle Küstenstraße am Mittelmeer und schließlich die lange Suche nach dem kleinen, abgeschiedenen Ort in den Bergen, in dem sie die kommenden zehn Tage verbringen würden.
Der Leiter des Coachings, Professor Blumberg, wirkte bei seiner kleinen Begrüßungsrede wie eine Mischung aus einem dementen Naturwissenschaftler und einem buddhistischen Eremiten, der zur Feier des Tages Kokain gezogen hatte. Immerhin machte ihn das auch irgendwie sympathisch, was man von den anderen Paaren nicht unbedingt sagen konnte. Bei dem anschließenden Abendessen stießen Manon und Thomas sich unter dem Tisch mit den Füßen an. Thomas starrte Manon mit weit aufgerissenen Augen an, ein Blick, der Schock signalisieren sollte und den Wunsch, im Boden zu versinken. Manon musste sich auf die Lippe beißen, um nicht laut loszulachen. Sie aßen, tranken und warfen sich weitere Blicke zu. Der gesamte Abend hatte einen doppelten Boden. Alles war Theater, Satire; eine überdrehte Komödie, die in einem Dorf am Ende der Welt spielte, in dem lauter verzweifelte Paare ohne finanzielle Sorgen zusammengekommen waren, um sich von einem verrückten Guru retten zu lassen.
Dieser erste Abend war schrecklich, und zugleich war er wundervoll. Nur selten hat Manon sich Thomas in den vergangenen Jahren so nah gefühlt, so verbunden. Es gibt einen Grund, warum sie zusammen sind. Und dieser Grund ist, dass sie einen ähnlichen Blick auf die Welt haben, das gleiche Empfinden.
Nach dem ersten Abendessen sind Thomas und sie Hand in Hand zu ihrem Haus gegangen. Manon war betrunken, sie stolperte über das alte, grobe Kopfsteinpflaster und landete in Thomas’ Armen. Er lachte, und sie küsste ihn auf den Hals.
In den Monaten zuvor hatten solche kleinen Annäherungen – wenn es sie überhaupt gegeben hatte – dazu geführt, dass Thomas mehr wollte, dass er sie sofort bedrängte. Und wenn sie es ihm verweigerte – und sie verweigerte es ihm immer –, zog er sich sofort zurück. Aber an diesem Abend, wie auch schon an den Abenden zuvor, drängte er nicht. Kein Blick, der signalisierte, dass er mit ihr schlafen wollte. Es nicht nur wollte, sondern es brauchte. Ja, mehr noch: dass er ein Recht darauf hatte!
Noch über eine Stunde saßen sie auf ihrer Terrasse in dem Steingarten, tranken mehr Wein und wurden noch betrunkener. Sie unterhielten sich, lästerten über die anderen Paare und über Professor Blumberg. Gleichzeitig schwärmten sie von dem Haus, von dem Dorf, dem Wald und dem wunderschönen Ausblick.
»Allein dafür lohnt es sich!«, sagte Thomas. »Dann machen wir eben einfach nur Urlaub! Scheiß auf das Coaching!«
So verliefen auch die beiden folgenden Tage und Abende – frei und offen. Ohne jeden Druck, ohne Forderungen. Und es passierte etwas Seltsames: Je häufiger sie Professor Blumberg sah, desto weniger guruhaft kam er Manon vor. Und je mehr Zeit sie am Pool verbrachte, desto weniger peinlich schienen ihr die anderen Paare. Sie mochten aus anderen Welten stammen, andere Interessen haben. Aber entscheidend war, dass sie alle ähnliche Probleme hatten: zu wenig Sex, zu wenig Respekt, zu wenig Kommunikation – oder zu viel Kommunikation mit den falschen Worten und über die falschen Themen. Vor allem aber keine Achtung mehr vor dem anderen. Genau wie sie und Thomas.
Soweit sie es beurteilen kann, geht es Thomas genauso. Zwar lästern sie immer noch über die anderen, aber längst nicht mehr mit der Schärfe des ersten Abends. Wenn sie sich heimlich Blicke zuwerfen, während Professor Blumberg eine seiner pathetischen Ansprachen hält, dann sind sie von einem milden Lächeln begleitet.
Im Rückblick kommen Manon die vier Tage, seitdem sie hier sind, vor wie mehrere Wochen – die Übernachtung bei ihren Schwiegereltern und der Abschied von ihren Kindern liegen so weit in der Vergangenheit, dass sie sich kaum noch daran erinnert.
Und nun haben Thomas und sie miteinander geschlafen. Das erste Mal seit über einem Jahr, eine Zeitspanne, die ihr vorkommt wie ein halbes Leben. Und danach hat Thomas sie allein gelassen. Und sie hat das Boot gesehen. Das Boot mit den Flüchtlingen.
Sie wendet den Kopf. Thomas schaut sie kurz an, blickt wieder nach vorn auf die Straße. Sie hat einen Gedanken, der inzwischen zu einem Reflex geworden ist, zu einer Art innerem Zwang: Thomas und Léonie haben exakt die gleichen Ohren, genau die gleiche Form. Und genauso reflexhaft folgt der nächste Gedanke: Was, wenn alles nur Genetik ist? Wenn die Menschen seit vierzigtausend Jahren in ihren Genen gefangen sind und der Glaube an die Möglichkeit einer Entwicklung nur Erfindung ist, Einbildung, ein Narrativ? Ein zwanghafter Gedanke führt zum nächsten. Es folgt die Klimakrise. Der ökologische Suizid, den die Menschheit im Begriff ist zu begehen. Und schließlich denkt sie an Gott. Dass all das ohne Gott nicht zu ertragen ist. Es gibt keine Wirklichkeit außerhalb des Menschen, denkt Manon. Mit anderen Worten: Wenn der Mensch Gott braucht, um zu überleben, dann gibt es Gott auch. Ganz einfach.
»Manon?«
»Ja.«
»Hast du gehört, was ich gesagt habe?«
»Ja … Das heißt, nein. Entschuldige.«
Sie sieht den Unmut in Thomas’ Gesicht, und einen Moment lang ist sie davon überzeugt, dass er genau weiß, woran sie gedacht hat – an die Klimakrise und an Gott –, und dass er ihr Vorwürfe deswegen machen wird. Aber dann entspannen sich seine Gesichtszüge wieder.
Er setzt den Blinker und bremst.
Zwei Motorräder überholen sie, Jugendliche auf Geländemaschinen, die ohne Erlaubnis auf den Sandwegen des Naturschutzgebiets Rennen veranstalten. Sobald sie an ihnen vorbei sind, fahren sie auf dem Hinterrad, vermutlich dankbar, Publikum gefunden zu haben.
Thomas steuert den Wagen auf eine Ladestation zu. Er stellt den Motor aus und wendet sich ihr zu. »Ich habe dich gefragt, was du davon hältst, wenn wir ein bisschen spazieren gehen. Vor dem Essen haben wir noch eineinhalb Stunden.«
Sein Blick ist freundlich, weich, und obwohl sie müde ist und sich am liebsten kurz hinlegen würde, nickt sie und sagt: »Okay.«
Drei
Sie gehen den Weg, der auf den Bergkamm führt. Er ist steil, steinig und von Wurzeln überwuchert. Die kleinen stacheligen Blätter der Korkeichen werfen Schatteninseln. Thomas trägt eine Sonnenbrille und hat sich die Ärmel seines T-Shirts hochgekrempelt, und wenn sie den etwas schlaff gewordenen Trizeps und die faltigen Ellbogen ausblendet, sieht er von schräg hinten aus wie Mitte zwanzig. Wie immer geht er voraus. Egal, wie schnell sie läuft, Thomas muss mindestens einen Schritt vor ihr sein. Viele Jahre hat Manon dieses Vorauseilen als eine seiner Marotten abgetan, ähnlich wie den regelmäßigen Griff an sein rechtes Ohrläppchen, während er zuhört, die ständige Fussel- und Krümelsuche auf seiner Kleidung oder seine Symmetrie-Sucht. Doch inzwischen weiß sie, dass es um mehr geht, um sie beide, um ihre Beziehung. Er muss ihr mindestens einen Schritt voraus sein, denn wenn er es nicht ist, verliert er die Kontrolle. Manon hatte früher kein Problem mit diesem zwanghaften Vorausgehen. Im Gegenteil: Sie empfand es als beschützend. Er würde alles Gefährliche, was auf sie zukommt, abfangen, es würde von ihm abprallen. Doch inzwischen hat sich ihre Sichtweise geändert. Thomas geht nicht mehr voraus, er versperrt ihr den Weg, steht zwischen ihr und der Welt. Er will sie nicht beschützen, er will verhindern, dass sie ihre eigenen Erfahrungen macht.
Manche der Bäume sind an den Stämmen nackt. Im Reiseführer hat Manon gelesen, dass die Rinde der Eichen alle neun bis zehn Jahre zur Korkgewinnung geerntet wird und in den folgenden zehn Jahren nachwächst. Angeblich schadet das den Bäumen nicht, aber wenn Manon sie so nackt dastehen sieht, hat sie Zweifel, ob das wirklich stimmt. Es muss doch einen Grund geben, warum die Evolution den Bäumen eine so dicke Rinde verliehen hat. Ganz bestimmt nicht, damit die Menschen ihre Häuser und Millionen Wein- und Champagnerflaschen damit dämmen und verkorken können. Vielleicht empfinden die Bäume Schmerz, wenn die Rinde im Hochsommer mithilfe von großen Beilen von den Stämmen gelöst wird. Und tatsächlich sehen sie ohne Rinde rosa und schutzlos aus. Bis zu zweihundert Jahre alt sind sie – wenn sie Pech haben, wird ihnen also zehnmal im Leben die Haut vom Körper gezogen.
»Hast du das Foto gesehen, das meine Mutter geschickt hat?«
Thomas hat sich ein wenig zurückfallen lassen. Er geht nun fast neben ihr. Als sie über eine Wurzel steigen, berühren sich ihre Schultern.
Manon schaut ihn fragend an. Sie braucht einen Moment, um wieder in der Gegenwart anzukommen.
»Das Frühstücksfoto.« In Thomas’ Stimme liegt Ungeduld.
Nun hat sie es wieder vor Augen. Die Wespe und Léonies miese Laune. »Ja«, sagt sie. »Ich habe sofort ein schlechtes Gewissen bekommen, dass wir sie dagelassen haben.«
Unwillig schüttelt Thomas den Kopf. »Ach, Unsinn! Die werden schon ihren Spaß haben.« Sie laufen genau auf einer Höhe. »Aber ich finde es unglaublich, was für schlechte Fotos meine Mutter macht. Sie legt so viel Wert auf Ästhetik, aber sobald sie etwas mit ihrem Smartphone ablichtet, ist ihr das Ergebnis vollkommen egal.«
»Das stimmt«, sagt Manon. Dabei ist sie sich gar nicht sicher, ob es wirklich stimmt, was er sagt. So, wie sie ihre Schwiegermutter kennt, gefallen ihr diese Fotos, schon allein, weil sie eine gute Schärfentiefe und kräftige Farben haben: eine glatte Oberfläche. In diesem Sinne sind sie das Äquivalent zu ihrem Ordnungszwang. Manon überlegt, ob sie den Gedanken äußern soll, aber sie weiß aus Erfahrung, dass Thomas empfindlich reagiert, wenn jemand anderes als er selbst etwas Kritisches über seine Mutter sagt. Vor allem, wenn Manon diese andere ist.
Manchmal kommt es ihr vor, als wäre Thomas von einem tief sitzenden Ödipuskomplex betroffen: der Todeswunsch gegenüber dem Vater und eine blinde Hinwendung zur Mutter. Wenn er über seine Kindheit und Jugend spricht, ist sein Vater immer der Unsensible, der Strenge, der Verhinderer. Er ist derjenige, der ihn nie gesehen hat und der ihn bis heute nicht sieht. Seine Mutter hingegen ist die Sanfte, Empathische, Liebende. Diejenige, die ihn im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützt und gefördert hat und ihrerseits unter dem Vater leidet.
Wenn Manon sich zwischen Thomas’ Vater und seiner Mutter entscheiden müsste, würde sie auf jeden Fall den Vater wählen. Er ist bei aller Strenge und Unsensibilität geradeheraus, wohingegen ihr die Mutter oft falsch vorkommt, kalkulierend, aufs Äußerliche bedacht. Das entspricht ihrem Sinn für Ästhetik: Die Oberfläche muss stimmen. Und wenn sie nicht stimmt, wird sie nervös, ja bösartig.
Vor ihnen verläuft der Weg in einer scharfen Linkskurve. Thomas ist stehen geblieben. Er holt seine Flasche aus dem Rucksack und trinkt. Anschließend hält er sie Manon hin, die erst jetzt bemerkt, wie durstig sie ist. Sie nimmt mehrere Schlucke und reicht ihm die Flasche zurück. Die Sonne steht direkt über ihnen. Manon hat das Gefühl, die Trockenheit mit allen Sinnen zu erspüren. Die Hitze dörrt alles aus, die Nacktheit der Bäume verstärkt diese Empfindung noch.
»Es ist wirklich unglaublich, wie viele solcher Fotos in jeder Sekunde gemacht und verschickt werden«, sagt Thomas.
Manon schaut ihn fragend an.
»Diese ganzen Familienfotos und WhatsApp-Bilder. Irgendwelche Erinnerungsschnappschüsse mit fünf Megabyte, die jahrelang auf externen Festplatten herumliegen oder die Cloud-Server verstopfen. Millionen und Abermillionen an Fotos, eines schrecklicher als das andere.«
»Ja«, sagt Manon, auch wenn sie die Entrüstung nicht recht nachvollziehen kann. Menschen sind eben maßlos, denkt sie. Und genauso, wie sie zu viel Fleisch essen, Wein trinken oder in der Weltgeschichte herumfliegen, machen sie eben Bilder. Menschen sind nicht vernünftig. So einfach und banal ist das.
»Diese ganzen Bilder sind reiner Datenmüll«, sagt Thomas, als ob er ihre Gedanken gelesen hat. »Kaum besser als der übrige Müll, den wir produzieren. Vielleicht sogar schlimmer.«
Manon ist anderer Meinung. Nicht die Bilder sind das Problem, sondern die Smartphones, mit denen sie gemacht werden. Nicht wegen der Geschmacklosigkeit der Menschen wird die Welt untergehen, sondern aufgrund von Bequemlichkeit und Gier.
Doch sie hat keine Lust auf eine Diskussion zu dem Thema und nickt deshalb nur unbestimmt.
»Am besten wäre es, wenn dieses ganze wahllose Fotografieren verboten wäre. Oder zumindest besteuert. Für jedes Selfie fünfundzwanzig Cent, dann wäre die Bilderflut bald eingedämmt.«
Nun fühlt Manon sich wie eine Studentin in einem von Thomas’ Seminaren über Fotoästhetik. Es fehlt nur noch, dass er von früher erzählt, von seiner Kindheit in den Achtzigerjahren, in denen die Negativstreifen und Fotos in Schuhkartons gelagert wurden.
Als sie sich kennenlernten, war Thomas für das Fotolabor in der Hochschule der Künste verantwortlich. Anfangs mochte sie ihn nicht, sie fand ihn spießig. Pedantisch. Humorlos. Dazu arrogant. Kurz gesagt: durch und durch deutsch. Eigentlich fand sie ihn genau so, wie sie ihn an schlechten Tagen auch heute noch findet. Während eines Fotoprojekts, bei dem Manon sich in den Kopf gesetzt hatte, eine ehemals sowjetische Billigkamera mit einem Fischaugenobjektiv und einer speziellen Bildästhetik in einem Schaumstoffball aus dem Fenster zu werfen und im Flug Fotos zu machen, folgte Phase zwei. Thomas unterstützte sie bei dem Projekt weit über seine eigentlichen Aufgaben im Labor hinaus. Er beriet sie. Half ihr. Kaufte mit ihr Schaumstoffbälle und schnitt Löcher hinein. Er stellte sich unten auf die Straße, um die Bälle aufzufangen, die sie aus dem Fenster warf, half ihr, den Selbstauslöser anzubringen. Aber vor allem half er ihr bei der Vergrößerung der Bilder. Und plötzlich lernte sie die andere Seite der Spießigkeit kennen. Thomas war zuverlässig. Verbindlich. Freundlich. Er war an ihr interessiert. Ganz anders als die egomanen Kunststudenten, mit denen sie sonst ihre Zeit verbrachte. Er strahlte in allem, was er tat, eine unglaubliche Sicherheit aus.
Sie verbrachten viel Zeit zusammen in dem kleinen Labor. Das Rotlicht hatte etwas Betörendes, ebenso die Bewegungen von Thomas, die Ruhe und Sicherheit, die er in jeder Geste vermittelte. Es erregte sie, aber auf eine vollkommen unbekannte Weise: tiefer, als sie es in ihrem bisherigen Leben je verspürt hatte. In dem niedrigen, fensterlosen Raum mit den Wannen, Chemikalien und dem Vergrößerungsgerät, das in der Mitte aufragte wie ein Turm, baute sich eine seltsame Spannung auf. Und trotzdem kam es ihr lange so vor, als hätte Thomas an ihr als Frau überhaupt kein Interesse. Er war freundlich und hilfsbereit und überschritt nie irgendeine Grenze. Er war vollkommen anders als die Männer, mit denen sie sonst zu tun hatte. Kein auffordernder Blick, keine Berührung, kein: »Ich bin verrückt nach dir!« Einfach nur diese Handgriffe, die er ihr zuliebe ausführte und von denen jeder einen bestimmten Zweck verfolgte. Jede Bewegung war von einer unglaublichen Achtsamkeit geleitet. Wie er mit der Pinzette und dem Fotopapier in dem Entwicklerbad hantierte, wie er das Papier immer auf die gleiche Art und Weise drehte und darauf wartete, bis etwas zu sehen war. Wie er das Papier anschließend in das Stoppbad gleiten ließ und es am Ende in der Spülwanne langsam hin und her bewegte.
Manon fühlte sich eingeschüchtert und verunsichert. Viel verunsicherter als durch die direkten Aufforderungen, mit denen andere Männer sie konfrontierten. Einer Aufforderung gegenüber konnte sie sich verhalten. Sie konnte »Ja« oder »Nein« sagen oder auch »Vielleicht«. Aber diese Handgriffe, die nicht direkt ihr galten und doch nur ihr zuliebe vollzogen wurden, hatten etwas Verstörendes und zutiefst Erotisches.
Sie provozierte kleine Berührungen, und je mehr Berührungen es gab, ohne dass etwas daraus folgte, desto stärker erregte es sie. Irgendwann war sie fest davon überzeugt, dass Thomas tatsächlich kein Interesse an ihr hatte. Dass er womöglich asexuell war oder einer seltsamen Objektsexualität frönte – Rädchen, Schrauben, Objektive, Filmdosen –, bis er sie in der Dunkelkammer plötzlich packte, festhielt und küsste. Und dann brachen alle Dämme. Das kleine Metallregal kippte gegen die Wand, Fotopapier fiel zu Boden, Filme, sogar eine Kamera. Nur die Wannen mit dem Chemikalienbad und das Vergrößerungsgerät blieben zum Glück verschont.
Erst im Nachhinein erzählte Thomas ihr, dass er bereits seit Wochen an nichts anderes gedacht hatte, als mit ihr zu schlafen. Er sei wie von Sinnen gewesen, habe sich aber nicht getraut, den ersten Schritt zu machen. Sie habe ihn mit ihrer ganzen Art verunsichert, sie sei ihm ein Rätsel gewesen, ein Satz, über den Manon noch oft nachdachte, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. War das gut? Oder schlecht? Und was bedeutete es, dass Thomas ihr ebenso ein Rätsel gewesen war, bevor er sie plötzlich gepackt und geküsst hatte?
Die erste Zeit war wie ein Sturm, der alles durcheinanderwirbelte, und als Manons Projekt Im freien Fall – im Rückblick eine Arbeit, die ihr, wie so viele frühe Arbeiten, peinlich, ja pubertär vorkommt – einige Wochen später im Rahmen einer Sammelausstellung das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert wurde, waren sie ein Paar.
Inzwischen haben sie den Gipfel erreicht. Von hier aus kann man den gesamten Wald überblicken, Los Alcorncales, über 1600 Quadratkilometer groß. Sie schauen in Richtung Meer, das als silberner Streifen in der Ferne glitzert. Erneut denkt Manon an die Flüchtlinge, die mit ihrem Traum von einem besseren Leben in Europa jetzt vermutlich in einem der umzäunten Auffanglager gelandet sind. Nach einer monatelangen Hängepartie dürfen sie dann entweder bleiben, um für ein paar Euro pro Stunde in einem der riesigen Gewächshäuser, die sie bei Almeria von der Straße aus gesehen haben, Tomaten zu ernten, oder sie werden abgeschoben – nur damit sie es in ein paar Monaten noch einmal versuchen, auf einem neuen Boot, wieder mit dem Risiko, zu kentern und zu ertrinken.
»Schau mal da!« Thomas deutet in die Luft. Erst sieht Manon nichts, dann entdeckt sie einen Greifvogel, der über ihren Köpfen gleitet.
»Wow!«, sagt sie – etwas so Vollendetes wie das Schweben dieses riesigen Vogels hat sie selten gesehen. Seine Spannweite beträgt bestimmt ein Meter fünfzig, und die gefleckte Zeichnung sieht aus wie der Kopfschmuck eines Stammeshäuptlings.
Greifvögel gibt es auch in der Uckermark, wo sich ihr Landdomizil befindet, aber in der waldarmen Monokultur der ehemaligen LPG-Bewirtschaftung stimmt Manon der Anblick eher traurig.
Der Vogel macht einen Bogen und zieht seine Kreise, wobei er sich langsam in Richtung der Baumwipfel fallen lässt. Für ein paar Sekunden steht er, begleitet von einem seltsamen Rütteln, mit den Flügeln direkt über ihnen in der Luft, und Manon kann die einzelnen Federn sehen, seinen gebogenen Schnabel.
»Was ist das?«, fragt sie. »Ein Bussard?«
»Für einen Bussard ist er zu groß«, sagt Thomas. »Außerdem hat er diese ausgestellten Federn an den Flügeln. Es muss ein Adler sein. Im Reiseführer habe ich gelesen, dass es hier Schlangenadler gibt.«
»Schlangenadler?«
Thomas nickt.
»Ein schöner Name. Und sie ernähren sich tatsächlich von Schlangen?«
»Von Schlangen und Eidechsen. Sie sind reine Reptilienfresser.«
Wie so oft ist Manon beeindruckt von Thomas’ enzyklopädischem Wissen über die Natur, aber auch ein wenig gelangweilt und vielleicht sogar genervt. Es hat etwas Streberhaftes. Egal, was er liest, er merkt es sich, ob es sich dabei nun um die Gebrauchsweisung einer neuen Digitalkamera oder um ein Pilzbestimmungsbuch handelt.
Thomas wendet sich ihr zu. Er nimmt seine Sonnenbrille ab. »Es ist schön, dass wir hier sind«, sagt er.
Manon löst den Blick vom Himmel und schaut ihn an. Sie sucht in seinem Gesicht nach einem Hintergedanken, einer bestimmten Absicht. Zu oft hat er solche Sätze in den vergangenen zwei Jahren zu ihr gesagt und damit etwas anderes gemeint: Ich will mit dir schlafen. Lass uns Sex haben. Oder auch: Wenn du keinen Sex haben willst, dann findest du es offenbar nicht schön, Zeit mit mir zu verbringen. Immer wieder ist sie dadurch von ihm in eine Verteidigungshaltung gezwungen worden. Etwas Gemeinsames schön zu finden, ohne dass es dabei um Sex geht, gilt nicht.
Aber in Thomas’ Gesicht erkennt sie in diesem Moment nichts anderes als das, was er sagt: »Es ist schön, dass wir hier sind.«
Manon nickt. Sie spürt, wie ihr die Tränen kommen, und schüttelt unwillig den Kopf. Thomas macht einen Schritt auf sie zu und nimmt sie in den Arm. Erst sträubt sie sich, dann lässt sie es geschehen. Sie vergräbt ihr Gesicht in der Mulde zwischen seinem Hals und seiner Schulter. Die Tränen laufen ihr über die Wangen. Thomas drückt sie an sich und streichelt über ihren Kopf.
Das Weinen ebbt ab. Manon schlingt ihre Arme um Thomas, sie halten einander fest. Für eine lange Minute hat sie das Gefühl, dass diese Umarmung ihre gesamte Beziehung verkörpert, ihre Liebe, jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag. Jeden Streit, jede Versöhnung. Dann spürt sie Thomas’ Erektion an ihrem Schambein und nimmt im selben Moment wahr, wie sich sein Körper verhärtet. Der Zauber des Moments ist vorbei, sie lösen sich voneinander.
Wie immer gibt es zum Mittagessen nur Leichtes. Salat, gedünstetes Gemüse, Garnelen, Fisch. Dazu trinken sie Weißwein.
»Das hier ist keine normale Beziehungstherapie«, hat Professor Blumberg in seiner Ansprache am ersten Abend betont. »Es ist ein besonderer Ort, an dem Sie sich entspannen können. Und Sie dürfen so viel Alkohol trinken, wie Sie wollen. Sie sollen sich fühlen wie im Urlaub, das ist der beste Weg, Ihre Probleme zu lösen.«
Die Terrasse ist voll, alle Tische sind besetzt, alle beziehungsgeplagten Paare versammelt: die distinguierten Franzosen um die sechzig – sie geliftet, er groß, schlank und am gesamten Kopf kahl rasiert –, die Holländer Mitte dreißig, bei denen die Frau die ganze Zeit irgendetwas zu kritisieren hat, die dicken Österreicher um die vierzig, die wirken wie Rentner, die Spanier in ihrem Alter, die nie ein Wort miteinander wechseln und stattdessen nur auf ihre Handys starren, die Italiener Mitte dreißig, die so wirken, als ob sie eigentlich einen Cluburlaub gebucht haben und sich nun fragen, wo sie gelandet sind, und das andere deutsche Paar Mitte fünfzig, das immer eine Art Partnerlook trägt: Farben, die streng aufeinander abgestimmt wirken. Und schließlich noch das einzige Paar, von denen sie beide das Gefühl haben, sie könnten vielleicht auf ihrer Wellenlänge liegen, und von denen sie nicht genau wissen, woher sie kommen: Dänemark? Schweden? Norwegen? Sie sind vermutlich Mitte dreißig und scheinen – genau wie sie beide – alles mit einer ironischen Distanz zu betrachten.
Nach dem Essen hat Manon Lust zu rauchen. Seit Thomas und sie unterwegs sind, wird sie in regelmäßigen Abständen von der Gier nach einer Zigarette überfallen. Oft kommt sie nach dem Essen oder wenn sie etwas getrunken hat, manchmal auch schon morgens beim Kaffee. Seit ihrer Brustkrebsdiagnose vor fünf Jahren hat sie keine einzige Zigarette geraucht, es ist ihr nicht schwergefallen aufzuhören. Sie wusste immer genau, wofür sie darauf verzichtete. Für ihre Gesundheit. Für Léonie und Noah, auch für Thomas. Aber jetzt will sie rauchen. Sich den Filter zwischen die Lippen schieben, ein Feuerzeug nehmen, den Nikotinschwindel spüren.
Thomas hebt den Blick, zeitgleich spürt Manon in ihrem Rücken eine Bewegung und hört eine fremde Stimme. »Excuse me!«
Schräg hinter ihr steht die Frau, die zu dem skandinavischen Paar gehört. Die Frau ist Anfang dreißig und hat blonde, halblange Haare, die sie in einem Pony trägt. In ihrer Nasenscheidewand steckt ein dünner goldener Ring. Am Pool hat Manon gesehen, dass ihr gesamter Rücken tätowiert ist – ein Feuer speiender Drache. Der Mann ist groß, schlank, ein Schwarzer. Sie sind ein schönes Paar.
»Ja, bitte?«, sagt Manon auf Englisch.
Die Frau lächelt. »Entschuldigung, dass wir sie stören. Aber ich würde Sie gern etwas fragen. Also wir.« Die Frau deutet zu dem Tisch hinten an der Mauer. Der Mann hebt die Hand und lächelt.
»Bitte, fragen Sie.«
»Kann es sein, dass wir Sie irgendwoher kennen?« Sie macht eine kurze Pause, schaut Manon prüfend an. »Wir fragen uns das schon seit dem ersten Abend. Adam behauptet, Sie sind Schauspielerin. Ich habe dagegen gewettet. Ich weiß, dass es etwas anderes ist, aber ich komme nicht drauf.«
Manon zögert. Zwar ist es ihr in den vergangenen Monaten häufig passiert, dass sie von wildfremden Menschen angesprochen wurde, aber immer in einem Kunstkontext. Hier befinden sie sich auf einer Paartherapie in Südspanien.
»Nicht dass ich wüsste«, sagt sie. »Wahrscheinlich verwechseln Sie mich.«
Manon bemerkt Thomas’ Blick – ihm gefällt die Frau, so wie sie vermutlich jedem Mann gefallen würde.