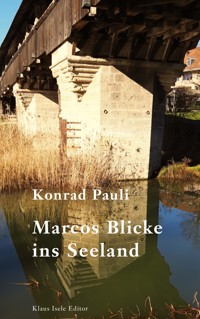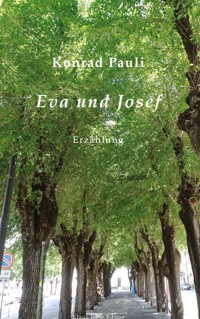Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Konrad Pauli geht als literarischer Flaneur durch die Welt, erkundet Schritt für Schritt die nähere Umgebung seines Stadtquartiers in Bern sowie die umliegenden Regionen. Dabei hat er vielerlei Begegnungen, erlebt Amüsantes, Trauriges, Zwischenmenschliches, Tierisches und hält seine Beobachtungen in kurzen Texten fest. Mal in zwei, drei Zeilen, mal auf zwei, drei Seiten. Seine Alltagsschilderungen richten den Blick vornehmlich auf das Unscheinbare, am Wegesrand Übersehene. Er gibt den kleinen Dingen des Lebens ihre Bedeutung zurück, gemäß dem Motto: »In der kleinen Welt spiegelt sich die große.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Komm, wir gehen.
Janosch
Der Aufzug gibt den Takt vor. Nicht verschont vom Diktat der Eile, ist man zuweilen selbst das Opfer der Hektik. Rasch möchte man hier weg und dort hin – möchte dieses und jenes erledigen, um nachher frei zu sein und Muße zu haben für das Wesentliche. Indessen ist auch die Vorstellung vom Wesentlichen nicht frei vom Nebulösen.
Anscheinend gut gewappnet gegen alles Hektische, prallt man gleichwohl gegen die vermeintliche Trägheit des Aufzugs. Man hat die Taste gedrückt, die Kabine ist bestellt, alles funktioniert gemäß dem technischen Programm. Doch das dauert. Weit oben – man hört das Geräusch – schiebt sich die Tür zu; danach braucht der Aufzug drei Atemzüge lang, um sich in Bewegung zu setzen und mich unten abzuholen. Oft schon habe ich so den Aufzug herbeigeholt, um, in Ungeduld, dann doch die Treppe hinaufzueilen. Eilen … Soll ja, unbestritten, gut sein für den Kreislauf. Der Aufzug kam unten an, allerdings vergebens eine Personenbeförderung erwartend. Als harmlose Rache für seinen stur technischen Gehorsam und seine Bedächtigkeit drückte ich in jedem Stockwerk den Knopf – und hörte, wie der Aufzug bei solch geballter Anforderung in blinder Unterwürfigkeit stöhnte.
Aber heute warte ich, bis er da ist. Ich widerstehe der Versuchung, von einem Bein auf das andere zu treten – es nützt ja doch nichts. Dem Aufzug möchte ich Befehle erteilen. So mach’ doch schon. Aber in stoischer Ruhe befolgt er sein Programm. Nun ist er endlich da. Den hurtigen Eintritt zögern Sicherheitssekunden hinaus, die eingehalten sein wollen. Ist man schließlich drin, beansprucht der Aufzug wieder geraume Zeit, bis sich die dreistufige Tür schließt, dann dauert’s erneut zwei Sekunden, bis der Aufzug anruckt. Zwei Sekunden, nicht der Rede wert.
In mir aber dröhnt der Vorwurf an mich selbst, warum ich nicht die Treppe genommen habe, ich wäre längst oben.
Der Aufzug gibt den Takt vor. Will man ihn benutzen, hat man sich an seine Regeln zu halten. Der Aufzug – ein Lehrstück. Seine Regelhaftigkeit lässt sich nicht manipulieren. Nunmehr oben angekommen, hat der Aufzug nicht im Sinn, die Tür sogleich zurückzuschieben. Zuerst muss der schmale Lichtstreifen auf der Taste erlöschen, bevor das Austreten gestattet wird.
Ist man in Eile, dauert dieses Prozedere eine Ewigkeit. Hat man die Gelassenheit mitgebracht, ist der zuverlässige technische Ablauf beinahe ein Genuss. Im Gleichklang mit dem Aufzug atmet man ein und aus und führt, wenn’s hochkommt, ein stummes Gespräch mit ihm.
Ging heute früh nach draußen, lief die gewohnten Wege durchs Quartier. Auf einmal war mir, ich trete und falle mit dem linken Fuß in eine Senke, ein Loch. Kein Sturz, nichts. Bloß dieser kleine Schwindel, dieses Schweben übers Bodenlose. Ich drehte mich um, schaute genau hin, doch da war nichts im Asphalt, das ich für diesen gleichsam leeren Tritt hätte belangen können. Der Schritt ins Haltlose kam aus mir, was die Unruhe natürlich verstärkte. Was, so dachte ich beim wieder störungsfreien Weitergehen, wenn irgendein Defekt das Vorankommen nicht bloß stört, sondern auf einen Streich unmöglich macht? Beispiele dafür gibt es genug. Immer traf es bis anhin die Andern. Dass dies so war, fördert die Dankbarkeit. Man war also dankbar, dass in der harmlosen Senke weder der Schritt zum Sturz führte noch das Gehirn ausgeschaltet wurde.
Nach Nebeltagen ein paar Sonnenstrahlen an der Tramhaltestelle. Wie Verdurstende drängen sich die Wartenden in die paar Quadratmeter, welche die Häuserzeilen dem Licht freigeben. Alle bieten sie ihr Gesicht der Sonne dar – die paar Minuten gilt es zu nutzen. Es macht keinen Sinn, das nächste oder übernächste Tram abzuwarten, denn die Sonne gestattet sich hier nur ein kurzes, kostbares Verweilen.
Die Sonnenstrahlen haben auch an den kürzesten Tagen schon Kraft. Also presst man die Augen zu und spürt, wie sich die Wärme übers Gesicht verteilt. Mit dem Zukneifen der Augen mache ich ein Spiel: mal stärker, mal schwächer. Nun gewinnt das Rot hinter geschlossenen, ja zugepressten Lidern an Kraft, sodass es einer Farbüberschwemmung gleicht. Blutrot, stärker als jeder Sonnenuntergang. Und das geschlossene Auge tastet jede Ecke, jede Welle dieses Brodelns ab und entdeckt mancherlei Farbnuancen. Auch kleine Fäden schwimmen da herum, tauchen auf, wachsen, schrumpfen und schlängeln sich weg. Heftig presste ich die Lider zu, so als wollte ich das Farbspektakel auf ewig verlängern. Dadurch habe ich die Ein fahrt der Straßenbahn kaum gehört und die zügige Wegfahrt verpasst. Neue Fahrgäste rücken heran und füllen sonnengierig die Lücken. Gönnerisch verbreiten die Sonnenstrahlen für weitere Minuten ihre Wärme.
Und mir fällt ein, wie ich vor vielen Jahren, in meinem zweiten Buch, eine ganze Seite, wenn nicht zwei, über das Wimmeln hinter geschlossenen Lidern im Sonnenlicht geschrieben habe. Der sogenannt große Stoff fehlte mir damals, also bestürmte ich mit der Sprache das vorgeblich Harmlose, gab ihm Raum über zwei Seiten. – Nun fährt das nächste Tram heran, mit offenen Augen steige ich ein. Neue Passanten werden den Platz nun von der Sonne verwaist vorfinden. Ich aber trage das Blutrot vergangenen Lebens die nächsten Stationen mit mir.
Dann weiter zum kleinen Einkauf. Vor dem Geschäft bestürmt mich der junge Mann, ich kenne ihn, zwar nicht mit Namen, aber wiederholt schon hat er mich angegangen, er müsse sogleich auf den Zug und zum Zahnarzt – fast unerträglich sei solches Zahnweh. Aber ihm fehle die Fahrkarte; und überhaupt habe er zu allem Übel auch noch das Portemonnaie verloren. Seine rechte Hand ist geknickt, abgewinkelt; da ist in der Tat irgendwann mal etwas schiefgelaufen. Überfällt er jemanden so zum ersten Mal, hat er zumeist Erfolg.
Fast unter Tränen gaukelt er seine Not vor, als fahre der Zug in zwei Minuten. Dabei balanciert er in geschickt inszenierter Ungeduld von einem Bein auf das andere, er hat keine Zeit zum Verweilen, muss sofort weitergehen und die Geldstück-Ernte einfahren, bevor sich die ältere Frau, der ältere Herr anders besinnen. »Leider kann ich Ihnen nicht viel geben«, bedauert die Frau, hoffnungsvoll, dass er sie aus seinen Fängen ohne Schaden entlässt.
Aber sein Tänzeln und das schiefe Lächeln verraten, dass er zwar froh, aber noch lange nicht zufriedengestellt, geschweige denn dankbar ist. Nun geht er aufs Ganze und tut so, als habe ihm die Frau die Gabe verweigert, ihn gar betrogen. Traurig schüttelt diese den Kopf, nein, unter keinen Umständen könne sie ihm nochmals etwas geben. Während er in ihren immer noch offenen Geldbeutel schielt, sich gar erdreistet, nach ihm zu fingern, bedauert die Frau wortreich, ihm nicht großzügiger beigestanden zu haben. Dafür hat er weder Sinn noch Ohr. Bevor die Frau ihr Restgeld opfert, mischen sich Umstehende ein und ziehen den Mann sanft, aber entschieden am Ärmel weg. »Lass es gut sein.« – Der Mann scheint sein Zahnweh und den Zahnarzt völlig vergessen zu haben, macht sich flugs aus dem Staub, um andernorts seinen Auftritt fortzusetzen und sein Weh zu beleben, aufs Neue zu beklagen.
Sie schreiben ja nicht mehr, bedauert Frau Gerber, die sich, mittlerweile an Stöcken, Schrittchen für Schrittchen vorwärts schiebt. Dick hat sie ihre Beine eingebunden – unverändert bleibt bloß ihre Perücke, deren konserviertes Kastanienbraun konstant bleibt und gleichwohl altert.
Passo per passo schiebt sie sich voran, hat etwas Kleines eingekauft, das im Säckchen am Arm baumelt; sie grüßt hier und dort jemanden, bleibt stehen, nur kurz zum Austausch der Malaisen, sagt, sie werde schnell müde und müsse weiter, habe zu Hause zu tun. Dabei zögert sie das Heimgehen gezielt hinaus, ist froh, wenn sie aufgehalten wird, Neuigkeiten erfährt und ihrerseits Informationen und Gerüchte weitergeben kann. Eifriges wechselseitiges Kopfnicken beweist das Einverständnis. Empört schüttelt sie im Takt den Kopf über das nahe und weite Weltgeschehen, kann nicht verstehen, warum man dies alles zulässt, nicht korrigiert und zum Besseren wendet. Unbeirrbar hat Frau Gerber eine klare Meinung über den Zustand der Welt, zu allen Übeln und wie man sie, wenn man denn wollte, beheben könnte.
Aber Sie schreiben ja nicht mehr! – Doch, doch, ich bin noch nicht fertig damit. – Sie hat meine Kurztexte in der Zeitung gelesen, damals. Da war ein Foto von mir abgedruckt. Also fingen die Leute an, mich zu grüßen, als kennten sie mich. Frau Gerber konnte sich nicht vorstellen, dass ich zwar weiterschrieb, sie mich in der Zeitung aber nicht mehr fand. Ja, ja, klagte sie – nichts ist mehr wie früher. –
Nun stolpert auch der Hund Schrittchen für Schrittchen um die Ecke, wohl begleitet und behütet vom Frauchen. Selbst im Dämmerlicht oder bei Regenwetter hat die Hun dehalterin die dunkle Sonnenbrille auf, zudem steckt ihr Kopf unter einem Hut, einer Kappe ähnlich. Der alte, in Schwäche und Übergewicht sich träge hinschleppende Vierbeiner ist ihr Ein und Alles, strukturiert den Tagesablauf, ist beim Hinausgehen und Spaziergang ihre Leitplanke. Zielstrebigkeit kann sie dadurch praktizieren, wenngleich ihr Draußensein bloß um zwei Häuserblocks herum geht. Gelänge ihr dies nicht, stürzte sie sogleich in die Orientierungslosigkeit. Innig hängt sie an ihrem Hund; so wie er ihr in unbewusster Dankbarkeit zugeneigt und ausgeliefert ist. Auch an milden Wintertagen schützt sie ihren Liebling mit einem Mäntelchen, veredelt mit einem Blumenmuster. Dem Hund fehlt es an nichts. Seiner Herrin würde ohne ihn alles fehlen.
Nach langem, auch ermüdendem Gang durchs Quartier, weit hinaus bis an die Ränder, zum Waldrand, wo die Männer der Baumpflege gewütet haben, gönne ich mir nun die Rast, das Verweilen auf der Bank an der Tramhaltestelle. Die Januarsonne ist mild und schickt sich an, hinter dem kahlen Baum, dann hinterm Bankgebäude wegzutauchen.
Ich lehne mich zurück und blicke dem Flugzeug nach, das silbrig südwestwärts zieht. Male mir den Bestimmungsort, den Landeplatz aus. Zum Beispiel die gute, manchmal auch holprige Landung in Palma. Im Tiefflug gut zu erkennen die blauen Tupfer der Swimming Pools, die stillstehenden Windmühlen und die Autos auf den Neben straßen. Für die geglückte Landung verdient die Crew den Applaus der Passagiere. Die Koffer sind prallvoll gefüllt mit Feriensachen. Auch im Januar. Beim Ausgang gibt’s ein Stückchen Schokolade als Überbrückungskalorien für Wartezeiten. – Ich lasse das Flugzeug ziehen – und wende mich dem Nahen zu. Zaghaft zerflatternder weißer Rauch aus einem Kamin. Darunter das Wohnungsfenster des kürzlich verstorbenen Schauspielers. So gern wollte er an den Münchner Kammerspielen auftreten. Er hätte das Zeug dazu gehabt. Unbestritten. Das haben jedoch Viele. Er stand nicht Schlange, hoffte stattdessen still aufs Angebot, das ihn herausgehoben hätte aus dem nationalen Mittelmaß. Auf der Bühne, im Radio und Fernsehen war er hierzulande präsent. Er dachte vielleicht, vorerst genüge das. Hoffte gleichwohl weiter – und fing an, übermäßig zu trinken. Schon vormittags im Terrassencafé. Die Sonne spiegelte sich im Weinglas und in seinem zusehends geröteten Gesicht. Frühes Dahindämmern. Verschobenes Erwachen. Mühsame Schritte in die Wohnung, über die soeben das silbrige Flugzeug gezogen ist.
Mit offenen Fenstern und einem Hupkonzert sammelt ein jugendlicher Autofahrer die Blicke der Umstehenden. Ältere schütteln genervt den Kopf, einer sagt, Solches sei doch seit dreißig Jahren vorbei.
Januar, wolkenloser Abendhimmel, immer noch mild. Nur in hohen Lagen findet dieser Winter statt. Anderswo leisten Schneekanonen Überstunden. – Einer in Lederjacke trägt sein Gähnen offen zur Schau. Fast scheint es, er bringe die Kiefer nicht mehr zusammen. Die letzten Strah len machen Rast auf schönem, braunem Damenhaar. Als wollten sie dort einen Vorrat anlegen.
Eine in letzter Zeit schnell gealterte und nun ungepflegte Frau schiebt sich an Krücken über den Fußgängerstreifen. Dabei bedankt sie sich alle zwei Schritte bei den vermeintlich geduldigen Autofahrern. Das Schuhetragen ist ihr mittlerweile zu mühsam geworden. Tag für Tag stecken ihre Füße in blauen, halbzerfetzten Pantoffeln.
Im Vorübergehen sagt eine Frau zur andern: Du bist schwanger, habe ich gehört … Bist ganz begeistert …
Ein Mann hat seinen schwarzen Hut tief in die Stirn gezogen, als hätte er etwas zu verstecken. Eine junge Mutter krallt sich an ihr Bébé, als könnte es ihr weggenommen werden.
Der Clochard sitzt auf der Bank an der Sonne. Er wärmt sich auf für die Nacht. Wie eh wird er sie auf der Bank im Stationshäuschen verbringen. Bei sich hat er seinen gesamten Hausrat: einen Rucksack und zwei vollgestopfte Taschen. Rätselraten, was er in ihnen hortet und mit sich schleppt. Eine speckstarre Jacke vielleicht, gezeichnet noch von kalten Tagen. Stets hat er auch ein Buch bei sich (mit welchem Titel?) – und er löst Kreuzworträtsel und Sudokus. Zeitvertreib. So lenkt er sich ab und forscht selbstvergessen nach einem vagen Sinn. Denn mit der Sinnlosigkeit hat er nichts am Hut. Er ist ganz bei sich und hat zum Warten alle Zeit. – Mitsamt seinem ganzen Hausrat ist er plötzlich weg und findet auf einer Bank im Schatten seinen nächsten Aufenthaltsort. Von Neuem nestelt er in seinen alten, ihm liebgewordenen Sachen. Dann fällt ihm das Kinn auf die Brust, und die Müdigkeit schenkt ihm eine Stunde Schlaf.
Die Schönheit eines Ortes entfaltet sich, wenn die Dinge wieder nahe sind.
Aufs Laufen habe ich mich verlegt. Unterwegs bin ich schon seit jeher. Nicht den Laufschritt übe ich, bloß das (zügige) Gehen. Früher war das anders. Da ging’s keuchend über Waldstücke im Orientierungslauf dem Sieg oder zumindest einem guten Rangplatz entgegen. Ich war beglückt und staunte über Kraft und Ausdauer, die mich vorantrieben. Im kraxelnden Eilschritt oft auch auf diese und jene Bergkuppe, um auszukundschaften, wie dort die Welt weiterging.
Immer noch kann ich rasch ausschreiten, doch nicht so, als sei ich auf der Flucht, als laufe ich von Unangenehmem, gar vor mir selber weg. Das Gehen tut mir gut. Mehr noch – ich brauche das. Nicht bloß ein Auslüften ist’s für das Gemüt und alle Sinne. Es ist, als würde dabei manch Flaues und Verschobenes, auch müd Gewordenes neu geordnet und zusammengerückt. Auch sieht man so Vieles unterwegs. Selbst wenn das Neue nicht neu ist. Zumindest die sich stets ähnelnden Wolken sind in ihren Wiederholungen Neuauflagen und einmalig. Keine Wolke, keinen Wolkenhimmel gibt’s, der sich exakt kopiert. Ist dies ein Gleichnis? Eine Metapher? Zumindest wirkt hier ein Naturgesetz. Und für mich ist’s ein Trost: Ginge alles schief – der Himmel bliebe mir erhalten; er kann nicht verbaut, die Wolken können nicht vertrieben werden.
So schritt ich aus, ziellos und in Gedanken angebunden an die Post, die heute im Kasten lag: eine Todesanzeige. Hedy Balsiger. Nie habe ich eine Hedy Balsiger gekannt. Aber im Text dankte man mir für die Fürsorge und alle Aufmerksamkeiten, die ich der lieben Verstorbenen geschenkt hatte. Ich war gerührt, verschonte mich freilich vom Vorwurf, der Verstorbenen diese Zuwendung niemals entgegengebracht zu haben.
Der Gedanke amüsierte mich: Wie, wenn auch nach meinem Tod eine Anzeige an eine Person geriete, die mich nie gekannt hat? Was würde diese Person mit solcher Post anfangen? Und was mache ich? Nichts. Aber die Anzeige werfe ich nicht weg.
Passo per passo galt fortan immer auch fürs Schreiben. Es ging ja nicht anders, als dass bald etwas aufs Papier kam. Schreibend sah ich eine (männliche) Figur in Quiberon am Strand, an den Häusern vorbeigehen und auf das Schiff für die Belle Ile warten. Von der Insel erhoffte er sich, wie es damals ein wenig Mode war, einen Schauplatz und Nährboden, die Initialzündung für ein Schreibwerk.
Ein Stratege und Architekt hinsichtlich der Form war ich nie. Vielmehr ließ ich Ansätzen freien Lauf. Gewiss, jeder Satz, jeder Abschnitt legte das Folgende fest, trug am Ende auch Mitverantwortung für das Ganze, wenn es denn eines wurde.
Er ging also durch den Ort, sah im Dunst die Insel und davor, einem Teppich gleich und wie eine Richtschnur, das Sonnenblinken und Lichtscherbeln im Wasser. Er schaute auf die Uhr, noch hatte er gut eine Stunde übrig. Die Zeitungen am Kiosk boten Informationen und Abwechslung. Zehn Minuten waren so gewonnen. Und nun? Am Tresen einer Bar Kaffee oder ein Bier trinken? Verweilen zu Studienzwecken? Bild um Bild sog er in sich hinein und prüfte jedes hinsichtlich einer späteren Verwendbarkeit. Ich war es, der dort stand – aber die Grenzen und Bilder vermischten sich: Nun war es die literarische Figur, die sich auf den Weg machte. Passo per passo – ob zu Fuß über steinige Wiesen stolpernd, auf dem Fahrrad gegen den Wind ankämpfend, im Mietauto durch den Nebel irrend oder in Gedanken: Schritt für Schritt von etwas weg, auf etwas zu.
Wenn auch aus Eigenem geschöpft, erlaubte, ja verlangte der Schreibweg Dinge, die davon abwichen, darüber hinausgingen. Weshalb hatte die Frau, die er schon auf dem Schiff beobachtet und schließlich kennengelernt hatte, keine Brüste? Einfache Erklärung: Sie hatte sie entfernen lassen müssen. Was sie beide nicht daran hinderte, eine intime Beziehung einzugehen. Auf der Insel – danach gab’s keine Fortsetzung. Erfüllte Lebensabschnitte – für sie, für ihn. Mit allem Staunen, allem Schmerz, der dem Abschied innewohnt. Zu Ende gebracht ist nichts. Am Ende ist alles erst zuletzt.
Warum verzagt? Hinter dem offenen Fenster übt eine(r) mit Ausdauer, vielen Anläufen und Schnörkeln auf dem Blasinstrument. Vereinzelt vertraute Melodienfetzen, die man zu einem Ganzen zusammenfügen und fortspinnen könnte.
Warum verzagt? Wolken ziehen auf, verschatten alles, brechen aber die Wärme nicht. In zaghaften Windböen flattern im Terrassencafé die Tischtücher. Eine Fliege läuft Rändern entlang, landet auf dem Handrücken, verirrt sich in den Härchen und macht wiederholt Station auf dem Papier, als wäre sie neugierig auf meine Schrift. Ob sie wohl das Alphabet kennt?
Es ist noch Sommer – kalendarisch einen Monat lang. Den August haben wir noch zugut. Aber heute schon wirbelt der Wind die ersten Blätter aus den Bäumen. Ausgetrocknet scherbeln, ja kratzen sie über den Asphalt, finden da und dort kurze Rast.
Mit seinen Vorsätzen hinkt man der Zeit ein wenig hinterher. Das geschieht wohl jedem so. Was versprach man sich denn? Im Frühling, der mit linden Lüften zu geizig war, im Sommer, der mit zwei Hitzewellen Vieles aufholte, Manches aber versengte? An den Gartenzäunen wurden die Rosen geradezu verbrannt – jetzt baumeln die Frühzerstörten mit braunen Blütenresten schief auf den Stängeln. Nachschub scheint erschöpft zu sein. Was vorbei ist, ist vorbei. Der Sommer behauptet sich. Doch auch wenn sie nicht eilt, die Zeit arbeitet gegen ihn.
Tann in der Rhön, damals auf drei Seiten eingezirkelt vom Eisernen Vorhang – verlockend, um dort stundenlang der scharf bewachten Grenze entlangzugehen mit bloß kurz unterbrochenem Blick nach drüben. Grenzwächter mit Spürhund, ein Bauer, schon ziemlich weit weg auf dem Traktor. Der Rentner, der, um mich zu grüßen, vom Rad steigt. Sehen Sie, sagt der ehemalige Postler, dort drüben, gleich um die Ecke, bin ich aufgewachsen. Will ich meine Mutter besuchen, kostet mich das wegen der Bewilligungs-Bürokratie eine Tagesreise.
Aus einem niedrigen, hinter einer Bodenwelle versteckten Haus züngelt dünner Rauch, der in ziemlicher Windstille nicht recht weiß, wohin er will. Doch die Gerüche und Duftschwaden von drüben scheuen keine Grenzen. Chemie-Industrie? Ein Kohlebergwerk? Ein Wink, ein Ruf aus dem Osten? Dieser Osten wies weit hinaus nach Sibi rien. Wo fing an, was hier wirkte? Denn hinter solchem Anfang schlummerten andere Anfänge. Stets nach Osten zu gehen, führte zwangsläufig in den Westen. Die Erdkugel ließ sich von keinem täuschen.
Querfeldein unter tiefen Wolken über eine Wiese mit dürrem Gras der Höhe zu. Ungefragt überfielen mich Motive, die Umrisse einer Schreibarbeit. Hurtig, als wäre Wertvolles zu verlieren, notierte ich die Einfälle; eine Art Richtschnur für das Anfangen und Vollbringen. Alles war so klar, kein Aber trübte die Idee, kein Widerspruch hatte die geringste Kraft.
Auf der Höhe schaute ich in ferne Horizonte. Mit Vorliebe ostwärts, denn was hinterm Rücken im Westen lag, war mir ziemlich vertraut. Kein Gelobtes Land im Osten, aber dieser Reiz des Nicht-Betretenen.
Später überflog ich die Notizen. Anderntags wirkte ihre Struktur spröde, war ihre Botschaft verblasst. Nicht nur das: Die verheißungsvolle Möglichkeit erschien als trivial und also unbrauchbar. Dabei hatte die Idee eine Kraft gehabt, die unwiderstehlich schien. Im ersten Anflug stimmte alles. Im zweiten war Vieles schal geworden. Im dritten hatte sich das Versprechen gleichsam in Luft aufgelöst. Jede Dringlichkeit war zunichte geworden. Doch aus welcher Quelle nährte sich das vermeintlich Zwingend-Notwendige …
Anton Bruckner verriet, im Traum habe er das Thema zum zweiten Satz seiner vierten Sinfonie geschenkt bekommen. Er sei mitten in der Nacht aufgestanden, um es zu notieren.
In zwar bescheidenstem, gleichwohl gebieterischem Maß schenkte ein Traum auch mir die Idee und Struktur eines neuen Projekts. Mustergültig setzte sie sich zusammen – in Form und Inhalt. Glücklich war ich im Traum – der ja nicht als solcher zu erkennen war – , kurzum wollte ich ans Aufschreiben gehen. Als ich erwachte, klang das Erlebte als Geschenk und Verheißung noch eine Weile nach. Bevor ich zur ersten Notiz ansetzen wollte, zerbrach das im Traum so folgerichtig zusammengesetzte Gefüge nicht nur in seine Einzelteile, es verflüchtigte sich vollends ins Ungreifbare. Nichts stimmte mehr. Die Logik des Traumkonzepts verfing sich im Wirrwarr. Der Traum hielt dem Tag nicht stand. Der Traum schenkte ein überaus belebendes, farbiges Versprechen, ohne es, bei Licht besehen, einlösen zu können.
Lange ist’s her, dass ich die kleine, vielleicht zehn Zentimeter hohe Figur bekommen habe – als Dank für einen Zeitungsartikel. Ein Tonfigürchen, rohe Haut und fleckig. Weiblich. Allereinfachste Form, archaisch. Gleichwohl mit körperlich-sinnlicher Ausstrahlung. Mit einem Kopf, eher Köpfchen, aber gleichsam gesichtslos. Erinnerung an eine bestimmte Person, ja, aber ungreifbar. Reizend immerhin. Ein Versprechen. Nun steht die Figur auf meinem Schreibtisch, umrahmt von Papieren. Wie viel (erotische) Sinnlichkeit liegt in ihr? Wie viel davon errate ich? Die kleine Gestalt ist mir lieb.
Es gibt welche, die gehen beziehungsweise fahren nicht Schritt für Schritt. Ein Rollstuhlfahrer – modernes, elektronisch ausgerüstetes Gefährt – saust selbst im dichten Gedränge unbeirrt geradeaus; man kennt ihn und springt zur Seite, traut ihm die gezielte Kollision zu. Er ist benachteiligt, sieht sich im Recht – und fordert es ein ohne Wenn und Aber. Zumindest das Vortrittsrecht gehört ihm. Seine Behinderung ist sein Freibrief. Fährt er jemanden über den Haufen – bitte schön, warum hast du nicht besser aufgepasst. Es ist, als sause er bloß so dahin, um sich und seinen Anspruch zu behaupten und die Mitmenschen, die ihm willkommenerweise im Weg stehen, zu testen. Ihr Erschrecken und Auseinanderdriften schmeichelt ihm, zementiert seine Sonderrolle, wird ihm zum Triumph. Muss er doch einmal die Geschwindigkeit drosseln, wirkt dies für ihn wie eine Beleidigung, eine Niederlage.
Antworten sind zuweilen schnell zur Hand. Eine nicht mehr junge, aber nicht alterswelke Frau spricht mich, den ihr nicht unbekannten Autor, an und verkündet: Ich könnte auch ein Buch schreiben, wenn nicht gleich mehrere. Stoff habe sie in Hülle und Fülle. Ob ich ihr einen Rat geben könne. – Ist doch wunderbar, entgegne ich und sage frohgemut: Fangen Sie doch mit dem ersten an!
Sie schreiben ja nicht mehr – wiederholt höre ich das von Frau Gerber, die sich, beladen mit Verbitterung, an Stöcken mühsam vorwärtsschiebt. Variationen der Wiederholung: Trifft sie Bekannte, verweilt sie gern bei einem Schwatz, der, so kann ich hören und erraten, der wachsenden, nun bedrohlichen Verschlechterung der Zustände gewidmet ist. Es wäre an der Zeit, endlich einzugreifen und aufzuräumen mit dem zumeist fremden Pack, das an unsere Wohlstandsquellen will. Allesamt sind sie Profiteure, wollen von zu Hause weg, anstatt daheim zum Rechten zu sehen. Dass dort Krieg herrscht und Willkür, seit Jahren schon, das weiß Frau Gerber bestimmt, aber sie blendet das meisterhaft aus. In aller Einfalt weiß sie es besser. Vereinfachende Menschen sind argumentativ im Vorteil, kommen zügig zu einem Urteil, bestenfalls sogar zu einem Lösungsvorschlag. Und sie ereifern und ärgern sich, weil die Verantwortlichen, also die Schuldigen, das längst erkannte und oft benannte Grundübel noch nicht aus der Welt geschafft haben. Früher hätte man …
Dass mir Frau Gerber anklagend sagt, ich schreibe ja nicht mehr, beschäftigt mich. Ich widerspreche ihr, aber mein Trost tröstet sie nicht. Ich finde Sie nicht mehr in der Zeitung – das ist schlimm genug. Denn so, wie Sie ES damals beschrieben haben, genauso ist es.
Mit dick eingebundenen Beinen steht sie am Fußgängerstreifen, die Autofahrer scheinen sie zu kennen. Allerdings gibt es Fahrradfahrer, die gleichsam kreuz und quer durch die Gegend kurven und keine Verkehrsregeln mehr befolgen. Den Nächsten, der rücksichtslos vorbeihuscht und mich mit dem Lenker beinahe erwischt, lege ich um! – Frau Gerber kichert: Ich brauche bloß den Stock zu heben, aus gezielter Unachtsamkeit – und den Kerl, die Kerlin bringe ich zu Fall. Und vielleicht zu neuer Einsicht. Soll jeder mit sich selbst zurechtkommen, ich muss das auch. Aber man müsste wieder mal für Ordnung sorgen. – Ja, ja, fuchtelt sie – und mischt sich wieder in eine ernsthaft räsonierende Dreiergruppe, wo ihren Klagen widerspruchslos zugenickt wird.
Schluck für Schluck, so betont der alte Mann im Heim, Schluck für Schluck trinke er den Wein, nicht hastig also, gleichsam passo per passo. Dabei funkeln seine Augen, als verschweige er einen Rest. – Seine Tochter sagt, zeitlebens habe er den Rotwein geliebt; zuweilen habe er auch zu tief ins Glas geschaut. Noch heute, wenn sie ihn besucht, hält sie besorgt ein Auge auf ihn, ob er vielleicht …
Stumm, mit dem Schalk in den Augen, erträgt er die Mahnung, jetzt sei es, zumindest für heute, genug. Auf seinem Tisch im Essraum, an dem er zu den Mahlzeiten alleine sitzt, steht die Rotweinflasche mit dem Korken obendrauf. Bloß ein Glas schenkt er sich ein, so reicht die Flasche für eine Woche. Er aber ist der Einzige, der sich dieses Glas Roten noch gönnt. Seine Heiterkeit lebt davon. Darum ist er in den Augen der Mitbewohner das schwarze Schaf. Seht her! Dort steht die Flasche. Schon wieder halbleer! Sie ist doch der Beweis für sein Säufertum.
Sitzt Carlo im Zimmer auf dem Sofa, fällt sein Kinn auf die Brust, und er nickt ein – eine, zwei Stunden gar. Auch das Erwachen geht passo per passo. Schrittchen für Schrittchen schiebt er sich später, als müsse er den Weg allemal neu finden und die Strecke abschätzen, zum Aufzug hin; sein volles, schlohweißes Haar erinnert (wie die Fotos in seinem Zimmer) daran, dass er ein attraktiver Mann gewesen war und seine Schönheit noch nicht verloren hat. Sowohl Augenlicht wie Hörvermögen sind eingeschränkt, aber er fragt zurück, wenn er etwas nicht verstanden hat. Oder er blickt um sich, ob jemand da sei, der ihm aus der Patsche helfen könnte. Getröstet ist er rasch – aber er weiß um seine körperlichen Defekte.