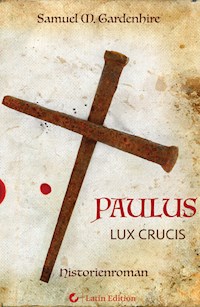
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rom im Jahre 64 n.chr... Kaiser Nero unterdrückt sein Volk. Die erste Generation Christen erfahren immer mehr Zulauf. Eine verborgene Familiengeschichte. Das brennende Rom und ein großes Finale im Zirkus Maximus. Dieser historische Roman erzählt aus der Zeit von Kaiser Nero: das Leben am Hof, die Christenverfolgung, eine große Liebe und einem Mann hinter Nero, der auf grausame Art die Fäden zieht und das Schicksal der Stadt und vieler Menschen bestimmt... Dieses Buch reiht sich ein in Meisterwerke wie BEN HUR und QUO VADIS? und DIE LETZTEN TAGE VON POMPEJI. 117 Jahre nach der ersten Veröffentlichung durch Samuel M. Gardenhire erscheint dieser historische Klassiker in einer von der Frakturschrift ins Deutsche übertragenen Neuausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cäsarea
Die Stadt Cäsarea erwachte zu neuem Leben.
In dem am meisten bevölkerten, nordwestlichen Stadtteil tauchten da und dort durch die Öffnungen auf den flachen Dächern der niederen Häuser schon ab und zu einzelne menschliche Gestalten auf, die ihre Teppiche oder Schafsfelle auf dem Steinboden ausbreiteten und dann zu stillem Gebet niederknieten. Die Sonne war über der Hügelreihe im Nordosten aufgegangen und übergoss die benachbarten Höhen mit zartem rot; ihre Strahlen vergoldeten die Giebel des römischen Theaters und die Säulen der neuen Arena hinter der Kaserne der römischen Soldaten. Ein Teil der Wüste, ein schmaler Ausläufer der unfruchtbaren Einöde Arabiens, lag als eine weiße Sandmatte in dem erwachenden Lichte weit draußen im Osten, während im Westen still und friedlich im Glanze der hellen Morgensonne das Meer dalag, auf dessen grüner Tiefe sich die im Hafen liegenden stolzen römischen Galeeren widerspiegelten.
Das hervorragendste und vornehmste Gebäude der ganzen Gegend war ein prächtiger Palast mit herrlicher Aussicht auf das Meer, in dessen großem, offenen Vorhof eine von dem römischen Adler gekrönte Marmorsäule stand. Südlich von dem Palaste lag ein langgestrecktes niedriges Haus, das durch eine mäßig hohe Mauer von der engen Straße abgeschlossen war. Von der Rückseite dieses Hauses führte eine steinerne Galerie zu einem stattlichen Kuppelbau, dem Gerichtshof, von dem aus die römischen Behörden ganz Palästina beherrschten. Die Mauern und Säulengänge dieses niederen Hauses waren üppig mit Reben bewachsen, deren Blätter und Ranken sogar bis zu den Korridoren hineingingen, der sich an der Längsseite des Gebäudes hinzog und dessen kahle Backsteinwand von einer größeren Anzahl dunkler, festverschlossener, mit vergitterten Öffnungen versehener Türen unterbrochen wurde. Jetzt herrschte in diesem Hause noch das tiefe Schweigen der Nacht, keine Spur von Leben ließ sich darin vernehmen.
Der frische, von dem Meer her wehende Morgenwind spielte mit dem Laubwerk an dem Säulengang. Sogar bis in die düsteren Zellen hinter dem Korridor drang dieser Hauch des erwachenden Tages und er wurde mit großer Freude von einem an der Öffnung in seiner Türe stehenden Gefangenen begrüßt. In dem Dunkel, das noch im Inneren des Hauses herrschte, konnte man zwar die Gestalt des Mannes nicht genau erkennen, aber sein Gesicht war deutlich sichtbar und die um die eisernen Stäbe gelegten Finger waren weiß und schön geformt.
Der Mann hatte ein äußerst angenehmes Gesicht; die kühn blickenden Augen und die festen, kräftigen Züge drückten Mut und Entschlossenheit aus und machten durchaus nicht den Eindruck, als sei ihr Besitzer durch die über ihn verhängte Haft bedrückt oder eingeschüchtert. Ein heiterer, aber in seiner Weise spöttischer Zug spielte um seine Lippen und deutet auf frische, übersprudelnde Lebenskraft. Der Gefangene betrachtete mit gespannter Aufmerksamkeit einen unbestimmten dunklen Schatten neben einer der Säulen des Korridors, der, als es heller wurde, allmählich immer festere Umrisse annahm; jetzt konnte der Beobachter die Gestalt eines knienden, in andächtiges Gebet versunkenen Mannes erkennen, dessen tiefgesenktes Haupt halb auf seinem Arm ruht, mit dem er sich an die Säule anlehnte. Aber so wenig sich der Betende der nachdenklichen Blicke bewusst war, die ihn von der Türöffnung aus beobachteten, ebenso wenig hörte er den immer lauter werdenden Straßenlärm, noch das zunehmende Getriebe in dem anstoßenden Gebäude. Ganz versunken in sein Gebet, war er der Welt um sich her völlig entrückt.
Durch die Fensterbogen fiel allmählich immer helleres Licht; das laute Wagengerassel auf der Straße weckte endlich den Gefangenen aus seinem Nachdenken auf und auch die Ruhe und Andacht des Betenden wurde schließlich dadurch gestört. Langsam erhob sich der Mann von den Knien, trat an das Fenster und blickte sinnend hinaus.
„Holla, guter Jude“, rief der Gefangene aus seiner Zelle heraus. „Die ganze letzte Stunde hast du im Elysium verbracht und solltest dort gelernt haben, Barmherzigkeit zu üben. Luft und Licht sind hier zu kostbar, um ausgeschlossen zu werden; aber deine Gestalt wehrt der herrlichen Morgenluft den Eingang. Und noch eins – ich bin durstig. Könntest du mir nicht einen Trunk frischen Wassers verschaffen?“
Ohne ein Zeichen der Überraschung oder der Bestürzung wandte sich der Jude langsam vom Fenster weg. Er war klein, aber gut und stark gebaut und die Muskeln seines Nackens traten kräftig hervor. Den kahlen Kopf trug er frei und aufrecht; durch den dichten Vollbart war die Gesichtsform nicht deutlich zu erkennen; aber die scharfgeschnittene Adlernase gab dem Antlitz Charakter; die Augen leuchteten wie Sterne und in dem ganzen Wesen des Mannes lag ein Ausdruck unerschütterlicher Entschlossenheit. Zuerst betrachtete der Jude den Sprecher mit dem ruhigen Blick eines Mannes, der gewöhnt ist, seinen Gegner immer erst gelassen abzuschätzen; dann aber zeigte sich auf seinem ernsten Angesicht ein freundliches Lächeln.
„Einen Liebesdienst fordert niemand vergeblich von mir und ganz gewiss möchte ich dir nichts vorenthalten, am allerwenigsten das Himmelslicht und die Himmelsluft. Deine Aussprache lautet angenehm und ruft mir liebe und traute Erinnerungen ins Gedächtnis zurück. Wie nennt man dich?“
„Nicht so, wie ich es verdiene, mein lieber Jude, und zwar infolge des menschlichen Unverstandes. Sonst hätte der Kaiser allen Grund, mich zu beneiden.“
„Ich habe dich nach deinem Namen gefragt“, sagte der Mann im Korridor und sein Gesicht wurde immer freundlicher.
„Du hast mich indirekt danach gefragt und ich habe dir mit meiner Andeutung von meinen Vorzügen geantwortet. Aber mein Name tut nichts zur Sache. Solltest du bei meinem Verhör im Gerichtssaal anwesend sein, so würdest du hören, wie der Statthalter mir allerlei Namen beilegt. Die ich aber durchaus nicht verdiene. Doch will ich mich“, fuhr er trocken fort, „nicht über das Los des Tugendhaften beklagen, dessen Schicksal ja stets ist, verkannt zu werden.“
Der Jude erwiderte nichts. Ruhig ging er den Korridor entlang und kam bald mit einem Krug Wasser zurück, den er dem Gefangenen durch die Öffnung in seiner Zelle darreichte, der ihn sogleich begierig an den Mund setzte.
„Der Segen der Götter sei mit dir“, rief er herzlich aus, als sein Durst endlich gelöscht war. „Lass den Krug lieber gleich da. Hier neben mir liegt mein Gefährte, steif wie ein Holzklotz, in tiefem Schlaf; wenn er aufwacht, möchte er gewiss auch einen Schluck nehmen. Hörst du ihn nicht schnarchen?“
„Ich höre ihn“, erwiderte der andere ruhig.
„Sein Schnarchen hört sich gerade an, wie wenn der Wind durch die baltischen Wälder braust, die die Heimat dieses Schläfers sind. Trotz des ihm drohenden Strafgerichtes eurer Obrigkeit schläft er jetzt hier ebenso ruhig wie einst in seiner heimatlichen Höhle. Ich werde ihn nur mit Mühe im Zaum halten können, wenn man uns zum Verhör führt. Wie ich gehört habe, soll heute Gericht gehalten werden.“
„Was hast du getan?“, fragte der Jude.
Der Gefangene seufzte – es war aber kein schwerer, vom Kummer ausgepresster Seufzer, nein, viel eher ein fröhliches Aufatmen; aber in die Augen des Mannes trat dabei ein sonderbarer, zweifelnder Blick. Fast schien es, als sei er jetzt, da er an sein Vergehen erinnert wurde, selbst höchst erstaunt über sein eigenes Betragen.
„Etwas recht törichtes“, antwortete der Gefangene. „Der Sand eurer Wüste hatte mich ausgetrocknet und die Erinnerung an ein schöneres Land hatte mich durstig gemacht. Da ich nicht recht wusste, wie die Zeit totzuschlagen, ging ich auf den Marktplatz und kaufte mir einen Krug roten Weines. Die Tochter des Kerls, der den Wein feilbot, war hübsch und wir Römer sind nicht gewöhnt dein Volk zu achten. Auf das meinem keuschen Gruß folgende Geschrei stürzten die Soldaten herbei. Ich und mein Diener hätten sie wohl zurückschlagen und ihnen entgehen können, aber einige arabische Reiter ritten uns über den Haufen. Wären wir nicht so unvermutet festgenommen und dadurch abgehalten worden, Gebrauch von unseren Waffen zu machen, so hätte ich nicht sechs höchst langweilige Tage hier zubringen müssen mit der angenehmen Aussicht, in meinem Richter einen Feind wiederzutreffen. Wenn ich nur mit meinem Diener draußen wäre, in Zeit von einer Stunde wollte ich an Bord der Galeeren sein. Vor zwei Tagen hörte ich von dem glücklichen Einlaufen der Schiffe.“
„Du hast einen Diener?“, fragte der Mann draußen im Gang nachdenklich. „Da du also den höheren Ständen angehörst, brauchst du doch das Urteil nicht zu fürchten: als Römer wirst du natürlich freigesprochen werden. Mich wundert nur, dass du überhaupt hier bist.“
„Du magst recht haben“, sagte der Römer lachend, „aber du darfst nicht vergessen, dass ich mich gar nicht um meine Freilassung bemüht habe. Felir hat guten Grund, sich meiner zu erinnern; glaube mir nur, es wird seine Laune nicht verbessern, wenn ich vor ihn gebracht werde.“
„Felir ist nicht mehr hier“, sagte der Jude. „Der Römer Festus ist jetzt Landpfleger. Er kam auf den Galeeren an und sitzt heute zum ersten Male zu Gericht. Felir ist schon abgesegelt.“
„Portius Festus!“, rief der Gefangene frohlockend. „Bei den Göttern, das ist gute Botschaft! Wie heißt du, mein Freund? Meinen eigenen Namen darf ich nicht ohne weiteres nennen, obgleich Felir dort ist, aber wenn ich in die Kaiserstadt zurückkehre, will ich den deinen auf dem Altar niederlegen.“
„Mein Name liegt schon auf dem Altar, Römer“, sagte der Jude ruhig. „und täglich flehe ich Gott an, ihn für immer dort zu lassen. Ich heiße Paulus.“
„Bist du Soldat? Du verhälst dich wie ein solcher.“
„Ich bin Soldat gewesen.“
„Unter Agrippa?“
„Unter dem Kaiser.“
„Freund“, sagte der Gefangene mit ernstem Lächeln, „wenn du dich so hinstellen kannst, dass meine Arme dich erreichen können, möchte ich dich als meinen Bruder umarmen. Du warst Offizier, dessen bin ich sicher. Was hast du getan, dass du jetzt ein jüdischer Kerkermeister bist?“
„Ich bin nicht der Kerkermeister. Wie du, bin auch ich ein Gefangener und warte hier seit zwei Jahren auf mein Urteil. Wenn ich überhaupt irgendeinen Menschen meinen Feind heißen möchte, müsste ich wohl zuerst Felir als solchen bezeichnen. Ich bin ein Jude, aber in Tarfus als römischer Bürger geboren.“
„Tarfus, den Ort kenne ich; geboren kann man allenfalls dort werden, aber nur in Rom wird man ein wahrer und echter Römer, mein guter Paulus. Ach, wäre ich nur jetzt dort! Zwei Jahre, sagst du, hier in dieser Stadt und immer noch gefangen! Diese Behandlung eines römischen Bürgers ist unerhört, wenn nicht das begangene Verbrechen sie rechtfertigt und bei dir bezweifle ich das! Wessen beschuldigt man dich?“
„Meine Schuld besteht darin, die Wahrheit gesprochen zu haben, was aber sicherlich kein Vergehen gegen das römische Gesetz ist.“
„Es ist aber doch ein Vergehen“, antwortete der Gefangene herbe. „Nun wundere ich mich nicht mehr über deine Gefangenschaft, sondern darüber, dass du überhaupt noch lebst. Versuche es einmal, am Hofe des Kaisers offen die Wahrheit zu sagen und dann sieh zu, was dir geschieht.“
„Hast du je den Namen Jesus nennen hören?“
„Gewiss, oftmals. An der Südküste ist er sehr gebräuchlich. Was soll die Frage?“
„Viel. Ich sehe, dass du ihn nicht kennst, den Jesus, der unser Herr ist – Christus, den Sohn Gottes.“
Das ganze Wesen des Juden machte einen tiefen Eindruck auf den Römer. Verwirrt schaute er durch die Fensteröffnung seiner Zelle; er sah aus, als gäbe er sich Mühe, den Sinn der bedeutsamen Worte des Sprechers zu verstehen.
„Welches Gottes?“, fragte er schließlich.
„Es gibt nur einen Gott – den Gott, der Herr über alles ist!“
„Guter Paulus“, sagte der Römer, indem er seine Arme auf den Rand der Öffnung der Tür lehnte und beim Hinausgehen sein Kinn auf den Armen ruhen ließ. „Sowohl an Alter als an Weisheit bist du mir überlegen, denn deine Augen, wenn sie durch das Dunkel in dieser Zelle dringen könnten, würden kein einziges graues Haar auf meinem Kopf entdecken. Aber als Soldat des Kaisers bin ich weit in der Welt herumgekommen. Auf jedem Berg wohnen ja Götter und ich habe nur ganz wenige Länder gesehen, wo nicht mehr als ein einziger verehrt wurde. Allein in Mazedonien, das weißt du doch selbst, wohnen auf dem Gipfel des Berges Olympus sechzig Götter und Göttinnen; und wie viele noch in den Tälern sind, weiß ich nicht einmal.“
„Still!“, sagte Paulus streng mit erhobener Hand. „Wie heißt du, unehrerbietiger Jüngling? Du hast ein gutes Antlitz und, wie ich vermute, auch einen guten Namen. Sage mir diesen, damit ich deiner in meinen Gebeten gedenken und für dich den wahren Glauben erflehen kann, der dich zum ewigen Leben führen wird.“
„Mein Name ist Fabian. Aber was für Rätsel sind das?“, rief der Gefangene trotzig, mit verdüsterter Miene. „Ich schwöre es dir, all diese neuen Glaubenslehren machen mich ungeduldig; würde ich sie alle beachten, wäre ich bald arm. Hier steht ein Tempel, dort ein anderer, hier ist ein bettelnder Zeus, dort eine hungrige Isis; es ist nur ein Wunder, dass dem Volk noch etwas zu essen übrigbleibt. Verzeih mir, guter Paulus, aber ich habe alles Recht, ärgerlich zu sein. Erst beim letzten Wettrennen im Zirkus opferte ich einem neuen Gott; aber der verlogene ägyptische Priester betrog mich und ließ mich die Wette verlieren.“
Der Ausdruck auf dem Gesicht des Paulus blieb so ernst wie zuvor.
„Darum solltest du an einem Gott glauben, dessen Diener keine lügnerischen Priester sind. Ein Gott, der dem Menschen nur in diesem Leben hilft, kann ihm wenig nützen. Du hast ein frisches Gesicht, aber es wird erbleichen, eine kräftige Gestalt, aber sie wird vergehen. Dein Leib kann eine Beute der wilden Tiere werden, aber deine Seele gehört dem Herrn!“
„Meinen Leib will ich lieber einer Göttin als einem Gott weihen, und Seele ist ein syrisches Wort, das für mich gar keinen Sinn hat. Aber ewiges Leben, ja dieses Wort hat einen angenehmen Klang.“
Der Jude lachte leise und seine Augen leuchteten. „Ewiges Leben! Wie das die Sehnsucht im Menschen erregt! Der Tod folgt den römischen Legionen; der Tod hat die Wüste mit Gebeinen besät; der Tod wartet auf jedes Menschenkind; und das Leben – ein Nichts, ein leerer Schein im Sonnenlicht! Der einzige wahre Gott ist der, der alle Dinge geschaffen hat und sie erhält, er, der im gerechten Zorn über die Welt und ihre Verderbtheit unserer Seele – das in uns, was hofft und liebt – zur Hölle verdammt hätte. Aber sein Sohn hatte um unser zukünftigen Verdammnis willen Mitleid mit uns, er kam auf die Erde, als Jesus Christus wurde er in diese Welt geboren, er lebte und litt unter uns und ließ sich schließlich, um seines Vaters Zorn zu stillen, als Opfer ans Kreuz heften, damit wir das ewige Leben haben möchten. Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.“
Der Gefangen hatte schweigend diesen Worten gelauscht. Ein Etwas in dem Wesen des Sprechenden ging ihm zu Herzen.
„Mit Freuden höre ich dich noch länger sprechen“, sagte er jetzt, „mag es auch über einen neuen Glauben sein und mich Geld kosten. In deiner Rede ist ein Klang, der mir wohltuend in die Ohren fällt. Das ewige Leben – mir ist, als hätte ich diese Worte schon aus Myrrhas Munde gehört.“
„Myrrha“, murmelte der Jude. Er senkte den Kopf auf die Brust und sprach mit ernster, weicher Stimme: „Das ist mir ein sehr lieber Name.“
„Und mir auch, mein guter Paulus“, sagte der Gefangene mit freudig blitzenden Augen. „Heißt vielleicht deine Frau so?“
Der sanfte Ausdruck in dem Gesicht des Juden verschwand und gab einem düsteren, ernsten, sogar schmerzlichen Aussehen Raum.
„Nein“, sagte er. „Myrrha war meine geliebte Schwester, die mit allen meinen schönsten Jugenderinnerungen aufs innigste verwoben ist. Ich bin selbst römischer Soldat gewesen; aber ich habe den Kaisern und ihren Heeren viel zu verzeihen. Myrrha folgte ihrem Mann nach Sizilien; sie hatte zwei Kinder, die kleine Myrrha und einen Knaben; und sie alle habe ich verloren! Obgleich ich weit herumgezogen bin und vielen hunderten von Menschen gepredigt habe, ließ mich doch Gott nirgends auch nur eine Spur der Meinigen wiederfinden.“
„Verloren!“, rief der Gefangene. „Da ich selbst Krieger bin, kann ich mir den Sinn deiner Worte denken. Gewiss sind dir die Deinen durch den Krieg entrissen worden?“
„Durch den Krieg, ja“, antwortete der Jude mit einem schweren Seufzer. „aber in Rom habe ich noch nicht gesucht – doch genug davon. Es ist eine lange Geschichte und hat kein Interesse für dich. Zur rechten Zeit wird Gott gewiss alles wohl machen.“
Paulus trat zurück und der römische Gefangene wandte sich zu seinem schlafenden Gefährten, um ihn aufzuwecken.
„He, Volgus, wach auf! Die Kerkermeister bringen unser Essen.“
Am Ende des Korridors wurde eine Türe aufgerissen; unter Waffengeklirr nahte sich jetzt die nicht aus römischen, sondern aus eingeborenen Soldaten bestehende Gefängniswache. Voraus schritten zwei Sklaven; sie trugen große Platten, auf denen Brotlaibe aufgehäuft lagen und verteilten diese im Vorbeigehen in die verschiedenen Zellen.
Der Anführer der Wache hielt vor dem am Fenster stehenden Juden an.
„Sei gegrüßt, Paulus“, sagte er, indem er seinen Speer auf den Boden stellte und sich bequem an die Wand lehnte. „Nun brauchst du nicht mehr lange im Zweifel über dein Schicksal zu bleiben. Der neue Landpfleger ist hier und bald wirst du vor ihn gerufen werden.“
„Vor den Römer!“
„Vor seinen Richterstuhl. Herodes Agrippa ist gegenwärtig auch in Cäsarea, um seine Schwester Berenike und den Landpfleger zu begrüßen. Berenike ist mit Festus von Rom hierhergereist.“
Der Jude hatte sehr aufmerksam zugehört. Sein entschlossener Charakter zeigte sich in seinem festen Blick.
„Und der Hohepriester – der Sprecher?“
„Tertullus?“
„Ja.“
„Sind alle hier. Auch haben sie einen gegen dich erregten Volkshaufen und Dutzende von Zeugen mitgebracht. Wenn ihnen daran liegt, können sie dich des Hochverrats überführen. Du sollst nach der heiligen Stadt zurückgeführt werden und auf Golgatha, wo sie deinen Herrn gekreuzigt haben, wollen sie auch dich kreuzigen. Aber die Nägel, mit denen sie dich an das Holz heften, sollen zuvor weißglühend gemacht werden und der Hohepriester Ananias hat sogar damit geprahlt, er wolle dir einen langen dünnen Stift durch den Bauch stoßen lassen.“
Ein Ausdruck der Verachtung flog über das edle Gesicht des Juden. Unerschrocken hielt er den forschenden Blick des Kerkermeisters aus.
„Ich bin bereit“, sagte er ruhig. „Es ist mein heißestes Gebet, dass ich möchte, würdig befunden werden, in die Fußstapfen meines Herrn zu treten.“
Der Wächter lachte roh.
„Auch auf dem Todesweg?“, fragte er.
„Auch auf dem Todesweg.“
„Wir dürfen zwar kein Wort gegen die Priester sagen“, rief der Soldat freundlicher. „aber den Ananias kann ich nicht leiden. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute.“
„He, Kerkermeister“, rief jetzt der Römer aus seiner Zelle. „Hast du auch einen Namen?“
„Ja, und einen sehr schönen. Ich heiße Samuel und bin aus dem Stamme…“
„Deine Abkunft“, unterbrach ihn der Gefangene schnell, „deine Abkunft will ich dir verzeihen, denn für die bist du eigentlich nicht verantwortlich und deinen Namen mögen dir die Götter deinen Eltern vergeben. Werde auch ich heute vor Gericht gestellt?“
Der Soldat steckte die Spitze seines Speers durch die Öffnung in der Türe und stieß mit seiner Waffe ganz erbost in das Dunkel der Zelle.
„Beim Barte Abrahams, das wirst du und der dicke Tölpel ebenfalls. Solltest du aber nach deiner Verurteilung in meine Hände fallen, dann wirst du mir noch mehr als nur meinen Stamm zugutehalten müssen.“
„Halt ein, du Sohn meines Volkes“, sagte Paulus. „Bittet für die, die euch beleidigen, sagt mein Herr und Meister.“
Ehe der jüdische Soldat Zeit zu einer Antwort hatte, erschollen draußen Trompetenstöße. Ihr Widerhall erklang in dem Korridor des Gefängnisses und augenblicklich ordnete der Anführer seine Mannschaft.
„Ich werde in den Gerichtshof gerufen“, sagte er zu Paulus, „doch du hast noch Zeit, dein Frühstück zu essen und dich auf dein Erscheinen vor dem Richterstuhl des Landpflegers vorzubereiten. Beeil dich aber.“
Er gab seinen Leuten ein Zeichen mit dem Speer und führte sie den Korridor entlang und durch einen Torbogen auf den Platz, der das Gefängnis von dem stattlichen Kuppelbau trennte. Schweigend sah der Jude der Schar nach, die in Reih und Glied über den Hof schritt und langsam durch den Eingang zog, der zu der Rotunde des Gerichtshofes führte.
Die Berufung auf den Kaiser
Zwei Stunden waren vergangen und die Sonne stand jetzt hoch am Himmel. Vor den Portalen des Gerichtshofes wurde das Getriebe immer lebhafter und als die Offiziere aus den umliegenden Kasernen und reiche Bürger in ihren kostbaren Heftgewändern angefahren kamen, entstand ein großes Wagengedränge. Vor dem Palast waren Soldaten aufgestellt, die die Menge in respektvoller Entfernung hielten. Heute war Festtag in Cäsarea und die Kaufleute hatten ihre Läden geschlossen, um dem bevorstehenden Schauspiel beiwohnen zu können. Der König mit seinem Hofstaat war aus Jerusalem eingetroffen, ebenso der Hohepriester und sein Gefolge; sie waren gekommen, die langjährigen, unversöhnlichen Feinde des von jüdischem Glauben angefallenen Gefangenen, des Predigers einer neuen Lehre, die ebenso viele Beleidigungen gegen die Religion der Juden enthielt als Vorwürfe gegen die in den Tempeln Griechenlands und Roms herrschenden Ausschweifungen. Heute sollte dieser Jude Paulus von dem erhabenen Konsul gerichtet werden, in dessen bewaffnete Hand die Macht und Gewalt des römischen Kaisers gelegt war. Eine ungeheure Menschenmenge erfüllte den großen freien Platz vor dem Gerichtsgebäude, denn arm und reich war zusammengeströmt, um diesen festlichen Aufzug zu bestaunen.
Jetzt ertönten von den Toren des Palastes her zwölf Trompetenstöße und ein Zug römischer Soldaten marschierte in strammer Haltung ernst und gemessen, die auf den freien Platz mündende, enge Straße herunter.
Der Anblick der Soldaten erweckte in den besiegten, friedlichen, ihre Heimat über alles liebenden Hebräern ein Gefühl ehrfurchtsvoller Scheu, die aber doch mit Bewunderung gepaart war: denn die auch in den entferntesten Provinzen stets aufrechterhaltende strenge Mannszucht des römischen Heeres verhinderte jede direkte Bedrückung der Einwohner und die Soldaten behandelten die Bevölkerung nicht unfreundlich. Wenn sie Ordnung hielten und Gehorsam leisteten, wurden die Besiegten zwar streng, aber doch nie grausam behandelt. Der römische Feldherr, bei Hof ein untertäniger Speichellecker, trat draußen als Machthaber auf und verwaltete sein Herrscheramt zwar mit Gerechtigkeit, doch auch mit großer Strenge. Im Ganzen vertrugen sich die Römer ganz gut mit den sanfteren Hebräern. Für die jüdischen Mädchen waren die prächtigen Gestalten der kaiserlichen Soldaten unwiderstehlich, deren freigebige Gutmütigkeit und derber, aber schlagender Witz sie zu sehr beliebten Kunden bei den jüdischen Händlern machten. In ihren Freistunden verkehrten die Soldaten viel mit den Bewohnern der Stadt und vergeudeten die in fremden Ländern gemachte Beute so verschwenderisch, dass der Handel auf dem Marktplatz blühte.
In dem großen Gerichtsgebäude ging es sehr lebhaft zu. An den weit geöffneten Türen, die Luft und Licht ungehindert Eintritt gewährten, standen Schildwachen, auf jeder Seite je ein römischer Soldat mit einem jüdischen Lanzenträger als Gefährten. Unterbeamte hielten die Menge von der erhöhten Tribüne im Gerichtssaal ab, auf der ein purpurner Thronhimmel errichtet war, dessen Vorhänge durch schwere Schnüre mit silbernen Quasten zurückgehalten wurden. Drei mit einem weichen syrischen Teppich belegte Stufen führten zu einem breiten thronartigen Sitz empor. Im Hintergrund der Tribüne war der Eingang zu einem inneren Zimmer, in dem sich die Richter für ihr Erscheinen in der Gerichtshalle bereitmachten und an dieser wichtigen Türe war eine aus Römern und Juden bestehende Wache in militärischer Ordnung aufgestellt. Rom trug der Empfindlichkeit seiner unterworfenen Provinz Rechnung und gewährte deren Patriziern wenigstens noch den Schein der Herrschaft.
Mit dem Ausdruck gespannter Erwartung auf den erregten Gesichtern war in einer Ecke der großen Halle eine Anzahl von Priestern in ihrer Amtstracht versammelt. Um sie her stand das Gefolge, das ebenso aufgeregt war, wie die Gebieter; die Leute sprachen leise und hastig miteinander und strichen nervös über die gelockten, salbenduftenden Bärte, die lang auf die kostbaren Gewänder herabfielen. Mit wachsender Aufregung und Ungeduld wartete die Menge; in buntem Durcheinander standen Männer und Frauen und besprachen laut und mit lebhaftem Gebärdenspiel die kommende Gerichtsverhandlung.
Der Statthalter war noch nicht erschienen, aber der Befehl, die Gefangenen hereinzuführen, war einstweilen erteilt worden; jetzt ertönte in dem zum Gefängnis führenden Gang das Geräusch ihrer Schritte, das beim Näherkommen immer deutlicher wurde. Draußen erschollen die Rufe der Obsthändler durch die rötliche Morgenluft, während die kleinen Wasserträger sich in die Halle drängten und den erhitzten Zuschauern einen frischen Trunk feilboten.
Bei dem Eintritt der Gefangenen entstand eine plötzliche Stille in der Versammlung – aller Blicke hefteten sich fest und durchdringend auf die Angeklagten. Neugier, Hass, Erwartung, all das drückten diese Blicke aus, denn der Hauptverbrecher, der heute endlich abgeurteilt werden sollte, hatte ja seit langem gegen die Religion der Juden gefrevelt und trotz des Verbotes des hohen Rates die Lehren des Nazareners gepredigt – jenes Nazareners, den das Volk hasste und der vor den Augen von hunderten der hier Anwesenden, die jetzt auch einen Jünger verderben wollten, ans Kreuz geheftet worden war. Der Hohepriester von Jerusalem und die Schriftgelehrten aus dem Tempel traten als Ankläger auf. Zum zweiten Male wollten sie der heiligen Stadt das Schauspiel einer solchen Hinrichtung verschaffen, die, wenn auch vielleicht nicht ganz so aufregend, doch der blutdürstigen Menge nicht minder willkommen gewesen wäre; denn diese sehnte sich mit echt orientalischer Gier nach dem Nervenkitzel, den ihr die Todesqualen eines ans Kreuz genagelten blutenden Menschen verursachten. Derartige Schauspiele konnte man in Rom sehen; Athen rühmte sich eines Amphitheaters und hier in Cäsarea sollte der neue Zirkus binnen kurzem durch die Gladiatoren eingeweiht werden; aber an dieses vom ganzen Volk gehasste Schlachtopfer hatte Jerusalem ein Anrecht und der Hohe Rat war gekommen, dessen Blut zu fordern.
Auf die Stille folgte bald wieder leises Gemurmel, das zu lautem Schreien und Toben anschwoll, als die Gefangenen ihre Plätze einnahmen; aber vor den erhobenen Speeren der Ruhe gebietenden römischen Wachen verstummte der Lärm schnell. Nur drei Gefangene waren heute vorgeführt worden: Paulus, der Jude, an dem die Blicke gierig hingen, Fabian sowie sein Diener Volgus, der jetzt ganz demütig hinter seinem Herrn stand. Der Jude blickte unerschrocken auf die drohende Menge; stolz und aufrecht stand er da und unter dem zurückgeworfenen Mantel wurde sein sehniger nackter rechter Arm sichtbar; Schweißtropfen glänzten auf seiner Stirn, aber seine klaren Augen schauten ohne Furcht in die finsteren Gesichter.
Fabian, der Mitgefangene des Paulus, bot beim Tageslicht eine sehr anziehende Erscheinung. Er war groß und schlank gewachsen und von geschmeidiger Gestalt. Durch die kurze Hast hatte zwar sein Gesicht etwas von seiner frischen Farbe verloren, aber doch verriet jeder Zug darin den Krieger. Seine Haut glänzte noch von der morgendlichen Waschung und in seinem für das Erscheinen vor Gericht besonders geordneten Anzug war er ein Bild männlicher Schönheit, das den Frauen Ausrufe der Bewunderung entlockte. Für die neugierige Menge war aber die Person seines Dieners kaum weniger interessant. Dieser war von riesenhafter Länge, hatte eine niedrige Stirne und große, weit auseinanderliegende Augen; zwischen den dicken Lippen glänzten kerngesunde weiße Zähne hervor. Mit der Grazie eines Elefanten schob sich der Mann auf den ihm angewiesenen Platz, schlug die stämmigen Arme übereinander und sah sich ebenso frei und ungezwungen im Saale um wie sein Herr, wobei sein Gesicht einen Zug gutmütigen Erstaunens zeigte über die Lage, in der er und sein Gebieter sich befanden.
Während Fabian sich die versammelte Menge betrachtete, trat ein spöttisches Lächeln auf seine Lippen und er neigte sich leicht zu seinem Gefährten. Die ihm zunächst Stehenden bemerkten den verächtlichen Ausdruck in seinen Zügen und schüttelten die geballten Fäuste gegen ihn.
„Eine nette Bande!“, flüsterte der Römer Paulus hörbar zu. „Das ist wohl dein Freund, der Hohepriester dort, der dich mit einem so zärtlichen Blick betrachtet? Hätte ich nur mein Schwert und die Erlaubnis des Statthalters! Im Handumdrehen wollte ich durch einen Haufen Leichen Jerusalems Platz für einen neuen Hohen Rat schaffen!“
Das gutmütige Gesicht des Riesen verzog sich zu einem breiten Lachen, als er zu den Worten seines Herrn Beifall grunzte.
„Dazu hätte ich nicht einmal ein Schwert nötig“, murmelte er.
„Ein früherer Gladiator, Paulus“, sagte Fabian, mit einer Kopfbewegung auf seinen Untergebenen deutend. „Er ist ein Freigelassener aus meines Oheims Dienerschaft, den ich mit mir nahm, als ich einer unbedeutenden Angelegenheit wegen hierherreiste. Schon der Geruch all dieses Geschmeißes hier ist dem Riesen ein Gräuel. Lass dich nur durch diese Bande nicht in Furcht jagen, ich stehe stets zu dir.“
„Und ich werde dir das nie vergessen“, antwortete Paulus lächelnd. „Im Namen Christi, dessen Apostel und Diener ich bin, verspreche auch ich, stets dein Freund zu sein.“
Jetzt ließ sich in der Versammlung wieder ein Gemurmel hören, denn hinter dem Thron wurde es lebendig und die Soldaten wichen zurück. Aus dem inneren Zimmer trat der römische Statthalter und hinter ihm schritt, in knechtischer, unterwürfiger Ehrerbietung das Haupt senkend, der jüdische König. Eine Frau von wunderbarer Schönheit folgte den beiden.
„Berenike, die Schwester des Königs“, ging es flüsternd von Mund zu Mund, während sich die Lanzenspitzen zum Gruße senkten.
Ein silberner Reif hielt die schweren, dunklen Haarmassen der schönen Frau zurück und über ihrer weißen Stirne funkelte ein Diamantstern. Ihre wallenden, seidenen Gewänder entsprachen der neuesten, römischen Mode und wie sich die weichen Falten um den herrlichen Körper schmiegten, verrieten sie mehr, als sie verhüllten, die fehlerlosen Formen, die die ganze üppige Grazie einer orientalischen Tänzerin hatten. Obgleich Berenike eine jüdische Fürstin war, hatte sie doch längere Zeit in der Kaiserstadt gelebt und war erst vor wenigen Tagen mit dem Statthalter Festus auf den Galeeren nach Palästina zurückgekehrt.
Festus und seine Gäste nahmen ihre Sitze mit umständlicher Feierlichkeit ein, ohne auf die erhobenen Arme und den allgemeinen Willkommensgruß zu achten. Der römische Statthalter saß hochaufgerichtet mit der stolzen Haltung des Herrschers da, während Herodes Agrippa, nachdem er seine Purpurgewänder um seine mit Sandalen bekleideten Füße geordnet hatte, mit würdevoller Majestät über die Versammlung hinschaute. Berenikes Augen begegneten dem neugierigen Anstarren des Volkes mit dem ruhigen Blick einer an das Befehlen gewöhnten, vornehmen Frau. Diese drei von dem Schicksal so hoch über die anderen gestellten mächtigen Menschen achteten die Volksmassen nicht höher als eine Schar Hunde. Jetzt neigte sich Berenike zu dem zwischen ihr und ihrem Bruder sitzenden Statthalter und flüsterte ihm einige Worte zu. Sie machte ihn auf die Haltung des Juden aufmerksam, der unverwandt zu ihnen herübersah. Plötzlich fiel ihr Auge auf den gefangenen Römer – und heiß stieg ihr das Blut in die Wangen.
„Was gibt es?“, fragte der Statthalter, der die Überraschung auf ihrem Gesicht bemerkte.
Sie berührte seine Schulter und ihren Blicken folgend, erkannte Festus nun auch den Gefangenen.
„Fabian Amicius!“, rief er aus. „Bist du es wirklich?“
Der Römer trat vor, während das Volk schweigend und ehrfürchtig zuhörte. Er verbeugte sich tief vor der Dame auf dem Thron, dann richtete er sich hoch auf und reichte dem Statthalter die Hand zum Gruße.
„Heil dir, mein Festus!“, rief er. „Welche Freude, dich wiederzusehen!“
„Was soll das heißen?“, rief der römische Statthalter und seine Augen schossen Blitze. „Ein römischer Tribun in jüdischer Gefangenschaft?“
„Mein Freund mit der Lanze“, sagte Fabian und sah sich nach dem jüdischen Anführer der Wache um, der mit erschrockenem, tief erblasstem Gesicht bei der Türe stand. „Der Mann aus dem Stamme – doch ich wollte ihm ja seine Abkunft verzeihen und aus Barmherzigkeit will ich vergessen, dass er Samuel heißt.“
Herodes Agrippa zog die Stirn in düstere Falten; zornig sah er um sich und der jüdische Offizier wich vor seinen drohenden Blicken scheu zurück.
„Mich trifft keine Schuld“, sagte der König leide zu Festus. „Kein Wort wurde mir gemeldet und außerdem war Felir noch hier. Doch werde ich sofort Untersuchung einleiten.“
„Ich werde selbst untersuchen und auch strafen“, antwortete Festus mit zunehmender Wut. „Was bedeutet denn dieser Vorfall, edler Tribun?“
„Es ist ein Scherz“, antwortete Fabian, „kaum wert, dich darüber zu ärgern. Ich kam in eigener Angelegenheit nach Judäa und Felir war mir niemals hold. Deshalb habe ich mich nicht an ihn gewendet, als ich gegen die jüdischen Gesetze verstieß. Die edle Berenike kann sich vielleicht den Grund denken.“
„Ich werde mir nicht den Kopf darüber zerbrechen!“, gab Berenike lachend zurück; und mit vornehmer Gleichgültigkeit, ohne der horchenden Menge zu achten, fuhr sie fort: „Wer von Rom her deine Sorglosigkeit kennt, wundert sich über nichts mehr, was du auch tun magst. Uns genügt jedoch, dass wir dich hier finden.“
„Ich werde später Licht in die Sache bringen“, sagte jetzt der Statthalter. „Bleibe hier, mein Fabian, bis die Sitzung geschlossen ist und begleite uns dann in den Palast. Und Volgus!“, fuhr er lächelnd fort, „Wie würden seine alten Kameraden lachen, wenn sie ihn hier von jüdischen Kerkermeistern bewacht sehen könnten.“
Der Riese lachte grimmig; mit einem Blick der Verachtung auf seine bisherigen Hüter gehorchte er einem Wink seines Herrn und stellte sich neben die römischen Soldaten. Mit boshaftem Vergnügen ließ er seine Augen auf dem Gesicht des unglücklichen Samuel ruhen, der sich hinter einer Säule zu verbergen suchte.
„Lass mich ein gutes Wort für den Juden Paulus einlegen“, sagte jetzt Fabian zu dem Statthalter. „Er ist geborener römischer Bürger.“
Festus richtete seine Blicke auf die bewegungslos vor dem Throne stehende Gestalt, während Fabian auf die Tribüne stieg, sich über Berenike beugte und ihr einige Worte zuflüsterte. Mit einem bei ihr ganz ungewöhnlichen tiefen Erröten hörte ihm die Fürstin zu und ihre Bekannten am kaiserlichen Hof hätten mit großer Verwunderung das Rot auf ihren Wangen bemerkt. Als sie aber nun des Bruders Auge auf sich gerichtet sah, stieß sie den Sprecher lachend zur Seite.
„Das ist Paulus, ein Jude, hochedler Landpfleger“, rief jetzt, vortretend, der Hohepriester. „Er hat sich gegen die jüdischen Gesetze verfehlt und stand deshalb vor dem Richterstuhl des Felir, deines erhabenen Vorgängers. Der huldvolle Felir hat keinerlei Friedensstörungen in Judäa geduldet, das sich ja ganz auf das Einschreiten der kaiserlichen Macht verlassen muss. Dieser Paulus hat den Tempel entheiligt und Spaltung in den Schulen gepredigt; und da er nun lange genug in der Gefangenschaft des Felir gewesen ist, bitten wir jetzt dringend, ihn nach Jerusalem führen und dort nach jüdischem Gesetz aburteilen zu dürfen.“
„Eine schöne Aussicht auf ein unparteiisches Urteil!“, bemerkte Fabian, als er die giftigen Blicke der Priester sah. „Er würde ungehört verdammt werden. Aber, beim Mars, da hat er doch ein besseres Los verdient!“
„Nur Strafe hat er verdient, hochedler Römer.“
„Zahl ihm das heim, guter Paulus“, schlug Fabian vor. „Frag ihn nach seiner Abstammung.“
„Ruhe, Fabian!“, gebot Festus.
„Er ist ein Jude“, heulte der der Hohepriester.
„Wenn das ein Vergehen wäre“, erwiderte Festus, „müsste ich ja diesen großen König hier zu meiner Rechten auch für schuldig erklären. Und wie stände es mit der schönen Frau hier neben mir, wenn schon ihr Blut ein Verbrechen wäre? Was hast du noch zu sagen?“
„Es ist kein Verbrechen, Jude zu sein, großer Römer“, sagte der jüdische Rechtsgelehrte, „wenn man nur auch wirklich als Jude lebt; ein Jude soll die jüdischen Gesetze befolgen. Übrigens hat der Landpfleger Felir eingewilligt, dass der Angeklagte, der nun einmal Jude ist, sich auch vor einem jüdischen Gericht verantworten soll. So lautet der Vertrag zwischen Rom und Judäa.“
„Der Mann spricht die Wahrheit“, sagte der König leise. „Felir hätte gleich darnach handeln sollen.“
„Ich habe bis jetzt noch keine Bestimmungen getroffen, werde mich aber in keiner Weise von dem Tun meines Vorgängers beeinflussen lassen“, sagte Festus bestimmt. „Tritt näher, Paulus!“
„Wir haben von dir reden hören“, fuhr er fort. „Diese edle Frau hier hat Interesse für die seltsamen Lehren, die du, wie man sagt, predigst. Trotz dieser Abgesandten von Jerusalem soll dir dein römisches Bürgertum wohl zu statten kommen, vorausgesetzt, dass du auch eines Römers Glauben hast.“
„Hat Rom überhaupt einen Glauben?“, fragte Paulus. Zum ersten Mal sprach er und seine Stimme klang voll und melodisch.
„Sicherlich“, sagte der Statthalter, Paulus voll Erstaunen ansehend. „Roms Glauben hat das Schwert der ganzen Welt verkündet: Treue dem Kaiser, Gehorsam den Göttern und Vorherrschaft dem römischen Volk!“
„Diesen Glauben lehre ich nicht“, antwortete Paulus kühn.
„Höre ihn, edler Festus“, rief der Priester. „Er bekennt weder den Glauben der Römer noch sonst einen, der der Beachtung wert wäre. Er ist ein Zauberer aus Tarfus, ein Tempelschänder und ein vom Glauben seiner Väter Abtrünniger. Gib ihn in unsere Hände!“
Festus schwieg, während Paulus seinem Ankläger ruhig in die Augen sah. Aber Fabians Benehmen gegen die Schwester des Königs war ihm aufgefallen und er richtete jetzt seinen Blick prüfend auf den jungen Mann. Er bemerkte die Erregung der Fürstin sehr wohl und erkannte trotz der anscheinenden Gleichgültigkeit des Paares Zeichen eines alten vertraulichen Verhältnisses. Das machte Paulus nachdenklich und erst die Worte des Statthalters lenkten seine Aufmerksamkeit wieder auf die für ihn so wichtige Verhandlung hin.
„Das sind schwere Anschuldigungen, die gegen dich erhoben werden und deine eigenen Worte scheinen sie zu bestätigen“, sagte Festus streng. „Was hast du dagegen zu sagen?“
„Ich habe eine Mission auszuführen“, antwortete Paulus. „Sonst wäre ich gerne bereit, nach Jerusalem zurückzukehren und mich dort, wie schon früher, meinen Anklägern gegenüberzustellen, sogar vor allem Volk. Wie der König vielleicht weiß, habe ich das schon Felir gesagt.“
Agrippa machte eine abwehrende Handbewegung.
„Lass mich aus dem Spiel“, sagte er zornig. „Wenn ich dich zu richten hätte, würde ich wenig Worte machen.“
„Du bist nicht vom Stamm Seiner Majestät, guter Paulus“, bemerkte Fabian kühl. „Ich sagte dir doch, mein Festus, dass er römischer Bürger ist.“
„Du sagst viel, wenn der Tag lang ist“, erwiderte der Statthalter ärgerlich.
„Ich will ihn dafür bestrafen“, sagte Berenike und schlug kokett mit ihrem Fächer aus Pfauenfedern nach Fabian. Dann wandte sie sich aufmerksam Paulus zu, der fortfuhr:
„Der Finger dessen, dem ich diene, deutet nach Rom und nicht nach Jerusalem. Wie er mich führt, so gehe ich. Mir ist es nicht beschieden gewesen, meinen geliebten Herrn und Meister, den man ans Kreuz geschlagen hat, zu sehen, solange er noch hier auf Erden weilte. Erst nach seinem Tode ist er mir in himmlischer Klarheit erschienen!“
„Nach seinem Tode?“, wiederholte Festus. „Mensch, was redest du?“
„Höre, wie er lügt!“, schrie der Priester. „Der überspannte Gottesleugner!“
„Stille!“, gebot der römische Statthalter streng. „Du hast ruhig mit mir zu sprechen!“
„Ich gehöre zum Tempel“, war die in kaum unterdrückter Auflehnung gegebene Antwort. „Ich bin der Hohepriester.“
„Ein recht unangenehmes Amt – wenn es dich unverschämt macht“, sagte Fabian trocken. „Ein römischer Statthalter kann dem Pluto sogar Könige zuschicken.“
„Den Pluto kenne ich nicht“, antwortete der Hohepriester grimmig. „Überdies spreche ich mit dem Landpfleger, nicht mit dir.“
„Wie fein er sich beträgt“, sagte Fabian lachend. „Hast du ihn gehört, mein Festus?“
„Friede!“, erwiderte der Statthalter leise lächelnd, während der Hohepriester mit den Zähnen knirschte. „Sprich weiter, Paulus!“
Der Jude änderte jetzt seine ganze Haltung. Voll edler Majestät stand er da und streckte mit befehlender Handbewegung seinen Arm aus. In seiner Stimme lag ein tief ergreifender Ton, als er langsam und bei der im Saal herrschenden atemlosen Stille allen deutlich vernehmbar zu sprechen anhob:
„Du, edler Festus, warst zu jener Zeit, von der ich jetzt rede, noch nicht geboren, aber dein Vater lebte und hier sind noch viele, die sich dieser Zeit erinnern können. Damals, als der neue Stern, von dem auch du gehört hast, am Himmel erschien, ist zu uns Juden und zu der ganzen Welt ein Kind vom Himmel herabgekommen. Es wurde in Bethlehem in einem Stall geboren und in eine Krippe gelegt. In den jüdischen Schriften war das Kommen eines Messias schon seit langer Zeit vorhergesagt, aber nur wenige wussten, dass dieses Kind der erwartete Messias sei. Ein großes Werk hatte ihm Gott aufgetragen und eine hochgesegnete frohe Botschaft brachte er uns. Er kam vom Himmel, um die Welt aus ihrer Sündennot zu erlösen und alle Mitmenschen vom Tode zu erretten.“
„Schade, dass ihm sein Werk augenscheinlich missglückt ist“, sagte Festus mit nachsichtigem Lächeln, „denn seine Anhänger sterben ja auch noch wie andere Leute. Und er selbst ist doch auch gestorben, nicht wahr?“, fuhr er, den Juden neugierig ansehend, fort.
„Ja!“, rief Paulus mit weithin schallender Stimme und hocherhobenen Armen. „Er, unser Herr und König, ist am Kreuz gestorben. Einen jammervollen Tod hat er für mich, für dich, für die ganze Welt erlitten. Für alle Menschen hat er sein Leben dahingegeben und als sein Werk vollbracht war, ist er als der Erste wieder auferstanden und hat uns allen damit die Gewissheit eines Lebens nach dem Tode gegeben.“
„Uns allen?“, fragte Festus erstaunt, indem er sich vorbeugte und mit dem Finger auf sich selbst deutete. „Meinst du damit auch mich?“
„Er ist für den Kaiser so gut wie für die ganze übrige Menschheit gestorben“, antwortete Paulus mit feierlich erhobener Hand. „Aber damit die Menschen des Himmels und des ewigen Lebens auch wert würden, forderte der Herr ein reines Leben schon in dieser Welt. Kein Wunder, dass, wer ihn hörte, ergriffen wurde; solche Worte hatte man noch nie zuvor auf Erden gehört. Er hat uns geboten, alle Menschen mit Barmherzigkeit und Liebe zu umfassen.“
Der römische Statthalter blickte auf die holde Frauengestalt an seiner Seite, aber der zärtliche Ausdruck in seinen Augen ließ aus diesen weißen Wangen nicht die Rosen erblühen, die sein Freund dort hervorgerufen hatte. Mit jeder Miene gab Berenike seinen Blick zurück und nickte dann Paulus zu.
„Das ist eine sehr schöne Lehre, Paulus, die wir aber schon lange befolgen“, sagte Festus. „Venus hat gar viele Tempel.“
„Die Liebe, die mein Herr und Meister predigt, übersteigt alle Frauenliebe“, antwortete Paulus. Seine Stimme wurde immer mächtiger und seine strengen Züge wurden weicher. „Er verlangt Liebe für unseren Nächsten – die Liebe, die Mitleid mit unseren Tränen hat und diese trocknet, die Liebe, die zerschlagene Herzen tröstet und ihnen in der Dunkelheit und in der Nacht den Weg zu den ewigen Sternen weist, die den Armen und Schwachen hilft und uns lehrt unseren Feinden zu vergeben!“
„Eine sehr lobenswerte Lehre, aber nichts für einen Römer“, meinte Festus. „Sie passt weit eher für die sanften Hebräer. Ich wundere mich nicht mehr, dass der Hohepriester über dich erzürnt ist, da du ihm ja die schönsten Vorrechte seines Amtes genommen hast. Übrigens, Agrippa“, und Festus wandte sich zu dem mürrischen Monarchen an seiner Seite, „wenn du die Lehren dieses Mannes befolgen willst, werden wir nur eine milde Herrschaft zu führen haben.“
„Christus selbst herrscht über uns alle“, sagte Paulus. „Nicht mit Krone und Zepter, die von dieser Welt stammen – sie sind nur von wesenlosem Scheine – nein, sein Königreich liegt in den Herzen der Menschen.“
„Das wird der Kaiser sicher nicht für Hochverrat halten“, sagte Fabian. „Vielmehr macht Paulus Übergriffe in das Reich, wo Berenike herrscht.“
„Der Mann spricht gut“, sagte Festus. „Weiter!“
„Früher habe ich die Waffen des Kaisers getragen“, fuhr Paulus fort. „Als ich einst mit meinen Soldaten nach Damaskus zog, um auch dort die Christen zu verfolgen, erschien mir der Herr des Himmels, der Herr, der am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist. Meine Leute hörten den furchtbaren Donnerschlag, der uns alle zu Boden streckte und befanden sich selbst in der tiefen Finsternis, die uns plötzlich umgab; aber die Stimme, die zu mir sprach, hörten sie nicht. Meine Augen wurden für alles Irdische mit Blindheit geschlagen, aber die himmlische Klarheit, die mich umstrahlte, sah ich wohl. In seiner Güte hat Gott nach drei Tagen die leibliche Blindheit wieder von mir genommen. Seither habe ich, was mir damals geoffenbart worden ist, überall gepredigt. Es ist das Wort des Lebens für alle, die es annehmen.“
„Das alles klingt höchst wunderbar“, sagte Berenike, von dem ganzen Wesen des Juden tief ergriffen. „Paulus scheint mir aufrichtig zu sein. Kann er nicht mit uns allein reden?“
Festus nickte zustimmend, heftete aber seine Augen fest auf Paulus, der fortfuhr:
„Ich bin ein römischer Bürger, hochedler Festus. In vielen Städten habe ich schon gepredigt und möchte nun nach Rom gehen. Ich berufe mich auf den Kaiser.“
„Es sei dir gewährt“, antwortete Festus und sah mit gerunzelter Stirne die wutentbrannten Priester an, die bei dieser Entscheidung in lautes Murren ausbrachen. „Deine Worte lauten ganz schön, aber für einen Mann, der ein Schwert trägt, haben sie keinen Sinn. Ein Soldat vergibt seinen Feinden nie und Roms Macht liegt im Krieg und nicht im Frieden. Deine Gelehrsamkeit hat dich zum Dichter, aber auch verrückt gemacht.“
„Wir dürfen ihn wirklich nicht mit uns nehmen?“, rief der Hohepriester sehr ergrimmt.
Festus stand auf und winkte einem Hauptmann.
„Wirf den Pöbel hinaus!“, befahl er.
Die jüdischen Abgesandten stießen einen Wutgeschrei aus und das Volk stimmte mit ein. Im Vertrauen auf die Anwesenheit der Priester und die Macht des Königs stürzte die Menge auf die Tribüne zu.
Ein verächtliches Lächeln lag auf Fabians hübschen Gesicht, als die römischen Wachen dem Angriff entgegentraten und die Menge mit den vorgehaltenen Lanzen zurückdrängten. Blind vor Wut und in der Hoffnung, der Tempelschänder möchte in dem Durcheinander getötet werden, reizten die Priester das Volk zu immer neuem Vordringen auf. Fabian stieg die Stufen herunter und stellte sich neben den Gefangenen; ihm zur Seite pflanzte sich die Riesengestalt des Volgus auf. Furchtlos, aber mit glühendem Interesse, einem Gefühl, das von dem römischen Statthalter geteilt wurde, sah Berenike dem Tumult zu.
„Genug!“, rief endlich Festus mit lauter, durch die ganze Halle tönender Stimme. „Ruhe!“
Auch Agrippa gebot Ruhe. An der Seite des römischen Befehlshabers stehend, winkte er seinen Soldaten, der römischen Wache Beistand zu leisten. Doch das war nicht nötig. Die bestürzten, unterlegenen Priester zogen sich zurück und die Menge folgte ihnen aus der Gerichtshalle auf die Straße.
„Du wirst in den Palast gebracht werden, Paulus“, sagte Festus, vom Thron herabsteigend, freundlich zu dem Gefangenen. „Bis ich dich nach Rom schicken kann, übergebe ich dich der Obhut meines Hauptmann Julius. Die edle Berenike möchte später noch Weiteres von dir hören und auch ich habe diesen Wunsch. Einstweilen, mein Fabian, will ich beim Wein Näheres über deine Angelegenheiten hören. Die Gerichtssitzung ist geschlossen.“
Berenike
Begleitet von Agrippa, Berenike und Fabian ging Festus durch den Säulengang, der den Palast mit dem Gerichtshof verband und gelangte in einen von einer Säulenhalle umgebenen achteckigen Hof, von dem aus Türen in die verschiedenen Gemächer führten. Hier entließ er seine Leibwache und auch der jüdische König zog sich gleich zurück, um sich zum Mittagsmahl bereit zu machen. Berenike sprach noch einige Augenblicke mit Fabian, nickte dem Statthalter freundlich zu und entfernte sich. Als sie allein waren, setzte sich Festus auf eine mit Kissen belegte Ruhebank zwischen den Säulen und winkte Fabian, an seiner Seite Platz zu nehmen.
„Erzähle mir nun deine Erlebnisse“, begann Festus. „Ich bin noch starr vor Verwunderung, dich hier zu sehen, trotz Berenikes Ausspruch, von dir sei einfach alles zu erwarten. Als ich vor einiger Zeit von Thessalien nach Rom zurückkehrte, vermisste ich dich dort allerdings; aber ich hatte keine Gelegenheit, bei deinen Verwandten nach dir zu fragen. Deinen guten Oheim bekam ich gar nicht zu Gesicht, aber im kaiserlichen Palast sah ich von einem Balkon aus, der auf die Gärten hinausgeht, einen Augenblick deine zwei holden Basen. Sie machten gerade mit der edlen Fulvia einen Respektsbesuch bei Poppäa. Nero selbst bemerkte die jungen Mädchen und machte mich auf ihre Grazie und Schönheit aufmerksam. Du bist zwar mit Leib und Seele Soldat; aber, wenn du einer dieser Jungfrauen herumführtest, würde dein Leben doch unendlich reicher werden, selbst wenn du dann nicht mehr zu Felde ziehen könntest. Freilich, die Wahl zwischen den beiden ist schwer, beide passen für dich, beide sind gleich schön.“
„Ja, gewiss, man könnte von Britannien über Ägypten hierherreisen und würde doch nirgends ihresgleichen finden“, antwortete Fabian warm. „Ich habe beide Mädchen herzlich lieb, aber in mir steckt leider nur ein schlechter Ehemann. Allerdings könnte ich die Versuchung – wenn ich würdig wäre – doch nein, lass uns von etwas anderem reden.“
„Gut. Also von deinem Auftrag hier. Was wollte denn der Kaiser in dieser Gegend, das er Felir nicht anvertrauen konnte? Wenn er mir nachspionieren ließe, wäre mein Posten hier bald frei.“
„Aber ich bin doch kein Spion; selbst Felir ist sicher vor mir“, sagte Fabian lachend. „Mein Auftrag war nur ein Vorwand; meine Reise hatte einen anderen Grund.“
„Dann will ich dich nicht weiter fragen, sondern zu etwas anderem übergehen.“
„Den Grund meines Hierseins brauche ich nicht geheim zu halten, wenigstens nicht vor dir, mein Festus. Du hast vorhin von meinen zwei Basen gesprochen; aber nur Valentina ist meine Verwandte, Myrrha ist nach dem Gesetz meines Onkels Leibeigene.“
„Wie?“, rief Festus erstaunt aus. „Das wusste ich ja gar nicht!“
„In Rom hat man es beinahe vergessen, aber Myrrha ist wirklich eine Kriegsgefangene, die mein Oheim aus dem Osten mitheimbrachte, als er mit den Heeren des Claudius von einem Feldzug zurückkehrte. Das Mädchen wurde stets wie eine Tochter gehalten und wie eine Tochter geliebt, aber trotzdem liegen die Verhältnisse so, wie ich dir eben sagte. Doch merkwürdig, auch Kinder haben bestimmte Erinnerungen. Myrrha hatte einen Bruder, dessen Andenken ihre Mutter, solange sie lebte, in des Kindes Herzen lebendig erhielt. Wie ihr Vater ums Leben gekommen ist, weiß Myrrha nicht genau und sie wagte nicht, meinen Onkel danach zu fragen; dazu ist sie zu sanft, denn er wollte, sie solle vollständig vergessen, dass sie außer ihm noch irgendwelche Verwandte haben könnte. Ihre Heimat ist Judäa, das hat sie oft gefragt und ich weiß, dass sie nur schweren Herzens an die Ihren denkt. Deshalb zog ich einen Isispriester zu Rat und der hat mir seltsame Dinge berichtet. Der Bruder sei nicht tot, sondern lebe unter fremdem Namen. Er werde aber der ihn betrauernden Schwester einst wiedergeschenkt werden. Da nun dieser Ausspruch Myrrha beunruhigte, versprach ich ihr, ihren Bruder zu suchen und deshalb unternahm ich auf dieses törichte Luftgebilde hin die Reise hierher, um nach einer Spur des Bruders zu suchen. Könnte ich nur einigermaßen gute Nachrichten mit nach Hause bringen!“
„Deine Reise war jedenfalls ein mutiges Unternehmen und ehrt dich“, sagte Festus. „Sollten deine Bemühungen bis jetzt erfolglos gewesen sein und meinst du, meine Macht könne dir nützen, so stehe ich dir gerne zu Diensten.“
„Ich kam nur aufs Ungewisse und schenke dem verlogenen Priester wenig Glauben. Auch habe ich daheim den Grund meiner Reise nicht angegeben. Das Sehen meiner süßen Base finde ich aber ganz natürlich.“
„Und ebenso natürlich finde ich, dass du mit ihr fühlst“, antwortete Festus lachend. „Dein Misserfolg tut mir herzlich leid, aber der Krieg verwischt eben gar zu leicht jede Spur. Wann beabsichtigst du heimzureisen?“
„So bald als möglich. Im Fall du die Galeeren zurückschickst, möchte ich sie gerne benützen.“
„Sie fahren nach der Südküste“, erwiderte der Statthalter.
Seine Stirn umzog sich, trübe schaute er zu Boden, dann aber richtete sich sein Blick zu der Decke der Säulenhalle empor, in die aus dem offenen Hof der herrliche Sonnenschein mit goldenem Glanze hereinflutete.
„Könnte ich nur mit dir zurückkehren“, fuhr Festus fort. „Auch die Macht hat ihre Grenzen und der Herrscher über eine Provinz ist oft nur der Sklave seines Amtes. Des Kaisers Günstlinge leben in einer Üppigkeit, gegen die selbst die Pracht des Tiberius verschwindet. Auch ich hätte den Aufenthalt in Rom verdient. Du, der du dich von aller Politik fern hälst und nur Soldat bist, du kannst leben, wie und wo es dir gefällt. Doch sage mir, wie kamst du denn ins Gefängnis?“
„Durch einen Zufall. Ich war in eine Schlägerei verwickelt worden und schämte mich, es in Rom bekannt werden zu lassen. Felir hätte die Sache sicher gemeldet; ich ließ mich deshalb lieber ein paar Tage von den Juden in Gewahrsam halten. Wärst du nicht gekommen, so hätte ich die Wächter bestochen und wäre entflohen.“
Belustigt lachte Festus laut auf.
„Ganz sicher hätte Felir die Geschichte deinem Onkel, deinen Basen, dem Kaiser und jedem Tagedieb und Faulenzer bei Hof erzählt. Doch genug davon. Felir ist abgereist und geht neuem Ruhm und, wie ich innigst hoffe, dem Schwert eines Barbaren entgegen. Mir war er stets höchst zuwider.“
„Er war sehr wenig beliebt“, bemerkte Fabian. „Aber genau genommen ist das kein Maßstab für seine Verdienste. Doch auch ich habe nichts dagegen, wenn er einem Barbaren in die Hände fällt.“
Nach einer kleinen Pause begann Festus nachdenklich: „Dieser Paulus erweckt in mir ein seltsames Interesse; vielleicht weil ich hier ein mir ganz fremdes Volk beherrschen soll, ein Volk mit Adlernasen und Adleraugen. Liebe deine Feinde! Wie stünde es da mit Berenike, die ich übrigens nicht zu meinen Feinden rechne und mit Felir, von dem wir eben sprachen? Diese neue Religion würde den ganzen römischen Hof auf den Kopf stellen.“
„Und der weichherzige Nero! Dann wäre ja seine Mutter noch am Leben und könnte ihn zurechtweisen; und Britannicus...“
„Nimm dich in Acht, mein Fabian“, warnte Festus. „Obgleich diese korinthischen Säulen auf hebräischen Sand stehen, könnten sie doch einen Widerhall bis nach Rom tragen.“
Jetzt lachte Fabian.
„Vorsichtig ist dieser Paulus nicht“, sagte er. „Wäre er klug, so könnte er seine Berufung auf den Kaiser rückgängig machen. Wenn er aber nach Rom geht, werde ich treu zu ihm stehen. Da er keine Furcht kennt und frei herausredet, sehe ich ihn schon deutlich in der Arena zwischen den Löwen. Doch sag mir, was ist das Neueste vom Hofe? Wie steht´s mit der Gesundheit des Kaisers? Schon einige Zeit vor meiner Abreise habe ich mich vom Hofe ferngehalten; aber ein außerhalb Roms verlebter Tag ist gleich einem verlorenen Jahr. Damals war Seneca bei Nero in Ungnade. Steht er wohl jetzt wieder in der kaiserlichen Gunst? Da hast du den wahren Philosophen! Er kennt nicht nur alle Weisheit der alten Ägypter, sondern weiß auch, welcher Rennwagen im Zirkus Maximus gesiegt hat. Es ist eine wahre Freude, zuzusehen, wie er seiner nächsten Wette wegen, die Muskeln eines Ringkämpfers befühlt und dabei einen Vortrag über das Unheil hält, das alle diese Spiele über die Griechen gebracht haben.“
„Hör´, Fabian, da kommt mir ein Gedanke, dessen Ausführung dir sicher bei deiner Rückkehr den Ehrenplatz am Hof verschaffen kann“, sagte Festus. „Du solltest zwischen dem Juden und Seneca ein Wortgefecht veranstalten und Nero als Schiedsrichter müsste sein Urteil in einem Gedicht abgeben. Als passender Höhepunkt des Vergnügens könnte er dann beide Redner den Löwen vorwerfen lassen. Nach Senecas Besitztümer ist er ja ohnehin schon lange lüstern.“
Über diese Rede brachen beide in lautes Lachen aus; dann fuhr Festus fort:
„Ich wollte nur, du bliebest einige Zeit hier; es wird hier langweilig werden.“
„Mich kannst du leicht entbehren. Du hast ja Berenike.“
Die Miene des Statthalters umzog sich wieder.
„Sie kehrt auch nach Rom zurück. Der Glanz des Hofes lockt sie und mich hält meine Pflicht hier fest. Mit dem ersten Schiff will sie abfahren; ich glaube, der verräterische fuchsäugige Agrippa steckt dahinter. Er sucht seinen Einfluss auf den Kaiser festzuhalten und ich weiß, Berenike lächelte auch dem Felir zu, als ihm die Macht hier übertragen wurde. Hast du den jüdischen König beobachtet? Wenn ich sicher wüsste, dass er seine Schwester dazu überredet hat, würde der Kaiser wohl bald die Nachricht bekommen, der König sei tot im Keller seines Palastes gefunden worden und es sollte schwerfallen, den Täter zu finden.“
„Gemach, mein Freund. Wenn du so heißes Blut hast, tust du gut daran, nur sehr vorsichtig von den Weinen dieses durstigen Wüstenlandes zu trinken. Sonst könnte es geschehen, dass man nicht den Agrippa tot im Keller, wohl aber den römischen Statthalter am Fieber sterbend in seinem Palaste fände. Halte dir nur einen guten Arzt.“
„Ein gutes Schwert will ich bereithalten. Ach, ich wollte, ich könnte mit dir nach Rom zurückkehren.“
Festus stand auf, streckte seine Arme aus und sah sich mit düsteren Blicken in der prächtigen Halle um.
„Ohne Freunde ist man hier doch nur wie in einem Gefängnis“, fuhr er fort. „Allerdings habe ich noch die Götter, sowohl die griechischen als die römischen, zum Troste, und die Religion dieser Hebräer kann ich mir auch etwas näher betrachten; sie verschafft ihnen wenigstens den Genuss der Aufregung. Hast du bemerkt, wie die Priester diesen Paulus hassen? Es muss doch eine Wonne sein, ein solch unbedeutende Sache so tief empfinden zu können! Agrippa hat mir erzählt, unter Pilatus hätten die Juden den Lehrer des Paulus gekreuzigt. Wer würde den Juden Freude an solchen Belustigungen zutrauen? Gut in Szene gesetzt, wäre eine derartige Hinrichtung gewiss so anziehend wie die Arena. Schlage das doch einmal dem Nero vor.“
„In solchen Dingen ist Nero selbst ein Genie und außerdem ist das nicht meine Sache“, sagte Fabian bedrückt. „Mir ekelt vor diesen Spielen.“
„Was, dir, einem Soldaten, der bis an die Knöchel im Blut gewatet hat! Erzähl´ das nur dem Tigellinus!“
„Sogar dem Jupiter wollte ich es mit Freuden erzählen, wenn dadurch Tiggellinus von der kaiserlichen Tribüne in die Arena heruntergestoßen würde. Er hat die Blutgier eines Löwen und das Mitleid eines Schakals.“
„Und die Gunst des Kaisers! Wenn uns unser Leben lieb ist, dürfen wir das nicht vergessen. Doch nun muss ich gehen. Du bist hier zu Hause, mein Fabian. Im nördlichen Flügel ist ein römisches Bad mit griechischer Bedienung.“
Fabian erhob sich und blieb stehen, bis der Statthalter verschwunden war. Als er sich dann auch zum Gehen anschickte, stutzte er über ein leises unterdrücktes Lachen. Neugierig sah er sich in der großen Halle um und bemerkte nun die Schwester des Königs, die hinter einer der Marmorsäulen hervorlugte.
„Wie du siehst, habe ich euch belauscht“, rief sie. „Das ist ja das Vorrecht der Frau – einen doppelzüngigen Politiker und einen fahrenden Ritter.“
Fabian lächelte Berenike freundlich zu und deutete auf die Bank, von der er eben aufgestanden war.
„Nein“, sagte sie mit einem Blick auf die Türe, hinter der Festus eben verschwunden war. „In diesem Palast gibt es auch weniger leicht zugängliche Gemächer. Komm!“
„Du weißt, dass ich ein gutes Gedächtnis habe“, sagte der Römer. „und dennoch, trotz meiner traurigen Erfahrungen würde ich dir – allein, fern von der Heimat, in einem Land, wo die römischen Götter keinen Schutz gewähren, ohne alle Vorsicht – selbst bis nach Hybernien folgen.“
„Wo liegt denn dieses Land?“, fragte die Fürstin lachend. „Nordwestlich von Rom. Es ist das Ende der Welt, wo der Rand der Erde auf den Rücken der olympischen Elefanten ruht. Jupiters Winterland mit dem bodenlosen Abgrund. Dort wohnt die Venus in einer blauen, mit Schnee umsäumten Wolke.“
„Venus! Wie doch die Gedanken der römischen Krieger immer wieder zu ihr zurückkehren! Sonderbar, dass die Griechen ihren Zeus eine andere Frau gaben! Ihr sind Tausende von Bildsäulen errichtet und doch kenne ich Frauen, die ebenso schön sind.“
„Ich kenne nur eine einzige“, lautete Fabians Antwort.
Berenike lächelte wieder und verließ in Fabians Begleitung den Hof durch einen Torbogen, der zu den Frauengemächern des Palastes führte.
Bald erreichte das Paar einen wohlgepflegten Garten, wo unter reichblühenden Rosenbäumen eine Bank mit herrlicher Aussicht auf das Meer stand. Von hier aus konnte man auch den neuen Kai erblicken, auf dem die unzähligen Arbeiter nur kleine schwarze Punkte zu sein schienen. Weiter draußen sah man die stolzen Galeeren sich auf den grünen Wellen schaukeln.
„Kehrst du bald wieder nach Rom zurück?“, fragte Berenike, nachdem sie sich gesetzt hatten.
„Gewiss. Mein Auftrag hier ist erledigt. Wie mir Festus sagte, fährt nächstens ein Schiff ab und du hast ja selbst gehört, dass Paulus unter der Obhut des Hauptmanns Julius auch mitreisen soll. Ich habe versprochen, ihm am kaiserlichen Hofe beizustehen.“
Berenike sah den Sprecher schelmisch von der Seite an, während sie mit den Rosen spielte, die er gepflückt und ihr in den Schoß geworfen hatte.
„Auch ich kehre nach Rom zurück.“
Lachend sah er ihr voll ins Gesicht und ergriff ihre Hand, aber seine Finger zitterten dabei nicht mehr im Glück seliger Erregung wie in vergangenen Tagen.
„Hast du vergessen?“, fragte Fabian. „Du sagst das mit so schelmischem Lächeln, mit so süßer Stimme, dass ich eigentlich vor Erstaunen auffahren wollte! Ach, welche Freude! Sollte ich beim Gedanken an eine gemeinschaftliche Reise ausrufen!“
Mit funkelnden Augen zog Berenike ihre Hand heftig zurück. Ihre Lippen bebten bei seinem leichten spöttischen Ton und ihre Züge konnten die bis ins Innerste verletzte Eitelkeit der Orientalin nicht verbergen. Aber bei Fabians sichtlicher Verwunderung legte sich ihr Zorn bald wieder.
„Mit dieser himmlischen Botschaft hast du mich zu überraschen gemeint“, sagte er, „und du standest doch hinter dem Pfeiler neben Festus und hörtest, wie er in Trauertönen Kunde von deiner Abreise gab. Ein doppelzüngiger Politiker und ein fahrender Ritter können es nicht mit der Schwester eines Königs aufnehmen, die am römischen Hofe gelebt hat.“
Jede Spur des Ärgers schwand von Berenikes Angesicht und aus ihren Augen strahlte neuer Glanz.
„Davon habe ich kein Wort gehört. Hat dir Festus das wirklich gesagt?“
Fabian ließ einen leisen Pfiff hören, jenen Ton, der seit Anbeginn der Welt den Zweifel des Mannes an der Wahrhaftigkeit der Frau ausgedrückt hat.
„Nein, wahrhaftig, ich habe es nicht gehört“, versicherte die Fürstin. „Ich spreche die Wahrheit.“
„Wenn du die Wahrheit sprichst, will ich mein Schwert entzweibrechen“, erwiderte der Römer. „Meine Rüstung will ich meinen Dienern geben und selbst als der Unterwürfigste von allen deinen Verehrern mit einem Fächer aus Pfauenfedern hinter dir hergehen. Ich hatte zwar deinen Dienst verschworen und glaubte mich von dem Zauberbann deiner Augen gerettet zu haben, aber – ich gelobe mich deinem Dienst!“
„Du sollst diesen Posten bekommen und den Fächer auch. Auf der Reise nach Rom werde ich dich dann deine Pflichten lehren. Gedenke an deine Worte!“





























