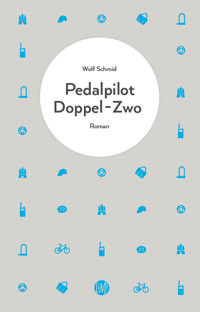
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Liesmich Verlag UG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der spontane Besuch des gerade pensionierten Paketwagenfahrers Walter bei seinem Sohn Johannes in Hamburg bringt die sicheren Mauern ins Wanken, hinter denen die beiden sich schon seit Langem zurückgezogen haben.Als sich Johannes alias Fahrradkurier 'Doppel-Zwo' bei einem Radunfall das Schlüsselbein verletzt, springt der Vater kurzerhand als 'Doppel-Zwo Senior' für ihn ein. So lernt Walter die Kurierszene Hamburgs, die dort geltenden Regeln und die eigenwilligen Menschen hinter den Funkgeräten kennen.Nebenbei holt er noch das eine oder andere Versäumnis seinem Sohn gegenüber nach ein Coming of Age im Rentenalter.Pedalpilot Doppel-Zwo ist ein unangepasster Entwicklungsroman, der die Leser mitnimmt zu den schönsten Rastplätzen und Aussichtspunkten der Elbe-Stadt.Mit Hamburg-Karte und literarischem Glossar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
as my bones grew they did hurt
they hurt really bad
I tried hard to have a father
but instead I had a dad
Nirvana – Serve the Servants
Einundsechzig Jahre lang kreiste Walter um die Schatten, die das Leben ihm vor die Füße warf. Dann wagte er einen Schritt aus seiner Komfortzone heraus und nichts war mehr wie zuvor. Zunächst stand er vor der Haustür von Madeleine Fall und wartete, dass sie öffnete. Eine Windböe blies ihm die Postlermütze über die Augenbrauen. Er rückte die Mütze gerade, schüttelte die Nässe von den Jackenärmeln und trat in den Windschatten näher an der Tür. Er räusperte sich. Das Vogelgezwitscher und die milden Temperaturen vom Vortag hatten die Hoffnung geschürt, dass auch dieser Winter ein Ende finden würde, aber in der Nacht waren die Schneefallgrenzen wieder gefallen, sämtliche Taupfützen übergefroren, und nun graupelte es schon den ganzen Nachmittag.
Madeleine öffnete die Tür einen Spalt weit, warf einen Blick nach draußen, fröstelte und bat Walter in ihren lichten, von einem cremigen Duft erfüllten Flur. Sie war eine zierliche Frau, aber ihre Stimme tönte voll und warm. Walter tat einen gezielten Schritt auf den Schuhabtreter, damit bloß nicht die Flurdielen nass wurden. Sie waren aus geräucherter Roteiche und nicht ganz billig gewesen. Er selbst hatte sie vor Jahren in fünf übergewichtigen Packstücken zugestellt und Madeleine bestand grundsätzlich auf seine Gesellschaft, während sie ihre neusten Anschaffungen inspizierte.
Sie hatte Mühe, die Tür ins Schloss zu drücken, so kräftig blies der Wind. Sie drehte sich nach Walter um und fragte, was er ihr Schönes brachte.
»Ich glaube, es sind wieder Bücher, und eisiges Wetter dazu«, sagte er.
Sie winkte ab. »Aber Herr Schmeck, wenn Sie für das Wetter zuständig wären, dann, bin ich überzeugt, würde es so etwas überhaupt nie geben«, sagte sie, nahm das Paket, riss einen Streifen aus der perforierten Pappe und zog erwartungsvoll an einem breiten Buchrücken.
Es war ein Bildband mit den angeblich schönsten Schnittblumen der Welt. Sie legte den Karton auf die Kommode in ihrem Rücken, hielt den Band mit erstaunlicher Leichtigkeit auf ihrem linken Unterarm, blätterte Seite für Seite um, und achtete darauf, dass auch Walter gut sehen konnte. Manchmal hielt sie inne, flüsterte den Namen einer Blume oder sinnierte über ihren Duft. Walter hüstelte von Zeit zu Zeit. Das tat er immer, wenn er in Verlegenheit gebracht wurde, und ihn in Verlegenheit zu bringen, war grundsätzlich nicht schwer.
Gut fünf Minuten vergingen, sie waren im letzten Drittel des Buches angelangt, da suchte sie seinen Blick.
»Sehen Sie nur, Herr Schmeck. Diese Blüte, diese Pracht.«
Sie tastete mit den Fingerspitzen über das matte, schwere Papier, als könnte sie die Oberflächenbeschaffenheit der Kelch- und Kronblätter spüren.
»Eine Chrysantheme, Herr Schmeck. Sie glauben nicht, wie sehr mich ihr Anblick rührt. Diese Blume, rostfarben, in einem schmalen Strauß gebunden, ist für mich das Schönste, Herr Schmeck. Das Schönste!«
Ihr rechter Ellbogen berührte Walter zwischen den Rippen. Ihm wurde für einen Moment schwarz vor Augen. Er hielt sich an der Kommode fest, einer seiner Füße landete nun doch auf den Dielen, ihr Schlüsselbund rutschte über die Kante.
»Ist Ihnen nicht gut, Herr Schmeck?«, sagte Madeleine, aufrichtig besorgt.
»Der Kreislauf. Man ist nicht mehr der Jüngste«, sagte er.
Walter zog den Fuß zurück, bückte sich nach den Schlüsseln, wischte mit dem Jackenärmel über die trüben Tropfen, die sein Schuh hinterlassen hatte, richtete sich wieder auf und reichte Madeleine mit zitternden Händen seinen Handscanner.
Eine halbe Stunde später, auf dem Weg in die Zustellbasis Baden 1, schämte er sich für diesen Auftritt. Dabei war ihm nicht klar, dass er in Madeleines Flur noch nie eine gute Figur gemacht hatte. Er war ohnehin schmächtig, aber dort verlor er die Luft, sank in sich zusammen und rappelte sich erst wieder auf, wenn er unter »seinem Himmel« saß – damit meinte er den grauen Himmel in der Fahrerkabine des Paketwagens.
Im Radio lief gerade Keith Jarretts Köln-Konzert. Für Walter war das nicht mehr als ein Geräusch, das wenig störte. Er hörte ausschließlich Kulturradio, aber nicht weil er besonders kulturbeflissen gewesen wäre, sondern weil ihm die Werbejingles und hysterischen Moderationen auf den anderen Sendern auf die Nerven gingen.
Bald erreichte er die Autobahn. Die Sackkarre im Laderaum klapperte den Rhythmus der Spurrillen. Der Autotross auf der Gegenfahrbahn blendete durch die schütteren Hecken zwischen den Leitplanken. Ein Dutzend Kilometerpfosten weiter wurde Keith Jarrett ausgeblendet und die Bassstimme des Radiosprechers kündigte eine Sendung über Wein an. Walter drehte lauter. Er hatte selbst einen kleinen Weinberg, von seinem Vater geerbt. Er bewirtschaftete ihn in seiner Freizeit, pragmatisch und leidenschaftslos, und wenn er sich nach Feierabend ein Gläschen genehmigte, tat er das nur, weil der Wein eben da war.
Nach ein paar Takten hymnischer Streichermusik unterhielten sich zwei Weinexperten über europäische Spitzenweine. Sie redeten von kalkhaltigem Mergel, überreifen Maulbeeren und würzigem Rotschmierkäse. Walter schüchterten so viel Expertise und Wortschöpfungskraft ein, und gleichzeitig amüsierte es ihn. In einem Anflug von Unbeschwertheit schaltete er das Radio ab und ergriff selbst das Wort. So zurückhaltend er sich in Gesellschaft gab, so geschwätzig wurde er, wenn er sich alleine wähnte.
»Spätburgunder aus Rheinmünster. Die sonnenreichste Gegend Deutschlands. Die typischen Reflexe. Die übliche Farbe, Rot eben. Traubenrot, weinrot. Passt besonders gut zu«, er überlegte, »was weiß ich.« Er warf sich über den Rückspiegel einen verschmitzten Blick zu. »Zu rostfarbenen Chrysanthemen«, sagte er und hielt sich den Handscanner an die Nase. Er suchte nach Worten, die den Geruch von Madeleines Händen umschrieben.
Über »mild« und ein gestottertes »vanillebuttrig« kam er nicht hinaus, da stand er schon an der Schranke vor dem Hof der Zustellbasis. Während er den Wagen parkte, fasste er den Entschluss, Madeleine an seinem letzten Arbeitstag einen Strauß rostfarbener Chrysanthemen zu überreichen. Eigentlich keine große Sache, aber in seiner von demütiger Genügsamkeit geprägten Existenz war das die reinste Exzentrik.
Drei Wochen später stellte die Geschäftsführung sämtlichen verbeamteten Mitarbeitern, die mehr als 50 Jahre auf dem Buckel hatten, eine Abfindung in Aussicht, falls sie sich dazu entschlossen, bis spätestens Herbst in Frühpension zu treten. »Heizdeckenprämie« nannten die Verantwortlichen das, wenn sie unter sich waren. Nach kurzem Zögern besiegelte Walter den Pensionseintritt im Okober mit fünf Unterschriften und bat um eine Verabschiedung ohne »Tohuwabohu«. Mitte September telefonierte er die Blumendienste durch, deren Nummern er von den Kartons mit den Blumensendungen abgeschrieben hatte. Die Tatsache, dass keiner rostfarbene Chrysanthemen im Sortiment hatte, brachte den Stein vollends ins Rollen.
So kleingeistig und duckmäuserisch wie Walter wollte sein Sohn Johannes auf keinen Fall enden. Er verachtete ihn für seine Feinrippunterhemden, die braun-beige-karierten Pantoffeln, die Behäbigkeit, mit der er durch die Welt schlich, die schmale Stimme, die bei allem, was sie sagte, insgeheim um die Erlaubnis bat, überhaupt erhoben werden zu dürfen. Nach seinem Abitur verließ Johannes die Heimat, zog nach Hamburg und begann als Fahrradkurier zu arbeiten. Das war sechs Jahre her. Zwischenzeitlich hatte er sich ohne Erfolg bei sämtlichen deutschen Filmhochschulen und Rundfunkanstalten auf eine Ausbildung zum Regisseur oder Cutter beworben. Er hatte ein Soziologiestudium und mehrere Beziehungen abgebrochen, und sich durch acht Wohnungen in fünf Stadtteilen gewohnt. Nur seinem Job war er treu geblieben. Er war Pedalpilot Doppel-Zwo, Fahrer Nummer 22 bei den Pedalpiloten, Hamburgs ältester Kurierbude, über der Gerüchten zufolge seit Jahren die Pleitegeier kreisten.
Kurz nach acht verließ er seine Wohnung und radelte Richtung Stadtmitte, weil die wenigen Touren, die so früh fällig waren, meistens dort abgingen. Noch beschränkte sich der Funker darauf, gelegentlich ein traniges »keine Touren« zu wiederholen. Johannes trat gleichmäßig in die Pedale. In der Nacht hatte Sturmtief Anke ein erstes Mal in dieser Saison den Herbst durch die Straßen gejagt. Nun lagen sie voll mit glitschigem Laub. Er war so früh unterwegs, weil er einen Überschuss einfahren wollte. Wie die meisten Kuriere agierte er als selbstständiger Unternehmer. Er zahlte den Pedalpiloten eine monatliche Anschlussgebühr von knapp 400 Euro, der Rest seiner Umsätze blieb für Steuer, Krankenversicherung, Miete und im besten Fall, um Bedürfnisse zu stillen, die über die bloße Existenz hinausreichten. Am kommenden Freitag stand der Tag der Deutschen Einheit an. Er wollte das verlängerte Wochenende in Dänemark verbringen, Horizont und Ruhe tanken, bevor er von Schmuddelwetter und vorweihnachtlichem Hochbetrieb in die Mangel genommen wurde. Er bog hinter dem Dammtorbahnhof zur Binnenalster ab, als er eine erste Tour angeboten bekam, und bevor er die auslieferte, eine zweite, eine dritte und eine vierte, alles innerhalb des Innenstadtrings. Fette Beute sagte man unter Kurieren, wenn es gut lief. Johannes sagte es mit einer gewissen Ironie. Er wollte nicht als Kurier alt werden, aber für den Moment konnte er sich nichts Besseres vorstellen und irgendwie wollte dieser Moment einfach nicht aufhören.
Um fünf nach neun stand er an der Binnenalster und wartete auf einen neuen Auftrag. Er hatte einen Umsatz von 23 Euro und 75 Cent in der Tasche. Wenn es um Zahlen ging, war er exakt. In seinem Kopf klackerte permanent eine Zähluhr, die Monats- und Tagesumsatz, den gegenwärtigen Stundenlohn und Gewinn anzeigte, Ausgaben aufaddierte und Alarm schlug, wenn er vom Haben ins Soll rutschte.
Kollege Zwo-Sieben, Jochen, ein diplomierter Architekt, für den sein Jahr als Kurier ein Lebenstraum war, den er ausschließlich bei Sonnenschein und Temperaturen über 15°C auslebte, sagte, dass der Kurierjob viele Vorteile hatte, Geld verdienen aber nicht dazu gehörte. Johannes gab ihm recht.
Ein paar Meter weiter beschnupperte ein fusseliger Hund einen Laternenpfahl und schickte sich an, ein Hinterbein zu heben. Jeder Millimeter schien von Bedeutung. Er trippelte hin und her, stellte sich mal mit dem Gesicht zu seinem geduldig wartenden Herrchen, mal von ihm weg, und entschied sich schließlich für eine Position mit Blick auf die Alsterfontäne. Der Urinstrahl verfehlte den Pfahl großzügig und traf die Vorderpfote diagonal zum gehobenen Fuß. Der Gelbton des filzigen Fells verriet, dass dies kein Einzelfall war.
Fünf Minuten später bekam Johannes eine neue Tour serviert. Der Hund kläffte gegen die knirschenden Störgeräusche aus dem Funkgerät an.
»Was ist bei dir los?«, sagte Funker Bent.
»So ein Pantoffelhund hat sich hier eben gründlich ans Bein gepisst und macht jetzt Alarm«, sagte Johannes.
»Der hat sich ans Bein gepisst? Da könnte ich philosophisch werden und fragen, wer tut das nicht? Aber für solche Denkspielchen ist jetzt keine Zeit. Die Frage ist vielmehr: Willst du den Fink nach Eppendorf hochfahren, Jo?«
»Klar. Gerne.«
»In Ordnung. Juwelier Fink kennst du ja. Dann machen wir das so, Jo.«
Damit war der Auftrag vergeben. Beim Juwelier bekam Johannes von einer geschniegelten Servicekraft, die ihn wahrscheinlich selbst mit Gummihandschuhen nur gegen Bezahlung angefasst hätte, ein dickes Polsterkuvert über das Panzerglas geschoben, dann fuhr er mit hohem Tempo auf dem Radweg Richtung Alsterbrücken. Ein paar Meter vor ihm drehte ein Handwerker das elefantenfußdicke, geriffelte Weißblechrohr auf seiner rechten Schulter quer. Johannes blieb kein Platz auszuweichen. Links parkten die Autos Stoßstange an Stoßstange, rechts gingen Fußgänger. Wie der Handwerker auf einen Warnschrei oder ein Klingelkonzert reagieren würde, war erfahrungsgemäß nicht vorhersehbar. Um noch zu bremsen, war es zu spät. Also duckte er sich tief über den Lenker, schloss die Augen und hoffte, dass es gut ging. Ein strammer Luftwirbel kämmte seinen Haaransatz zurück. Das Rohr gab ein voluminöses Summen von sich. Eine Passantin kreischte ihm hinterher, ob er ein Rad abhabe.
»Nicht, dass ich wüsste«, rief er zurück.
Er war froh, dass die Welt noch da und seine Stirn an Ort und Stelle war, als er die Augen wieder öffnete. Das Summen des Rohres hatte in seinen Ohren nach dem Jenseits geklungen. Die Ampel am Ende des Radwegs stand auf rot. Er blieb mit einer Hand am Ampelpfahl stehen und sah bunte Punkte vor sich im klar gesiebten Morgenlicht tanzen. Ein Kribbeln rieselte seine Beine hinab. Glück gehabt, dachte er und wandte sich um. Der Handwerker war nicht mehr zu sehen. Die hysterische Passantin warf ihm einen empörten Blick zu und verschwand in einem Fachgeschäft für Pelzmützen. Alle anderen gingen unbeirrt ihren Geschäften nach. Für einen Moment fühlte er sich unendlich einsam. Er nahm sich vor, bei nächster Gelegenheit eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung abzuschließen und in die Berufsgenossenschaft einzutreten, damit er bei Arbeitsunfällen wenigstens einen Anspruch auf Krankengeld hatte. Er nahm sich das nicht zum ersten Mal vor. Bisher war er mit dem Vorsatz immer gescheitert, weil er vor Monatsende pleite war und sich keine weiteren Fixkosten aufhalsen wollte.
Während er am Alsterufer entlang nach Eppendorf fuhr, erzählte er Bent von der Limbofahrt.
»Heißt das, du bist knapp dem Tod entronnen, Jo? Dann würde ich sagen, du kommst heute Abend hier hoch und wir feiern dein Überleben auf der Bank. Das Kronkorkenparkett will gepflegt werden, solange die Temperaturen das noch zulassen.«
Die Bank war eine Sitzbank vor der Zentrale der Pedalpiloten. Wenn es trocken und nicht zu kalt war, hingen die Kuriere nach Feierabend gerne dort ab. Vor allem am Freitagabend, wenn sie ihre Fahrtquittungen bei der Zentrale einreichen mussten. Bent wollte das Rasenstück um die Bank mit Kronkorken pflastern und darauf, nach Vorbild des Schlepperballetts beim Hafengeburtstag, ein Bierballett aufführen – was genau das zu bedeuten hatte, wusste er selbst nicht.
»Bierballett eben. Tam tam, fallera.«
»Heute Abend bin ich schon verplant, Benzen. Aber du hast schon recht, man darf das Glück im Leben nicht für selbstverständlich nehmen. Das ist ein eitles Ding und will gefeiert werden, sonst bleibt es aus, habe ich irgendwo gelesen. Wir holen das nächste Woche nach, in Ordnung?«
Im Lauf des Tages erledigte Johannes 21 Touren und fuhr knapp 200 Euro Umsatz ein. Das war deutlich über seinem Schnitt und über dem der Pedalpiloten. Erschöpft, aber zufrieden fuhr er am Abend zu seiner Zweizimmerwohnung im elften Stock eines Grindelhochhauses. Im Flur streifte er Kuriertasche und Klicker-Schuhe ab, machte das mit Bändern aus Schlauchgummi am Tragegurt festgeknotete Funkgerät los und stellte es in die Ladestation.
Eigentlich war er hungrig und hätte sich gerne Stadtluft und Schweiß abgeduscht, aber als er erst auf dem Sofa saß, konnte er sich nicht mehr aufraffen, bis sein Telefon klingelte.
Es war die Nummer von Walter. Der rief eigentlich nur zu Johannes’ Geburtstag und nach Weihnachten an und wollte wissen, ob die 150 Euro, die er überwiesen hatte, angekommen waren.
»Walter? Was ist los? Weihnachten ist doch noch ein bisschen hin?«
»Ich weiß«, sagte Walter. »Aber ich hätte eine Bitte …«
»Du hast eine Bitte? Da schau her. Und die wäre?«
»Du kennst dich doch bestimmt mit dem Internet aus. Da gibt es doch diese Blumengrüße. Ich habe das oft zugestellt und wollte fragen, ob du nachschauen könntest«, er hüstelte, »ob die auch rostfarbene Chrysanthemen im Angebot haben?«
»Blumengrüße? Wem willst du denn Blumen schicken?«, sagte Johannes und ließ Walter ein paar Augenblicke mit seinem verschämten Schweigen allein. »Einen Blumengruß willst du verschicken und hast kein Internet? Warum rufst du nicht einfach direkt bei so einem Laden an?«
»Das habe ich doch getan. Aber die haben alle keine rostfarbenen Chrysanthemen.«
»Und du brauchst ausgerechnet die?«
»Genau.«
»Na dann, Walter … Wenn das so dringend ist, kann ich das schon nachschauen. Wie hießen die Primeln noch?«
»Keine Primeln. Chrysanthemen. Rostfarbene Chrysanthemen.«
»Chrysanthemen. In Ordnung. Ich kümmere mich darum, und rufe dich zurück, wenn ich mehr weiß, okay?«
Walter wies noch einmal darauf hin, dass die Chrysanthemen unbedingt rostfarben sein mussten, aber Johannes hatte schon aufgelegt.
Johannes setzte sich an seinen Laptop und tat sein Bestes. Aber rostfarbene Chrysanthemen waren partout nicht aufzutreiben. Walter nahm noch während des ersten Klingelns ab.
»Und?«
»Was und?«, sagte Johannes.
Johannes musste sich zusammenreißen, Walter in seinem Übereifer nicht auflaufen zu lassen. Darin war er ganz gut, und das wusste er.
»Ich hatte doch wegen den Chrysanthemen gefragt?«, hakte Walter nach.
»Das kannst du vergessen. Die ganzen Blumendienste haben nur poetisch betitelte Mottosträuße. Liebesglück zum Beispiel. Oder Herbstsonne.«
Walter hüstelte ein paar Mal hintereinander, dann schluckte er deutlich hörbar.
»Ist das so schlimm?«, sagte Johannes.
»Ich weiß auch nicht.«
»Ich glaube, so schlimm ist das nicht, wenn man bei keinem Blumendienst rostfarbene Chrysanthemen ordern kann.«
»Ich sage ja nicht, dass das schlimm ist.«
»Ja. Aber du sagst überhaupt nichts, und dabei könnte man auf die Idee kommen, es wäre schlimm.«
»Schlimm ist es nicht.«
»Dann ist ja gut. Im Notfall könntest du ja auch auf Liebesglück oder Herbstsonne zurückgreifen.«
»Etwas in der Richtung hat man mir auch gesagt. Aber das bringt mir ja nichts.«
Wenn Johannes auch nicht überschauen konnte, ob Walter gerade vorführte, dass er Humor hatte, oder ob er unfreiwillig komisch war, musste er doch kurz auflachen.
»Warum nicht?«
»Das bringt mir einfach nichts.«
»Du willst mir wirklich nicht verraten, für wen du dich so ins Zeug legst?«
»Über ungelegte Eier spricht man nicht.«
»Na gut«, sagte Johannes.
Die konsequente Verschwiegenheit seines Vaters war ihm nicht neu. Als sie noch unter einem Dach gelebt hatten, war er tausendfach gegen diese Grenze angerannt und hatte nie auch nur ein bisschen Land gewonnen. Hier war nichts für ihn zu holen.
»Und sonst, wie geht’s? Bei der Arbeit läuft alles wie immer?«
»Ich gehe nächste Woche in Ruhestand.«
Jetzt war Johannes vollends perplex.
»In Ruhestand? Aber so alt bist du doch noch nicht.«
»Einundsechzig. Frühruhestand.«
»Frühruhestand? Warum denn das? Ich dachte, der Paketwagen wäre dein Ein und Alles? Mein Himmel ist grau, hast du doch immer gesagt?«
»Das war einmal.«
»Das ist nicht mehr?«
»Nein.«
»Und was machst du dann? Kaufst Heizdecken auf Busausflügen und zockst Bingo beim Altennachmittag?«
»Ich habe genug zu tun. Der Garten. Der Weinberg …«
»Da willst du deinen Ruhestand verbringen? Im Garten, auf dem Weinberg?«
»Warum denn nicht?«
»Du hockst doch schon dein Leben lang auf dem verkackten Kaff. Fahr doch mal weg. Wag dich mal unter die Leute, wenn du schon die Zeit dafür hast.«
»Wo soll ich denn hin?«
»Wenn es sein muss, könntest du zum Beispiel ein paar Tage nach Hamburg kommen. Einen Weinberg haben wir hier auch. Den nördlichsten in ganz Deutschland sogar. Der ist aber eher eine traurige Angelegenheit. Aber abgesehen davon gibt es hier auch sonst einiges zu sehen. Jedenfalls mehr, als bei dir da unten …«
Walter hüstelte wieder ausgiebig. In eine Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern hatte er sich in seinem ganzen Leben noch nicht gewagt. Hätte Johannes Bagdad gesagt, wäre ihm das kaum ferner und bedrohlicher vorgekommen. Aber vielleicht hatte Johannes recht und das war eine Gelegenheit, die er wahrnehmen sollte.
»Warum eigentlich nicht?«, sagte er schießlich. »Sonntag kommender Woche könnte ich kommen.«
Johannes quetschte sich durch einen stickigen, dicht bevölkerten Flur, in das stickige, dicht bevölkerte Wohnzimmer der Wohnung, in der er seine ersten Monate in Hamburg verbracht hatte. Altona, Alte Königstraße, ein Altbau nicht weit von Reeperbahn und Altonaer Balkon. Die Fenster zur Straße wackelten Tag und Nacht. Die Wohnung befand sich im Hochparterre und die Straße davor war der Zubringer zur Autobahn Richtung Norden. Mittlerweile lebte sein damaliger Mitbewohner Oli mit seiner Freundin Leyla dort.
Johannes filterte nicht besonders gut, und wenn er zu viel auf einmal zu sehen und zu hören bekam, wusste er oft nicht, wohin mit sich. Partys und Menschenaufläufe strengten ihn entsprechend an. In diesem Fall hatte er Glück. Bevor er jemanden erkannte, wurde er erkannt. Maga, das Tresenmädchen von Einsatz, einer Werbeagentur, bei der er als Kurier ein- und ausging, winkte ihn heran.
»Hallo, Pedalpilot.«
»Moin, Maga.«
»Du kennst meinen Namen?«
»Normalerweise trägst du ein Namensschild, wenn wir uns sehen. Und außerdem hast du bei der Wahl zum Tresenmädchen des Jahres vier Mal in Folge den Titel gemacht.«
»Was für eine Wahl?«
»Zum Tresenmädchen des Jahres. Hat sich irgendein Ur-Pedalpilot vor Jahrzehnten ausgedacht. Immer im Januar hängt in unserer Teeküche ein Zettel am Kühlschrank und jeder darf eine Stimme abgeben. Dein Name wird bei uns gewissermaßen in der Grundausbildung gelehrt.«
»Tresenmädchen des Jahres?« Magas heiseres Lachen hätte als Antidepressivum gehandelt werden können. »Ihr habt doch alle einen Schuss. Warum höre ich davon nichts? Ich hätte gerne eine Urkunde. Für über’s Bett oder so …«
»Ich glaube, die Verantwortlichen fürchten den Sexismus-Vorwurf.«
»Zu Recht, würde ich sagen.«
Johannes schaute sich im Raum um. In Magas Augen wirkte er deswegen schüchtern. Generell war sie Männern zugeneigt, die nicht allzu überzeugt von sich waren. Sie fragte nach seinem Namen und ob er aus Schwaben kam.
»Aus Baden«, sagte er.
»Und was hat dich an die Elbe verschlagen?«
»Ich wollte weit weg, in eine große Stadt, und nicht nach Berlin.«
»Warum nicht Berlin?«
»Ich habe Sympathie für Underdogs. Die zweite Wahl, die letzte Reihe.«
»Und dann hat dir einer erzählt, dass man in Hamburg als Fahrradkurier ein wunderbares Leben hat? Sonnenschein tout jours und die herzlichsten Tresenmädchen, und du hast es geglaubt, ja?«
»Das mit dem Kurier hat sich eher so ergeben.«
»Ein Verlegenheitsjob? Das kommt mir bekannt vor. Was würdest du eigentlich gerne machen?«
»Am liebsten etwas beim Film.«
»Und die ganzen Hochschulen haben dich abgelehnt? So läuft das mit den Ambitionen. Hast du Alternativen, abgesehen vom bedingungslosen Grundeinkommen?«
»Soziologie und ich glaube Geisteswissenschaften allgemein waren auch nicht so meins.«
»Wie wäre es mit Werbung?«
»Unmöglich. Dafür bin ich zu idealistisch und zu faul. Das einzige, was die Leute dort nicht exzessiv genug konsumieren, ist ihre Lebenszeit. Die kapieren nicht, dass es jederzeit zu Ende gehen kann …«
»Bei dem Sendungsbewusstsein wären vielleicht Medien das Richtige?«
»Ich befürchte, ich bin nicht teamfähig und das sollte man in solchen Jobs sein, habe ich mir sagen lassen.«
»Versicherungsvertreter, Finanzberater, Börsenhändler?«
»Ja, das wäre vielleicht was.«
»Echt?«
»Nein.«
»Vielleicht arbeitest du schon in deinem Traumberuf und merkst es nur nicht?«
»Da ist was dran. Der Job könnte ein Traum sein. Der Haken ist nur, dass man von dem, was man verdient, kaum leben kann. Und andauernd wird man behandelt, als wäre man ein bisschen behindert. Wenn du in einer Akademikerrunde erzählst, dass du Kurier bist, werden alle still, als hättest du gesagt, du hättest Blutkrebs im Endstadium. Dann ist man ständig beschäftigt, sich gegen den Gedanken zu wehren, dass etwas mit einem nicht ganz rund läuft.«
»Aber ganz aus der Luft gegriffen ist das ja auch nicht, wenn ich an deine Kollegen denke? Mehr als die Hälfte von denen würde sich auch in der Klapsmühle gut machen.«
»Du übertreibst.«
»Wegen mir. Lass es ein Drittel sein.«
Sie fragte nach dem lustigen Brummbär, den sie immer am Telefon hatte. Der Brummbär war Bent. Er behauptete, zum Kurier geboren zu sein – genügsam, hart im Nehmen und mit dicken Waden auf der Bahn des Lebens unterwegs. Dabei war Bent kaum noch als Kurier auf der Straße. Er machte am Nachmittag Disposition und sorgte als Vormittagsfunker für gute Laune. Er war ein geborener Entertainer, fand Johannes. Wäre es nach ihm gegangen, hätte Bent sofort eine eigene Radioshow bekommen, und schon ein paar Mal hatte er versucht, ihn zu überzeugen, sich auf eine der offenen Bühnen der Stadt zu wagen. Aber das wollte Bent nicht. Er machte seinen Job, er machte ihn gerne, und Ambitionen hatte er keine. Insgeheim beneidete Johannes ihn dafür und insofern hatte Maga den Nagel auf den Kopf getroffen.
Und dann waren da noch die anderen Kollegen. Nach seiner Heilserwartungstheorie machten sich die meisten von ihnen ihr Dasein erträglich, indem sie sich an eine persönliche Heilserwartung klammerten. Zum Beispiel Sechs-Null, der Kurier ohne Namen, Anfang vierzig, über zwei Meter groß, mit langen, grauen Strohhaaren wie J Mascis von Dinosaur Jr. Er lebte mit seiner Mutter in einer Sozialwohnung im tristen Osdorf. Er legte seit Jahren Geld auf die Seite, um sich in Kamerun ein Stück Land zu kaufen und sich mit einem blinden Brieffreund aus der Schulzeit eine Avocadofarm aufzubauen. Entsprechend rechnete er seinen Umsatz konsequent in Quadratmeter kamerunischen Ackerlands um. Oder Per, der Nachmittagsfunker, der hoffte, durch Fußballwetten zu Wohlhaben zu gelangen. Oder Nhan, ein Vietnamese, der Ende der Neunziger als Nachwuchsmaler mit großzügig dotiertem Arbeitsstipendium in Hamburg aufschlug, den Nerv des damaligen Kunstmarktes traf, ein paar Jahre den Bohemien gab, aus der Mode kam, bei den Pedalpiloten landete, und pausenlos von seinem Comeback träumte, obwohl er seit Jahren keinen Pinsel angerührt hatte. Oder Axel, der damit rechnete, dass ein Krieg oder eine Naturkatastrophe bald die Verhältnisse über den Haufen warf, die Gesellschaft sich in eine Gesellschaft der Jäger und Sammler zurückverwandelte und Ausdauer und Wetterfestigkeit zu gefragten Kernkompetenzen wurden. Oder Pacman, der jede freie Minute am Fahrercomputer der Zentrale verbrachte und hoffte, den Pacman-Punkterekord zu knacken, den er vor Jahren aufgestellt hatte.
Maga kannte all die Typen und amüsierte sich prächtig, während Johannes erzählte.
»Und was ist deine Heilserwartung?«, sagte sie, als er fertig war.
»Ich habe das nicht nötig. Ich brauche nur noch ein paar Tage in Neverland, und dann nehme ich mein Leben in die Hand.«
»Geht das auch konkreter?«
»Ich will das gute Geschäft bis Weihnachten noch mitnehmen, Geld zur Seite schaffen, und mir im Januar unter äquatornaher Sonne Gedanken über ein längerfristiges Morgen machen.«
»Kann das sein, dass das einstudiert geklungen hat?«
»Nicht direkt einstudiert, aber es geht mir die Tage öfter im Kopf herum. Für Sonntag habe ich meinem Vater einen Zug nach Hamburg gebucht. Der kommt mich zum ersten Mal besuchen. Ich will nicht, dass der alte Herr sich Vorwürfe macht, weil sein Sohn ohne Plan durchs Leben strauchelt. Der ist in anderen Verhältnissen groß geworden. Ich glaube, der hat kaum Verständnis dafür, dass man seine Lebenszeit nicht mit Sachen verschwenden will, die einem vorwiegend am Arsch vorbeigehen. Die jungen Leute seiner Generation waren wohl froh, wenn sie arbeiten durften. Aber damals war Wohlstand für alle wohl auch noch ein Versprechen und kein Märchen.«
Im Durchgang zum Flur tauchten Leyla und Oli auf. Oli suchte Johannes’ Blick und setzte sein Jack-Nicholson-Grinsen auf. Leyla kämpfte sich zu ihnen durch. Sie gab Maga Küsschen, flüsterte ihr ins Ohr, verpasste Johannes einen neckischen Faustschlag auf die Brust und verschwand wieder.
Die Party kam in Schwung, aber Johannes und Maga den ganzen Abend über nicht länger als fünf Minuten voneinander los. Sie redeten viel, tranken nicht übermäßig, und tanzten ein bisschen. Als sie nach Hause wollte, war klar, dass er mit ihr kam. Sie wohnte im nördlichen Eimsbüttel, in einer kleinen, lieblich eingerichteten Wohnung, die nur dank der Splatterfilmplakate an den Wänden nicht aussah wie aus dem Wohnmagazin.
Während sie sich auf einem harten, nach Blumenwiese duftenden Bett wälzten, wurde Johannes nervös. Er hatte lange nicht mehr mit einer Frau geschlafen, und die letzten Male war er innerhalb weniger Minuten gekommen. Nun klammerte er sich an die Hoffnung, dass dieses Problem irgendwie verschwunden war. Auch noch, als sie ihm Hose und Unterhose über die Knöchel streifte, sich auf ihn setzte und erwähnte, dass sie keine Pille nahm und er aufpassen musste. Er wagte ein paar zögerliche Stöße und redete sich ein, alles im Griff und eine lange Liebesnacht vor sich zu haben, aber kaum ging sie ein bisschen mit, konnte er sich nicht mehr beherrschen. Er kam, während er sie von sich schob. Das Meiste landete auf seinem Bauch.
»Toi, toi, toi«, sagte sie, warf ihm ein paar Tempos zu, und verschwand auf Toilette.
Danach kroch sie ohne ein weiteres Wort unter die Decke. Er traute sich nicht, sie anzusprechen und flüchtete sich, um ihren Rücken gelöffelt, in einen unruhigen Schlaf. Am Morgen gab sie sich schroff. Frühstück servierte sie noch – Brot, gekochte Eier, Marmelade und Butter, jeweils im Steinguttöpfchen – aber während sie ihr Ei köpfte, stellte sie klar, dass sie von Männern die Schnauze voll und kein Interesse an einer Beziehung hatte.
»Natürlich«, sagte er, bemüht, dabei gleichgültig zu klingen, und bei der Verabschiedung im kalten Treppenhaus gab er seiner Umarmung eine Beiläufigkeit, die er auf dem Heimweg bereute.
Zu Hause durchstöberte er das Netz nach Sexproblemen, die sich seinem vergleichen ließen. Er stieß auf den Hilferuf eines Mannes, der in die Hose kam, sobald er mit einer Frau allein in einem Raum war. Damit fühlte Johannes sich gleich besser. Er fand noch mehr Fallgeschichten dieser Sorte und Stunden später bestellte er ein Ratgeberbuch zum Thema.
Walter wollte gerade ein mannshohes Paket für einen Autoteile-Großhandel in die passende Ecke seines Wagens stemmen, als eine Ansage von Zustellbasenleiter Treffler aus den Lautsprechern an der Hallendecke dröhnte.
»Walter Schmeck, bitte ins Büro kommen. Bitte ins Büro.«
Er ließ von seinem Paket ab und ging rückwärts, bis er die Uhr am Kopfende der Halle sehen konnte. Es war Viertel vor acht. Um acht musste er geladen und sein Tor geräumt haben, dann war die zweite Welle an der Reihe. Bestimmt ging es um seine Verabschiedung. Dabei hatte er beim Vesperservice längst Butterbrezeln für alle geordert, und mehr wollte er nicht. Der Firmenrechner hatte ihm die Daten von 240 Sendungen auf den Handscanner gespielt. Zweihundertzwanzig davon hatte er schon geladen. Wenn er jetzt ins Büro ging, wurde es mit der zweiten Welle eng. Aber das war nicht sein Problem. Er scannte noch ein würfelförmiges Paket und schob es wie eine Bowlingkugel in den Wagen. Es glitt über den Boden und blieb am Durchgang zur Fahrerkabine liegen.
Das Büro befand sich am anderen Ende der Ladehalle. Rechts reihten sich dreißig Ladetore aneinander. In der Mitte rotierte ein Fließband und ließ Nachzüglersendungen auf die Aluminiumschrägen fallen, die als Verteilerrutschen für die einzelnen Bezirke dienten.
An Tor 25 lud Eberhardt. Eberhardt war vor 42 Jahren mit Walter von der Betriebsschule abgegangen.
»Schon wieder ein Päckchen für das Rindvieh?«, sagte er. Eberhardt war immer am Schimpfen. Normalerweise hörte Walter nicht hin. »Hast du gehört, schon wieder 260 Pakete heute. Du?«
»Zweihundertvierzig«, sagte Walter.
Eberhardt zog an dem Filterzigarillo, der aus seinem Mundwinkel baumelte.
»Zweihundertvierzig? Davon träum’ ich, wenn ich mir einen runterhol’. Zweihundertsechzig hab ich wieder. Musst du dir mal vorstellen. Hätte ich keine Familie, ich würde es machen wie du. Ich hab die Schnauze auch voll. Das ist doch kein Leben mehr. Wir schinden uns hier, und die da oben verjubeln unser Geld.«
»Die paar Jahre noch …«
»Du hast gut reden. Du stellst am Wochenende die Karre in den Hof, machst deine letzte Abrechnung, und dann kannst du im Schießhaus deine Abfindung vervögeln. Wenn ich jetzt aufhör’, fressen meine Alte und meine Kinder mir die ganze Rente aus der Tasche und dann muss ich zwar nicht mehr buckeln, aber daheim sitzen und wichsen, weil alles, was Spaß macht, nun mal Geld kostet, das ich dann nicht hab.«
Eberhardt holte Luft. Walter verabschiedete sich und ging weiter. Eberhardts Gezeter verlor sich im Lärm der gegeneinanderkrachenden Rollcontainer, dem Dudeln der Autoradios, dem schrillen Summen der Gabelstaplermotoren.
Walter erinnerte sich an Zeiten, in denen der Gang zum Büro ein Spalier gewesen war, hier ein Schwätzchen, dort ein Schulterklopfen, jetzt ging er stumm an allen vorbei. Von vielen Kollegen kannte er nicht einmal den Namen. Kemal, der am vorletzten Tor vor dem Büro lud, war fast schon eine Ausnahme. Er arbeitete eigentlich für eine Zeitarbeitsfirma, aber die verlieh ihn seit Jahren an DHL Er wurde eingesetzt, wenn es eng wurde, und manchmal am Morgen wieder nach Hause geschickt. Walter hatte ihn an einem seiner ersten Arbeitstage um Kleingeld für den Kaffeeautomaten gebeten, und Kemal hatte ihm echten Kaffee aus seiner Thermoskanne angeboten. Seitdem trafen sie sich nach dem Beladen meistens auf ein Tässchen. In diesen Tagen betete Kemal zu Allah, dass er von Walters Weggang profitieren und endlich einen Direktvertrag und einen festen Zustellbezirk bekommen würde.
»Bestimmt meint der Chef, du musst noch einen neuen Bezirk lernen«, sagte Kemal.
»Inschallah«, sagte Walter und ging weiter.
Treffler und seine Assistentin Anita erwarteten ihn in ihrem überheizten Büro. Treffler bat ihn, Platz zu nehmen. Er blieb lieber stehen.
»Folgendes, Walter: Weil du nächste Woche nicht mehr da bist, haben wir schon einen Nachfolger für dich ausgesucht: Thomas Thomaszewski. Der fährt ab morgen bis zum Ende der Woche noch bei dir mit.«
»Ich soll jemanden einlernen? Sie wissen doch, dass mir das nicht liegt«, sagte Walter und suchte Rückendeckung bei einem blechernen Materialschrank.
Das war nicht gelogen, aber auch nicht die Wahrheit. Er verbrachte seine Zeit tatsächlich am liebsten allein, aber nun ging es ihm um die rostfarbenen Chrysanthemen. Beim Gedanken, einen Zeugen zu haben, wenn er sie im Blumenladen besorgte, und vor allem, wenn er sie Madeleine überreichte, bekam er auf der Stelle einen trockenen Mund.
»Aber Walter«, sagte Treffler, »wir können doch nicht unseren besten Mann gehen lassen, ohne dass der wenigstens einen Teil seiner Erfahrung weiterreicht. Keiner kennt den Zweiundzwanziger so gut wie du.«
»Herr Treffler, das geht nicht.«
»Warum denn nicht?«
»Weil … ich mich in Ruhe von allem verabschieden will.«
Treffler stand auf und lehnte sich an die Vorderkante des Schreibtischs. Seine eisblauen Augen nahmen Walter ins Visier. Er betrachtete ihn eigentlich als pflegeleichten Mitarbeiter, hätte ihn gerne noch ein paar Jahre beschäftigt, aber das Konzernmanagement hatte darauf gedrängt, dass er die Beamten loswurde.
»Ich verstehe dich, Walter. Aber ich kann da nicht mehr zurück. Das ist seit Wochen so geplant. Der Junge freut sich schon.«
Walter fand, man hätte ihm das mitteilen müssen, aber er fiel auch hier in sich zusammen und sagte keinen Ton. Treffler redete vom hohen Sendungsaufkommen, den vielen neuen Fahrern, die sich nicht so geschickt anstellten wie Walter, von den schlechten Nachrichten aus den Staaten, und Anita unterstrich sein Plädoyer mit einem debilen Kopfnicken.
»Dieser Thomaszewski, Walter, dein Nachfolger, das ist, glaube ich, ein ganz kompetentes Bürschchen. Den lässt du einfach ein bisschen für dich rennen. Das kann auch mal ganz schön sein«, sagte Treffler.
Walter wollte wenigstens ein Entgegenkommen erwirken.
»Aber am Freitag, Herr Treffler, will ich alleine fahren.«
»Der Freitag ist doch ein Feiertag …«
»Dann am Donnerstag. Das ist demnach ja mein letzter Tag …«
Treffler atmete geräuschvoll ein und faltete die Hände über der Gürtelschnalle.
»Versprechen kann ich das jetzt nicht. Das wären dann ja nur zwei Tage Einlernzeit. Das ist sowieso zu wenig. Aber wenn dir das so wichtig ist, dann schauen wir uns an, wie dieser Thomaszewski sich macht. Und wenn er sich nicht ganz ungeschickt anstellt, dann fährst du am Donnerstag alleine. In Ordnung, Walter?«
Treffler setzte sich wieder. Anita lächelte gütig, wuchtete ihren Hintern aus dem Stuhl und hielt die Tür auf.
»Lass den einfach ein bisschen rennen. So was kann auch mal ganz schön sein, glaub mir«, raunte sie Walter im Vorübergehen zu, und betonte die Worte, als wären es ihre eigenen.
Weil über Hamburg Regenschauer niedergingen, die selbst der Vollblutatheist Axel als »sintflutartig« beschrieb, waren kaum Fahrer unterwegs. Die wenigen, die – in Bents Worten – »nicht aus Zucker« waren, hatten entsprechend zu tun. Am späten Nachmittag klarte der Himmel auf und Johannes verabredete sich für den Feierabend mit Bent, um sein Überleben nachzufeiern. Seine letzte Tour endete am Schulterblatt, die Zentrale befand sich nur 500 Meter weiter die Straße hinab. Als er an der Bank vorfuhr, saß Bent schon bereit und reichte ihm ein Pils. Eigentlich war seine Unbeschwertheit sprichwörtlich, aber nun hatte er etwas auf dem Herzen.
»Sach ma, Jo, ich habe da was läuten gehört: Du und das liebreizenste Tresenmädchen aus Hamburg-City. Lief zwischen euch was?«
»Bitte, was?«
»Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass du Samstag auf einer Party den ganzen Abend mit Maga geschnackt hast, und am Ende mit ihr verschwunden bist.«
»Wenn das Vögelchen aufrichtig war, wird wohl was dran sein.«
Johannes hatte keine Lust auf diese Konversation. Das war seine Sache und ohnehin nicht gelaufen, wie er sich das vorgestellt hatte. Er redete sich darauf hinaus, dass das nur so eine Geschichte war, und war sich dabei nicht im Klaren darüber, ob nur so eine Geschichte etwas war, das er in seinem Leben haben wollte, oder: in der Not frisst der Teufel Scheiße. Das ungesunde Röcheln, das in diesem Moment aus dem Hinterhof drang, kam ihm nicht ungelegen.
»Stirbt da einer?«, rief Bent in die Dunkelheit.
Eine dürre Gestalt löste sich aus den Schatten. Es war Maniok. Manioks kurze Karriere bei den Pedalpiloten war ein fester Bestandteil des hausinternen Mythenschatzes. Maniok hatte in seiner ersten Dienstwoche eine junge Mutter verprügelt, weil sie mit ihrem Kinderwagen den Radweg kreuzte und ihn zu einem Ausweichschlenker nötigte. Bereits dafür wäre er von der Fahrerschaft ausgeschlossen worden, wenn Bent sich nicht für seinen Sandkastenkumpel eingesetzt hätte. Aber schon drei Wochen später schoss Maniok den nächsten Bock. Eine Wirtschaftskanzlei am Neuen Wall stornierte an einem Vormittag zwei Fahrten just in dem Moment, als Maniok dort ankam, um die jeweilige Sendung herauszuholen. Nach dem zweiten Mal meldete er sich vom Funk ab und ließ weiter nichts von sich hören. Zwei Stunden später rief der Juniorpartner der Kanzlei bei den Pedalpiloten an und berichtete, dass Maniok vor ihren Empfangstresen uriniert hatte. Die Pedalpiloten verloren die Kanzlei als Kunden, Maniok wurde geschasst, der Mythenschatz um die Episode Tresenurinal erweitert. Seit dem hing Maniok meistens in der Nähe der Bank herum und hoffte auf jemanden, den er zutexten konnte.
»Alles klar?«, sagte Bent.
Maniok schwankte, als würde ihn nur die Masse seiner klobigen Springerstiefel auf den Beinen halten. Sein Irokesenschnitt hing von seinem Schädel wie welker Salat. Er starrte die beiden aus schattigen Augenhöhlen an, gab eine Art Bellen von sich und torkelte Richtung Schanzenstraße davon.
»Das gibt es nur bei den Pedalpiloten. Der Empfang ist rund um die Uhr besetzt«, sagte Bent.
»Mir tut der ja leid. Der hat Probleme, oder?«, sagte Johannes.
»Wer hat die nicht, Jo, wer hat die nicht? Wie war das neulich: Wir pissen uns alle selbst ans Bein. Bei dir und Maga waren wir stehen geblieben. Ich wollte wissen, ob da was lief?«
Neben der Bank flimmerte ein Leuchtschild mit einem verwitterten Pedalpiloten-Logo und einem Werbeaphorismus darunter: Wenn’s bei Ihnen brennt, treten wir in die Pedale. Die Telefonnummer war überklebt. An den Rändern schauten die alten Ziffern noch hervor. Ein Nachtfalter brummte um das Licht und knallte immer wieder gegen die Plexiglasscheibe.
»Sag schon, Jo, wie war die Hübsche so?«
»Lass doch gut sein. Schlafzimmergeschichten als Partyschnack, das ist nicht so meins.«
»Welche Party? Zwei Mann, ein Dritter, der sich lange im Hintergrund gehalten und dann das Weite gesucht hat – das bezeichnest du als Party? Das ist ja wohl ein bisschen übertrieben, Jo. Aber Schlafzimmergeschichten sagt eigentlich ja alles. Dann würde mich nur noch interessieren, wann ihr euch wiederseht?«
»Wenn ich das nächste Mal zu Einsatz komme, wahrscheinlich.«
»Ihr habt keine Nummern ausgetauscht? Keine Freundschaftsanfragen im World Wide Web?«
»Lass doch gut sein. Wie gesagt, das war nur so eine Geschichte. Ein Transporterjob.«
»Ein was?«
»Ein Transporterjob.«
»Ein Transporterjob? Was soll das denn sein?«
»Was man als Transportermann eben so macht: Man transportiert Sachen von A nach B. In dem Fall eine Frau von Beziehung A nach Beziehung B. Wir als Kuriere sind prädestiniert für solche Jobs.«
»Meinst du?«
»Wir machen den ganzen Tag nichts anderes. Das ist doch klar, dass uns das irgendwann ins Blut übergeht.«
Bent hebelte mit seinem Feuerzeug ein neues Pils auf.
»Du meinst, Frauen sind für uns auch nur so eine Art Fracht?«
»Wir sacken sie ein und liefern sie ab, wo sie hingebracht werden wollen.«
»Und dann?«
»Dann ist Schluss. Mehr ist für Transportermänner nicht drin.«
»Das ist ja eine finstere Theorie. Aber stimmt schon, wenn ich mir mein Pärchenleben so anschaue, könnte was dran sein. Das hat was von Hire and Fire. Transportermann also?«
»Transportermann.«
Bent zwirbelte seinen Ziegenbart. Eine gute Minute verstrich, ohne dass einer der beiden etwas sagte.
»Aber sag an, Jo, Maga, wo will die denn hin? Was, oder besser wer, ist hier die Zieladresse?«
»Das kann ich dir leider nicht sagen.«
»Aber hör mal, du musst doch wissen, wo es hingehen soll, wenn du eine Tour annimmst?«
»Sei nicht pingelig. Jede Theorie hat ihre Schwachstellen.«
»





























