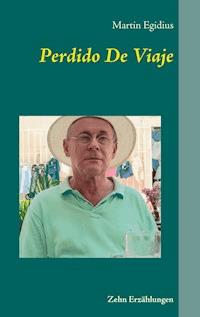
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Bändchen Perdido De Viaje enthält neben der Titelgeschichte, die in Nicaragua zwei Jahre nach der sandinistischen Revolution spielt, neun weitere Geschichten aus dem letzten Vierteljahrhundert. Perdido de viaje heißt in Lateinamerika sturzbetrunken, das sagt viel. Dann kommt eine doppelstöckige und gerade dadurch sehr friedfertige Schweiz vor (Schweiz mal zwei), ein wild gewordener Ferrari samt jugendlichem Lenker (Ferrari FF), es kommen eine Menge Schafe vor, der Käse, der aus ihrer Milch wird und die ihn in der Toskana aus den Eutern ziehen, "sardi-bastardi" (Schafe), weiter geben zwei Geldbeutel Einblick in ihre höchst eigentümlichen Blickwinkel und Empfindungen (Als wär‘s ein Stück von mir; Als wär ich ein Stück von ihm). Zu guter Letzt schildert Der Beruf eine nicht eben übliche Karriere und Der Apfel ein Ereignis, das nicht wirklich als Wilhelm Tell für die Schule taugt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Perdido de Viaje
Il Cavallino Rampante (Ferrari FF)
Als wär‘s ein Stück von mir
Als wär ich ein Stück von ihm
Der Moment
The Living Room
Schweiz mal zwei oder die helvetisch-untergründige Fluchtwelle
Schafe
Der Beruf
Der Apfel
Perdido De Viaje
Managua, Nicaragua, 1981, zwei Jahre nach dem Sieg der Sandinisten, Freitagabend.
Vamos a tomar (wir gehen einen nehmen).
Wir, das sind zwei junge Schweizer, der eine, mittelgroß und hellblond, volles starkes Haar, ist siebenundzwanzig, der andere, etwas länger und spröder, bereits etwas schütter mittelblond, mit wuchtig eingerahmten dicken Brillengläsern vor seinen schlechten Augen, ein gutes Jahr älter. Der Jüngere, einige Monate bereits in Nicaragua Libre, Centro America ansässig, ist eben dabei eine Nicaraguanerin zu heiraten, der andere, ein Klassenkollege vom Gymnasium, ist sein Gast. Der Dritte im Bunde, der Kleinste, massig, drahtig, bereits angegrautes welliges Haar, erstaunlich hellheutig, leben doch hier fast ausschließlich Mischlinge, ist indigeno, Nicaraguaner, wohl ein paar Jahre älter als die beiden extranjeros. Da der knapp noch nicht Verheiratete und der indigeno an derselben Uni fremde Sprachen unterrichten, unterhält man sich auf Englisch.
Bienvenidos en la tierra de Sandino, große Lettern auf weißem Stoff – willkommen noch in fast tiefster Nacht. Fünf Uhr in der Früh, an seinen Rändern erst schwach, geradezu zaghaft beleuchtetes blauschwarzes Dunkel. Erst vor fünf Tagen ist der Gast so im Land Sandinos angekommen. Zu früh. We’re sorry, all our computers are down, hatte man ihm am Vorabend nach seiner Ankunft in Miami am Schalter von La Nica gesagt. Irgendwann würde der Flug nach Managua schon starten, man wisse aber noch nicht, wann. In zwei Stunden, wahrscheinlich, wisse man mehr.
Nach vier Stunden und Aufenthalten in zwei fast identischen und identisch öden Selbstbedienungsrestaurants mit pompösen glitzernden Eingängen und verheißungsvollen Namen in der Flughafenlobby wusste man trotz abgestürzten Computern tatsächlich mehr; in einer Stunde starte die Maschine. Eine gecharterte DC 9 war’s dann, mit routiniertem englischem und spanischem Luftverkehrs-Slang in allen Ansagen und ebenso routiniertem jungem durchwegs weiblichem und farbigem Kabinenpersonal; nichts von Improvisation, nichts von nervösem Rettungsmanöver und Gesichtswahren.
La dirección (die Adresse) por favor; Managua es grande –
Barrio El Edén, primera calle norte, primera calle este (Viertel El Edén, erste Straße Nord, erste Straße Ost).
Edén vuelve (Edén kommt zurück) an den Mauern; schon am selben Tag sollte der Gast die gesprayten Aufschriften lesen. Edén Pastora, oder Comandante Cero, der Führer der von der Reagan-Administration unterstützten Contras, einst selbst Sandinist und Vizeminister, dann aber abtrünnig und eben Führer der größten bewaffneten Gruppierung, die seine ehemaligen Mitstreiter vom südlichen Grenzgebiet zum militärlosen Costa Rica her bekämpfte. Es hieß sogar, er habe Flugzeuge.
Edén vuelve – bienvenidos en la tierra de Sandino. Edéns früherer Kampfgenosse und Sandinisten-Chef Daniel Ortega führt gleichzeitig die Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional an. Unter der militärischen Führung seines Bruders Humberto hatte der FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) 1979 Anastasio Somoza, den letzten Spross der Diktatoren-Dynastie, gestürzt und die Macht übernommen. Seit 2006 ist Daniel (wieder und bis heute (2018)) Staatspräsident, aber der FSLN, dessen Vorsitzender er ebenfalls (wieder, immer noch) ist, das sind nicht mehr die marxistisch-linken Guerilleros und Befreier von damals. Immerhin nennen sie sich (noch) nicht PRI (Partido Revolucionario Institucional), wie jene mexikanische Partei, die einst den Kaiser (la cucaracha, die Küchenschabe) vertrieben hatte, das Land nachher von 1929 bis 2000 ununterbrochen regierte und auch seit 2012 wieder den Präsidenten stellt.
Was hat das alles mit einem freitagabendlichen Umtrunk zweite Hälfte August 1981 zu tun? – Trinken, sich besaufen können Rechte ebenso wie Linke, und die einen stehen den andern in nichts nach. Ebenso wenig hat der weitverbreitete Trick, erst ein, zwei Suppenlöffel Speiseöl runterzuleeren, damit man sich nachher mehr hinter die Binde gießen kann, politische Couleur. Aber wir werden sehen: Der Umsturz hat ganz reale Folgen für einen perdido de viaje, einen auf der Reise Verlorengegangenen, wie man Sturzbetrunkene sicher auch heute noch nennt en la tierra nicht mehr ganz de Sandino (des 1934 von der Nationalgarde unter Anastasio Somoza sen. ermordeten Guerilleros und als solcher Kämpfer gegen die US-amerikanische Besetzung, auf den sich die FSLN beruft). Die Sandinisten hatten nämlich zur allgemeinen Verwirrung der vorher schon mit zahlreichen Unpässlichkeiten der städtischen Ortung gesegneten Einwohner Managuas alles nur halbwegs Wichtige revolutionär umbenannt. Auch das barrio El Edén hieß natürlich früher ganz anders, wie auch immer anders. Doch für Auskünfte wie: zwei Blocks vom Hospital Bautista weiter geradeaus, dann rechts einen Block nach Westen, und man findet beim besten Willen kein irgendwie geartetes Hospital, man hätte eben wissen müssen: zwei Blocks von dort weg, wo früher mal ein Krankenhaus gestanden hatte – für solch gut gemeinte Verwirrung hätten auch die alten Namen ohne revolutionäre Beihilfe getaugt – zumal bei der damals noch hohen Rate an Analphabeten –, wie der Noch-nicht-Verheiratete in seinen paar Monaten Nicaragua-Erfahrung bereits mehrmals hatte erleben müssen. Und der Gast hat derlei gleich auf der Fahrt vom Flughafen weg mitbekommen, wo er zusammen mit einem deutschen Paar ein Taxi genommen hatte. Man fuhr zum Zentrum, ins Zentrum hinein, zum Teil über Erdpisten, und das Zentrum, muss man wissen, war einmal. Vielleicht ist es heute wieder, aber 1981, schwer in Mitleidenschaft gezogen durch ein gewaltiges Erdbeben 1972 und die bewaffneten Auseinandersetzungen, die 1979 zum Sturz Somozas geführt hatten, gab es dort nur eine breite, bereits wieder überwucherte Avenida, ein Hochhaus – Ministerio del Interior –, das Nationaltheater und sonst vor allem struppiges freies Feld und ein paar Ruinen der einstigen kolonialen Altstadt, in denen die Ärmsten in ihrer Herrlichkeit aus Plastikstühlen, -tüten und -planen hausten. Bessere oder geradezu niedlich gutbürgerliche Viertel mit gepflegten Gärten um- und überspielten mitunter fast nebenan dieses Phantom-centro. Frühere Somoza-Villen, etwas außerhalb gelegen auch sie und meist anmutig umrahmt, dienten jetzt als Ministerien und Residenzen der neuen Herren; Ernesto Cardenal etwa, seines Zeichens von Johannes Paul II. öffentlich gerügter und 1985 wegen seiner Tätigkeit in der FSLN suspendierter Priester, Befreiungstheologe und international bekannter Dichter, residierte als Kulturminister (der er bis 1987 war) angenehm heruntergekühlt in einer solchen Villa. Selbst das beste Hotel, das 1969 im Stil einer Maya-Tempelpyramide erbaute Intercontinental (im Volksmund noch heute (2018) El Inter genannt, obwohl die Vier-Sterne-Herberge seit 1992 Crowne Plaza heißt, da sie zur InterContinental Hotels Group gehört), liegt zwar zentrumsnah, aber nicht mittendrin. Im Übrigen: Dass Managua an einem See liegt, merkt man erst, wenn man von einer Anhöhe in der Umgebung auf die nicaraguanische Hauptstadt hinunterblickt; nichts da von lauschigen Uferpromenaden, Palmen und dergleichen, wenigstens damals nicht.
Nun gut: Zweite Hälfte August 1981 gegen sechs Uhr morgens musste unser Taxifahrer sich vom Zentrum weg durchfragen, und auch so verfuhr er sich ein, zwei Mal. Immerhin wurde es langsam, will sagen, eigentlich der Äquatornähe wegen ziemlich schnell Tag.
Die Adresse, endlich gefunden, erwies sich allerdings nicht als die des Neo-Nicaraguaners (der mittlerweile längst zurück in der Schweiz ist) und seiner Noch-nicht-Angetrauten (die mittlerweile seine Angetraute nicht mehr ist), sondern als Bleibe ihrer Eltern. Rufe des Fahrers und des Gastes ergaben zunächst ein markantes Krähen des Hahns, dann mehrfaches kräftiges Grunzen des Hausschweins – und zu guter Letzt erschien dann doch, noch etwas belämmert, ein nicht mehr ganz junger schmächtiger grauhaariger Mann; ihr Vater. Er war aber bereits wach genug, um mitzufahren und uns den Weg zu weisen; frente al parque, das einzige zweistöckige Haus weit und breit. Die Noch-nicht-Vermählten, die sich zwei Jahre zuvor in Europa, in Mailand, kennengelernt hatten (das nur nebenbei), waren natürlich auch ziemlich überrascht und erst halbwach; so viel zu früh (um halb sieben vor der Tür statt um zehn am Flughafen) kommt selten ein Gast –
Dann eben fünf Tage später, der Gast kennt sich erst sehr mäßig in der rund um ihr verödetes Zentrum herumwabernden Metropole aus, jener Freitagabend. Ein angenehm milder, nicht allzu dampfendfeuchter Abend. Vamos a tomar.
Am ersten Ort isst man so etwas wie Gulasch, trinkt einen jugo (Saft). Dazu aber bereits ron oro (Goldrum). In Bezug auf Rum ist – oder war zumindest damals – Nicaragua eine Zweiklassengesellschaft – mit allerdings recht volatilem Klassenwechsel, je nach gerade verfügbarem Budget. Da gibt es den ron plata (den Silberrum), den billigeren, ähnlich dem brasilianischen cachaça, eine nur leicht eingetrübte durchsichtige, eher grobe Angelegenheit, und den teureren bernsteinfarbenen, feineren ron oro.
Mindestens eine Flasche geht drauf. Die Gespräche und Diskussionen, Hauptthema, welch Wunder, frau, werden angeregter und die Welt rund herum verliert etwas an Kontur. Dann wechselt man das Lokal – der Neo-Nica hat einen alten Japanerkombi. En Munich: Baldachine aus Stroh, Musik, dann Guitarreros, die die Gäste begleiten, wenn sie ein Lied singen oder das wenigstens versuchen wollen. Der indigeno versucht’s – und kann’s. Und wieder ron oro, diesmal ohne solide Beilage. Wie viel – nun ja...
Es wird spät, es wird früh. Da erinnert sich der Neo-Nica, dass seine Noch-nicht-Ehefrau, die eine Uni administrativ leitet, hin und wieder vom selben Professor nach Hause gefahren wird, und seine Eifersucht kennt schon seit jeher kaum Trägheitsmomente. Also muss er nach Hause – trotz des noch nicht bewältigten Drittels der gerade aktuellen Flasche. Er steht auf, fragt seinen Schweizer Freund und Gast, ob er denn seine Adresse habe. Der greift in die linke Brusttasche seines veilchenblauen kurzärmligen Hemdes, findet einen Zettel und bejaht ohne Umschweife kräftig. Der Nichtneo-Nica und er verbleiben und leeren auch noch die noch immer aktuelle Flasche. Die Welt hat längst schon begonnen sich ziemlich unruhig und rhythmisch vielfältig zu bewegen – eppur si muove –, die Nacht ist immer noch mild, es hat aber zu regnen begonnen. Die beiden zahlen, torkeln ein paar Schritte, dazu sind sie beide erstaunlicherweise noch fähig, En Munich entschwindet, entschwimmt, spielt und bechert aber gut hörbar noch weiter, und sie steigen dann in etwas wie einen Bus.
Wie sich herausstellen wird, fahren in Managua um drei Uhr in der Früh aber keine Linienbusse mehr. Ein privater Collectivo-Kleinbus, wie es sie in Lateinamerika allenthalben gibt?, ein Lieferwagen?, ein planengedeckter Laster? – quien sabe (wer weiß)... Jedenfalls rattert und holpert es, Managuas Straßen sind vielerorts alles andere als ebene Flüsterpisten, schon gar nicht die Fahrpfade querfeldein; dann –
Dann erwacht der Schweizer Gast alleine auf einer der wenigen Bänke, einer Steinbank ohne Lehne, unter brennender Sonne bei einer Bus-Umsteigestation. Gegenüber dem Intercontinental. Erste Reaktion: Es ist zu heiß. Knappe zehn Meter weiter drüben gibt es einen – einen! – Baum, darunter sogar eine weitere Bank. Also sofort dorthin, in den Schatten, auch wenn die genauso steinhart und genauso unbequem ist; er schläft nochmals mindestens eine Stunde.
Nach dieser Stunde aber erwacht er, erbarmungslos, und bleibt wach, mit brummendem Schädel zwar, aber wach.
Und wird sich zunehmend und zunehmend schneller und klarer seiner Lage bewusst. Zwar hat er noch all seine Dollars im Gurt – ihm wurde gesagt, perdidos würden mitunter bis auf die Unterhosen ausgeraubt –, aber seine Brille mit starker Korrektur fehlt ihm. Wahrscheinlich ist sie ihm in dem Gefährt, das ihn hierhergebracht hat, bei den wohl ziemlich ausgiebig nachempfundenen Stößen und Schwüngen von der Nase gefallen. Er erinnert sich zwar, dass sein Gastgeber und er zuvor an dieser Haltestelle mehrfach schon vorbeigefahren sind – aber den Bezug zu frente al parque kann er beim besten Willen und dem bisschen Konzentration, die er schon aufzubringen vermag, einfach nicht herstellen. Wäre er doch noch in Italien, in Perugia, wo er vor gut einem Monat noch war! Wo er die letzten anderthalb Jahre gelebt und an der Università Per Stranieri studiert hatte, wo er sich im – intakten – historischen Zentrum bestens auskennt und auch noch halb ohnmächtig in seine kleine dunkle Wohnung an der Via del Deposito finden würde. An der Lagerstraße sozusagen, oder, etwas weniger schmeichelhaft, in der Deponie, einem kurzen, schmalen und zum Teil überbauten Gässchen, parallel zum das südliche Spinnenbein der Altstadt durchlaufenden Corso Cavour (Cavour, der politische Architekt des Einheitsstaates, darf bei aller Skepsis gegen ebendiesen Einheitsstaat auf keinen Fall fehlen, wenn man nur halbwegs etwas auf sich gibt, auch im ehemaligen widerspenstigen Kirchenstaat nicht). Und hier –? Managua irgendwo. Belebte mehrspurige Straße. Lärm. Busse, die halten, von irgendwoher kommen, irgendwohin fahren, Fahrgäste aussondern, Fahrgäste schlucken. Nicht-mehr- oder Noch-nicht-Fahrgäste, die sich an ihm vorbeischieben, ihn nicht beachten, hay muchos perdidos (es gibt viele auf ihrem Alkoholtrip Verlorengegangene), besonders am Samstag. Jenseits der nervösen Spuren das auch damals recht noble Inter, bienvenidos en la terra de... –
Aber halt!, er hat doch die Adresse. Er greift in die Brusttasche, die richtige, und siehe da, der Zettel hat sich nicht verflüchtigt. Er zieht ihn aus der Tasche, hält ein Taxi an.
Doch bei den Taxis muss man wissen, dass sie in Managua wie collectivos funktionieren – oder damals funktionierten. Sie fahren ihre Routen und bedienen nur innerhalb ihres Sprengels jede Adresse – sofern sie sie denn nachrevolutionär auch wirklich finden oder fanden. Sonst fragen sie sich halt durch, verfahren sich, wie der Fahrer, der ihn und die Deutschen vom Flughafen in die Stadt fuhr. Allerdings ist man anders als bei der Ankunft hierzulande nicht alleine oder zu dritt, weil man sich vor der Fahrt zusammengetan hat; mitunter pressen sich so viele in die Kabine, wie Maße und Massen nur immer erlauben. Wie in den collectivos, den Kleinbussen und -lastern, die bei Bedarf auch so vollgepfropft werden, dass sich die Räder nur knapp noch drehen.
Doch das Problem ob Richtung richtig oder falsch stellt sich für den Schweizer Gast gar nicht; die Aufschrift auf dem Zettel, die er selber ohne Brille ja kaum mehr lesen kann, entpuppt sich sehr schnell als una dirección de Mexico (Guadalajara) – die ihm in Perugia zugesteckt wurde; nix da von frente al...
Man vergesse nicht, wir sind, vor allem aus junger Optik, in grauer Vorzeit. Keine Mobiltelefone, keine Laptops oder Tablets; von SMS, E-Mail oder WhatsApp ganz zu schweigen, und der Neo-Nica und seine Noch-nicht-Gattin haben zu Hause überhaupt kein Telefon, auch kein stationäres. Und es ist Samstag, beide sind also nicht in den Unis, wo sie ja leicht zu finden wären.
Was nun –? Schlimmstenfalls ins Inter, man hat ja Dollars genug, und am Montag wieder auftauchen; für diesen wirksamen Panikbegrenzer ist man immerhin schon wieder nüchtern genug.
Doch Moment mal: Barrio El Edén, primera calle... – ihre Eltern! Falls denn die Revolution oder sein noch nicht gar so brillantes Gedächtnis dieses Ziel nicht vernebelt. Auf jeden Fall unbedingt nächstes Taxi, zum Glück zirkulieren viele, und eben Barrio El Edén... Der Fahrer nimmt ihn mit, fragt sich aber nicht durch, sondern lädt ihn nach recht kurzer Strecke wieder aus, er sei angekommen, wiewohl nichts nach der Ankunft aussieht, die er meint. Zum Glück hat er neben seinen Dollars auch die nötigen Córdobas dabei, noch immer dabei, die der Fahrer, der seinen Zustand bestimmt sofort erkannt hat, für die kurze Strecke wohl eher zu reichlich verlangt. Der extranjero merkt’s trotzdem; was soll‘s, streiten mag er nicht, jetzt erst recht nicht... Er stolpert ein wenig herum, kann sich aber für keine Richtung entscheiden. Noch ein Taxi, wieder Barrio El Edén, primera calle... – immer noch fremd alles, dennoch etwas, eine Spur bekannter irgendwie. Ach so, da – da sieht er einen Taller, eine Autowerkstätte: ein paar Hütten und ein ziemlich demontierter rostiger cremefarbener VW-Bulli davor. Bei dem, ja, genau bei dem war man doch in den fünf oder mittlerweile sechs Tagen schon mindestens zwei Mal, weil am Japaner-Oldie etwas nicht mindestens so rund lief, wie es halt auch in Nicaragua rund laufen muss, damit Autos fahren... Der Mechaniker, ein draller, untersetzter, stets schwitzender, ziemlich dunkelhäutiger Mann mit verschmitzten Schweinsaugen und einem Wuschelkopf, ist ein wahres Improvisationstalent, denn Originalersatzteile sind hier kaum zu bekommen. – Da also irgendwo seitwärts hinein (man musste ja zu Fuß zurück, wenn man die Karre dort lassen musste). Ein Armenviertel: erdgestampfte Wege, Hütten mit erdgestampften Böden, wohlgenährte, niedliche Schweinchen, schwarz gescheckt auf rot-, fast rehbraunem Grund. Der Verirrte gerät in eine Sackgasse, eine jüngere Frau, bestimmt schon Mutter mehrerer Kinder, fragt ¿Qué quiere usted? (Was wollen Sie) Er: Nada, nada; kehrt um, tut ein paar Schritte, und da – da sieht er trotz der fehlenden Diopten die nächste geteerte Straße, sieht den Parque – und das zweistöckige Haus –
„Wo kommst denn du her?“, fragt ihn sein Gastgeber, wie er über die Schwelle tritt. Er: „Wenn ich das so genau wüsste – perdido de viaje eben. Wenn ich euch nicht gefunden hätte, wäre ich ins Intercontinental gegangen. Dort gegenüber bin ich nämlich erwacht.“





























