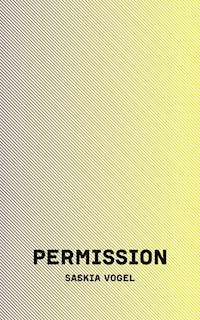
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Secession Verlag Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachdem Echos Vater von einer mörderischen Strömung an den Küsten von Los Angeles in den Tod gerafft wird, sinkt die junge Frau in einen sie immer tiefer herabziehenden Strudel der Lähmung. Ohne wahre Freunde und belastet mit einer nicht unkomplizierten Beziehung zu ihrer Mutter, versucht die gescheiterte Schauspielerin, Trost zu finden, indem sie sich in den Leben von Fremden verliert. Als sie zufällig der Domina Orly begegnet, fühlt es sich für sie endlich so an, als hätte sie jemanden gefunden, der sie für das, was sie ist, hegt und schätzt. Doch Orlys gut fünfzigjähriger Houseboy, Piggy, ist noch nicht willens, jemand anderen an der intimen Beziehung zu seiner Herrin teilhaben zu lassen, für die er doch alles gegeben hat. In Permission erzählt Saskia Vogel die Liebesgeschichte von Menschen, die an ihren Erwartungen und Träumen erkrankt sind und im Reich der Erotik nach Ruhe und Heilung suchen. Durch die Landschaft des eigenen Begehrens straucheln sie geplagt von der Suche nach einer Antwort auf diese eine ihnen heilige Frage: Wie möchte ich geliebt werden? Saskia Vogel leuchtet mit tiefer psychologischer Kenntnis und zarter, aber klarer Sprache das Verhältnis zwischen Liebe, Gewalt und traumatischer Erfahrung aus und hat mit ihrem Debüt ein funkelndes, packendes Juwel der jüngeren feministischen Literatur zum Thema Sexualität und Gewalt geschaffen – ehrlich und intensiv!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PERMISSION
SASKIA VOGEL
Roman
Aus dem amerikanischen Englischvon Benjamin Dittmann-Bieber
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Permission.
© 2019 Coach House Books, Toronto 2019
Permission Copyright © by Saskia Vogel, 2019
By agreement with Pontas Literary & Film Agency.
Erste Auflage
© 2021 by Secession Verlag für Literatur, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Benjamin Dittmann-Bieber
Lektorat: Christian Ruzicska
Korrektorat: Peter Natter
www.secession-verlag.com
Typografische Gestaltung: Julie Heumüller, Berlin
Satz: Marco Stölk, Berlin
Herstellung: Daniel Klotz, Berlin
Druck und buchbinderische Verarbeitung:
Friedrich Pustet, Regensburg
Papier Innenteil: 100 g/m2 Fly 05
Umschlagmaterial: 160 g/m2 Irisleinen
Gesetzt aus FF Hertz und INSTITUT
ISBN 978-3-966390-24-8
eISBN 978-3-966390-25-5
ICH BIN PORNOGRAFIN.SEIT MEINER KINDHEIT SEHE ICH,WIE SEX DIE WELT DURCHSTRÖMT.
Camille Paglia
Letzte Nacht konnte ich nicht schlafen, also fuhr ich los. Ich wollte eine Runde über die Halbinsel drehen, die Hügel rauf und runter fahren, im Norden die Stadt im Blick, im Westen den Hafen und den Pazifischen Ozean, der sich bis zum dunklen Horizont streckte. Es war kurz nach Mitternacht, deshalb schaltete ich einen Rocksender ein, auf dem eine nächtliche Anrufsendung über Sex und Beziehungen lief. Die gab es schon, solange ich denken konnte, schon lange bevor ich angefangen habe, über mehr als nur Händchenhalten nachzudenken. So eine Art von Sendung, die einem die Fahrerei erträglich machte. Wenn du schon jedes Wort von jedem Song im Radio mitsingen kannst, sind Gespräche das Beste gegen die Langeweile hinter dem Steuer. Nervöse Anrufer machten sich sehr verletzlich gegenüber einem Psychologen, der wirklich schon alles gehört hatte. Er tat sein Bestes, um zu helfen, und versicherte den Leuten, dass sie nicht alleine seien mit ihrer Angst, ihrer Verwirrung oder ihrem Begehren. Was auch immer sie sich wünschten, sei ihnen erlaubt, sagte er, so lange es sicher, vernünftig und einvernehmlich war. Nur bei einer seiner Fragen sträubte es sich in mir. Immer dann, wenn eine junge Frau mit einem Problem anrief, fragte er zuerst: »Wo ist dein Vater?« Wo ist dein Vater? Als ob das der Schlüssel zu allem wäre.
INHALT
ECHO
PIGGY
DIE LIEBENDEN
MUTTER
DANK
ECHO
Die Hügel waren schlafende Riesen, die in ihren Träumen zuckten. Wenn sie sich in ihren Betten wälzten, kamen Wartungstrupps und flickten die Risse in der Küstenstraße, und das Meer schluckte Steine vom Ufer weg. Wenn in der Trockenzeit die Hügel Feuer fingen, stand ich an den Klippen und sah zu, wie die Helikopter ihre Tröge ins Wasser senkten. Ich suchte nach den Blicken der Piloten, wenn der Hubschrauber in den Himmel stieg, hoch und über das Haus meiner Eltern, und hoffte, dass sie nichts als Wasser trugen. Buschfeuer und kaputte Straßen waren alltägliche Gefahren wie Klapperschlangen und Autounfälle. In meinem Schrank stand ein gepackter Koffer bereit, falls die Erde beben oder ein Feuer über die Straße wehen sollte. Schon als Kind wusste ich, dass diese Landschaft keinen Halt bieten würde.
Der Landstrich führte andere Wunder vor die Haustür meiner Familie. In den Buchten sahen wir vorbeiziehende Wale auftauchen und aufspringen. Wir zählten sie die Saison über und brachten unsere Strichlisten zur Walbeobachtungsstation, einem quadratischen Gebäude neben einem Leuchtturm, der von einem Garten mit einheimischen Pflanzen umgeben war. Mit Bakelitkopfhörern hörte ich Unterwasseraufnahmen von Walen, ihre verwunschenen Gesänge, ihre Herzen. In der langen Stille zwischen jedem bedächtigen Herzschlag fühlte ich meinen eigenen Puls. Ich kehrte oft an diesen friedlichen Ort zurück und fand Ruhe im Kokon der steten, ebenmäßigen Basstöne.
In einem anderen Raum stellten Dioramen die jahrhundertelange Erosion der Uferlinie in der Gegend dar. Zwanzig Meter, vierzig Meter, futsch. Das aktuelle Modell zeigte die Klippen, wie sie jetzt waren. Lange nichts mehr abgebrochen, nicht einmal in den Erdrutschzonen. Aber ich wusste, was das bedeutete. So ein Bruch war überfällig. Noch bevor ich alt sein würde, würde das Land sich unserer Körper bemächtigen, und wir als Geister auferstehen. Geister, wie die junge Frau, die beim Leuchtturm spukte. Sie hatte sich von diesen Klippen gestürzt, als sie sicher war, dass ihr Matrose niemals zurückkehren würde. Sie ging ins Nirwana ein, um ihn zu finden. Es war die romantischste Geschichte, die ich kannte. Ich schwelgte in Vorstellungen vom Nirwana der Liebe. Eine Hingabe des Selbst zum Fühlen, einem Fühlen wie in den Nächten, in denen ich mit zwischen meinen Beinen gefalteten Händen getrost einschlief.
In diesen Nächten war ich mir sicher, das aus den Wellen aufsteigende Lachen der Liebenden zu hören. Ihre Freude lockte mich. Einmal folgte ich dem Geräusch bis zum Ende des Gartens, durch den Zaun und zu den Klippen, ich krabbelte unter der Absperrung her, schob mich zentimeterweise näher und näher an den Abgrund heran, näher als ich es je gewagt hatte. Ich schaute die Wand aus Sedimentgestein hinunter und entdeckte einen Felsvorsprung. Verschlungene Gestalten, von einem süßlichen Dunst umgeben, wie eine Schale verwelkender Rosen. Sie lachten, als sei ihr Fels der einzige, der nie zu fallen versprach. Falle, falle, falle, wisperten die Klippen. Lieber Gott, wenn ich falle, lass mich beim Aufprall sterben. Eine Lähmung wäre schlimmer als der Tod, dachte ich, und das machte mir Angst. Ich konnte mich mir nicht ohne diesen Körper vorstellen, obwohl ich schon als Kind seine Begrenztheit spürte, seine naturgemäße Überalterung. Der Ruf wurde lauter, und schließlich ging ich nicht mehr zu den Klippen.
Als ich zehn war, hatte mein Vater mein Leben in Angst satt. Am Fuß der Klippen erwarte mich nicht der Tod, sagte er, sondern ein Strand. Ich käme überall hin, solange ich mich in meiner Umgebung zurechtfinden würde. Ich glaube, diese Klippen wurden für ihn immer wichtiger, denn je länger wir in diesem Haus waren, umso geringer wurde sein Zugriff auf uns, vor allem auf meine Mutter, deren Weigerung, glücklich zu sein, eine Form von Tyrannei war. Mit den Klippen kam er klar. Den Sedimentfelsen bekletternd, einen steilen und sandigen Weg hinabrutschend, brachte er mir alles über Standbein und Haltegriffe bei, und wie man die Steine liest.
Unter unseren Füßen das Meer, gleichgültig. Es war ein steiniger Strand, weder zum Schwimmen noch zum Sonnenbaden geeignet, am leichtesten per Boot erreichbar. Am Ufer: Gezeitentümpel, sonnenverbrannter Seetang, Möwenkadaver, von Salzluft zerfressene Dosen, wettergegerbte Sexmagazine, Feuerspuren. Ich stellte mir das lavaartige Glühen mitternächtlicher Fischer vor, die ihren Fang rösten, immer auf der Hut vor den Gesängen der Sirenen. Sogar die Luft an diesem Strand war klebrig.
Ich verweilte bei geöffneten Doppelseiten nackter Frauen, die in der Sonne verblichen. Die angenehme Spannung, die Muskelkontraktionen der Seegurke, das weiche Saugen der Tentakel einer Seeanemone, wenn ich meinen Finger ins Wasser steckte, und mir einbildete, ich sei ein Clownfisch und immun gegen ihre Nesseln.
Rostfarbene Betten aus Seetang durchbrachen das Meeresblau, rote Markierungsbojen wackelten, wo Fischer ihre Fallen ausgelegt hatten. Hinab in den Halbmond unserer Bucht kletterten mein Vater und ich entlang der Lefze ihres steinigen Mauls. Wenn Ebbe in Flut umschlug, tosten schaumige Wellen gegen die Kehle der Höhle, und wenn sie sich zurückzogen, leckten sie den kieseligen Boden ab. Als ich die Höhle und diesen steinigen Abgrund zum ersten Mal sah, habe ich mich geweigert, ihm hinüber zu folgen.
»Keine Angst«, sagte er. »Du fällst einfach nicht.«Fünfzehn Jahre lang kletterten wir über diese Höhle.Und dann, eines Tages, fiel er.
Ich sah es nicht geschehen. Er war vor mir, und dann war er es nicht mehr. Das sagte ich auch den Rettungskräften. Da war ein Seenotrettungsboot. Hubschrauber. Küstenwache. Taucher. Sie waren draußen auf dem Wasser bis zum Morgen. Man sagte uns, sie würden im »Suchen-und-Retten-Modus« bleiben, bis »das Opfer« gefunden wäre. Nach vierundzwanzig Stunden sprachen sie von »Bergung der Leiche«, aber auch das scheiterte. Ich fragte, wie sie es jetzt nennen würden, aber darauf antworteten sie nicht mehr. Sie schoben sich die Zuständigkeit hin und her, alle sagten mir, ich solle eine andere Abteilung fragen.
In der Zeit danach verbrachte ich die meisten Tage zu Hause, meine Hände gegen die großen Glasscheiben vor unserem freien Meerblick gepresst. Als ich so lange hinausgeschaut hatte, dass ich Meer und Himmel nicht mehr unterscheiden konnte, blieben meine Hände am Fenster, spürten jede Vibration, jeden Windstoß. Ich war noch nicht auf der Welt, als meine Eltern von der Reederei, für die sie arbeiteten, von Rotterdam nach Los Angeles versetzt wurden, aber ich war alt genug, mich daran zu erinnern, als sie es dann bauten. Ihr Traumhaus. Wie sorgfältig sie jedes Detail bestimmten, die Freude, die sie daran und miteinander haben konnten. Ich verstand nicht, warum wir das kleine Haus mit den Blumentapeten unten am Hafen verlassen mussten, wo wir Kränen hatten zusehen können, wie sie Container von Frachtschiffen abluden, und wo ein Mann, der mit einer Trompete unterm Arm durch die Nachbarschaft skatete, jeden Tag bei Sonnenuntergang anhielt, um den »Zapfenstreich« zu spielen. Als ich das Haus dann zum ersten Mal sah, wirkte es surreal.
Ein großer weißer Kasten, gebaut auf eine Steilklippe, einer ins Meer vorstoßenden Landzunge, der sich von allen anderen Häusern in der Straße abhob. Statt Sirenen und Trompeten hörten wir Pfaue und Seemöwen. Das Haus war aus Glas und Stahl und voller Licht. Von innen konnte man fast überall den Ozean sehen. Bei Sonnenuntergang färbten sich die Wände erst orange, dann violett, schließlich kam die Dunkelheit und mit ihr die Sterne. »Jeder Tag ist wie ein Liebesbrief«, sagte mein Vater immer, meine Mutter in seinen Armen, und sie genossen das Leben, das sie gemeinsam aufgebaut hatten. So stellte ich mir die beiden gern vor. Optimistisch und im Vertrauen auf irgendeine Logik, die sie davon abhielt, sich scheiden zu lassen.
An diesem Fenster stehend sah ich nicht den Ozean, sondern Fugen: Silikon, Mörtel, Scharniere und Beschläge. Alles, was das Haus zusammenhielt, sämtliche seiner potenziellen Bruchstellen. Geborstene Bodenkacheln im Foyer, Risse im Putz der Wände. Ich untersuchte das Silikon, das unsere Küchenspüle festhielt, die Wölbungen an den Ecken, den Grund dafür, warum das Becken nie richtig trocknete. Korrosion. Ich nahm die Mülleimer aus dem Schrank unter der Spüle, und fuhr mit dem Finger über das narbenartige Material, das sie festhielt, fühlte nach Kanten, die sich gelöst hatten. Mit dem Daumennagel prüfte ich ihre Unversehrtheit, mir wurde schlecht, wenn er hineinglitt.
Nachdem mein Vater am Freitag vor dem Memorial Day verschwunden war, hatte meine Mutter vergessen, unser Grillfest abzusagen, was zu peinlichen Gesprächen an der Haustür führte. Außer dem Caterer baten wir niemanden herein. Ich zog den Stecker des Telefons. Es gab für mich keinen Grund, nach dem langen Wochenende in meine Wohnung in der Stadt zurückzukehren, also wartete ich eine Weile ab, und fügte mich dann ein in ihren Rhythmus von aufgewärmten Makkaroni und Schlaf, mariniertem Fleisch und Suff. Der Caterer hatte alles in Einzelportionen abgepackt, ein paar in die Tiefkühltruhe, ein paar in den Kühlschrank. Du musst doch essen, sagte sie. Meine Mutter teilte jede Portion in zwei Hälften, und wenn sie mir den Teller reichte, sagte sie: Das ist kein Grund, sich gehen zu lassen. Blanca putzte hinter uns her und sorgte dafür, dass immer frische Milch für meinen Vater da war, wie üblich. Nachdem die Milch sauer geworden war, fragte Blanca, wo Mr. Jack sei, und meine Mutter sagte, er würde zurückkommen, aber Blanca hatte sich wohl in der Nachbarschaft erkundigt, denn ich hörte sie im Wäscheraum weinen.
In diesen Tagen erzeugte seine Abwesenheit eine Art Gelassenheit zwischen meiner Mutter und mir, aber miteinander zu reden schafften wir noch nicht. Was gab es auch zu sagen? Vielleicht kommt er doch zurück. Und als ich dachte, nein, wahrscheinlich ist er wirklich weg, wollte ich nicht mehr reden, sondern schreien. Schuldzuweisungen und Vorwürfe. Und hätte ich mit Vorwürfen angefangen, ich hätte ihre Entgegnungen gefürchtet. Ich hätte ihr vorgeworfen, ihn von sich gestoßen zu haben, und sie hätte mir meine Angst als Grund für seinen Tod vorgehalten. Wenn wir uns erschöpft hätten, hätten wir vielleicht zusammen geweint, und über den Verlust eines Mannes geredet, der nie besonders gut darin gewesen war, in seinem Leben Platz für uns zu schaffen. All das war viel zu viel, und viel zu unabsehbar. Also hielt ich lieber die Klappe und wartete ab.
Jeden Abend saßen wir auf dem Balkon und starrten auf das Meer. Jeden Abend ging sie in die Speisekammer und holte eine Zigarette aus dem Vorratstopf mit der Aufschrift »Knoblauch«. Die Asche ließ sie auf ein Stück nasse Küchenrolle fallen und schmiss den rußigen Lappen in die Mülltonne in der Garage. Sie wollte keine Spuren hinterlassen, weil sie ihm versprochen hatte, aufzuhören. Eines Morgens wachte ich auf und bemerkte einen Aschenbecher auf dem Küchentisch und abgestandenen Rauch in der Luft. Ich habe sie nie weniger geliebt als damals.
In der Rückschau scheint alles unausweichlich. Meine Mutter und mein Vater spielen heile Familie, bauen ihr Leben und ihre Liebe in vertrauten Mustern auf, ohne je die Struktur zu hinterfragen, eine Struktur, die nicht halten kann. Eigentlich erinnere ich mich kaum daran, wie es in diesen ersten Wochen nach seinem Sturz weiterging und warum – ich erinnere mich nur an diese Vergesslichkeit: Ich will mir in der Küche ein Glas Milch holen, nehme aber nur ein Glas aus dem Schrank, werde von etwas abgelenkt, finde mich dann in einem anderen Zimmer wieder, und frage mich, was das Glas in meiner Hand zu suchen hat. Das Weinen, das mich nicht schlafen lässt, die Gedanken, die niemals aufhören, Schuld, Wut, der Abgrund von Verlust. Tag um Tag verging, dann war der Juni vorbei und ich noch immer im Haus meiner Eltern. In Los Angeles kannst du schnell das Zeitgefühl verlieren, selbst, wenn du dich nicht fragst, wo dein Vater ist, und ob weg weg meint und was weg sein bedeutet. Sonne und Himmel sind betäubend. An den Stränden vierundzwanzig Grad und der klare Nachmittagshimmel Tag um Tag um Tag.
Die Wahrsagerin sah das alles kommen. Aber vielleicht haben ihre Worte meine Ängste auch erst auf Trab gebracht, sodass sie ihre Macht auf die Welt ausüben konnten. Manchmal denke ich, wenn sie etwas anderes gesagt hätte, wäre ich jetzt ein anderer Mensch. Du musst schon aufpassen, was du Kindern erzählst. Es verfängt.
Ich begegnete ihr kurz bevor meine Eltern »eine Auszeit« machten, eine probeweise Trennung für ein paar Monate. Ich war sieben oder acht, aber schon gefasst auf Veränderungen. Vielleicht hatte es etwas mit dem Umweltunterricht in der Schule zu tun, der uns eine Furcht vor labilen Erdböden und endlichen Wasservorräten einflößte. Manche Kinder kamen vielleicht mit ein paar Lektionen über Umweltschutz davon, aber ich, ich verlor das Vertrauen, dass irgendetwas je überdauern könnte. Ich erwartete immer eine Tragödie.
Die Walbeobachtungsstation veranstaltete, wie jedes Jahr, ein großes Fest zur Eröffnung der Walsaison. Im Vertrauen darauf, dass es schon halten werde, lehnten die Menschenmassen ihr Gewicht auf das Geländer an den Klippen, drückten Ferngläser an die Augen, und suchten das Meer nach Fontänen und Schwanzflossen ab. Kinder aus meiner Schule steckten die Hände in Tüten mit Zuckerwatte und spielten Kleb-den-Schwanz-an-den-Wal, als ob es nicht anders hätte sein können. Ich wollte nur wissen, wie lange wir noch hatten, bis alles vorbei wäre. Bis all das, Sonne und Meer und Fels, ihr Ende fänden.
Am Morgen des Jahrmarkts hatten meine Eltern wieder gestritten. Sie stritten schon so lange, dass sie mich wohl vergessen hatten, wie ich darauf wartete, ins Auto zu steigen und Wale sehen zu können. Sie schrien sich ihre widersprüchlichen Ansichten gegenseitig ins Gesicht, irgendwas darüber, wie mein Vater seinen Sonntag verbringen wollte. Er wollte Zeit für sich; meine Mutter sagte, Wochenenden seien für die Familie da, und dass der Jahrmarkt seit Wochen im gemeinsamen Kalender gestanden habe. Er bestand darauf, dass er sowieso alles nur für die Familie tat und jetzt mal ein paar verdammte Augenblicke für sich bräuchte. Er krönte seinen Wutausbruch mit den Worten »Wenn es dir recht ist, Schätzchen.« Schätzchen: Kalt und schmierig vor Sarkasmus. Dass man Worte der Zuneigung auch als Waffe benutzen konnte, war mir bis dahin nicht klar gewesen. Meine Mutter verstummte. Er stieg ins Auto, um »eine Runde zu drehen«, ich ging mit meiner Mutter allein zum Jahrmarkt. Was eine triste Sache war. Sie betupfte ihre Augen hinter der Sonnenbrille und verschwand mit anderen Müttern, ich warf Pfeile auf Ballons.
Abseits des Hauptwegs, hinter Ständen, die mit Plusterfarben bemalte Windjacken verkauften, sah ich ein purpurnes Zelt schimmern. Eine Schiefertafel mit Kristallkugel und Sternen. Ich stellte mir eine Meereshexe vor, die zwar ihren Sitz an Poseidons Hof eingebüßt hatte, nicht aber die Macht ihrer dunklen Magie. Ich war mir sicher, dass sie nur auf mich wartete. Ich bettelte meine Mutter um das Taschengeld der ganzen Woche an, damit die Wahrsagerin mir sagen könnte, dass dieses Gewitter meine Familie nicht auseinanderreißen, sondern vorübergehen würde, wie andere vor ihm auch.
Nach den Streits, die ihrer Trennung vorausgingen, hatten sie sich immer mit mir hingesetzt und gesagt: Dass wir streiten, heißt nicht, dass wir uns nicht lieben. Wir gehen uns nur deshalb so auf die Nerven, weil wir uns so lieb haben. Ihre Krise dauerte schon so lange, dass ich die Abwesenheit meines Vaters in meinem Alltag, selbst wenn er tatsächlich zuhause war, beim Abendessen aber am Telefon hing und den Brandmeister gab, als eine Art von Liebesdienst zu verstehen begann. Auf eine Weise war es das. Er kümmerte sich um uns. Und wie er meiner Mutter so gern in Erinnerung zu rufen pflegte, gab es das hier – hausumfassende Geste – nicht ohne das da – klingelndes Telefon und Akten unterm Arm. Meine Mutter wollte Zeit mit ihm, sagte sie. Aber die beiden konnten sich nie einigen, was mit dieser Zeit anzufangen wäre. Sie machte gern Pläne, er wollte sich lieber durch den Tag treiben lassen. Erst nachdem ich Orly begegnet war und verstanden hatte, dass zu lieben, wie du liebst, nicht reicht, dass du vielmehr darauf achten musst, wie Menschen geliebt werden wollen und müssen – wurde mir klar, dass sie füreinander blind gewesen waren.
Als Kind konnte ich einfach nicht begreifen, warum eine Geschichte wie ihre so beschissen enden musste. Es klang zuerst wie der Stoff von alten romantischen Komödien, mit willensstarken Frauen, die schnell reden, und Männern, die das Mädchen am Ende doch rumkriegen. Mein Vater, der Geschäftsmann im Ausland. Meine Mutter, seine ebenbürtige Kollegin, die man zuerst für seine Sekretärin hielt. Ein Kampf der Willenskräfte, der zum Kampf um ihr Herz wurde. Ich dachte, mein Dasein würde bedeuten, dass ihnen ein Happy End vergönnt war. Aber wenn ein Happy End so aussah, dann würde ich mehr Liebe brauchen als sie. Alles würde gut sein mit so einer Liebe.
Im Zelt der Wahrsagerin war es stickig und heiß, bis auf einen Luftzug, der in meine Gummisandalen hineinwehte. Am Tisch bat die Wahrsagerin um meine Hand. Sie betrachtete meine Linien. Ich betrachtete sie. Die Sicheln ihrer Fingernägel, die Halbmonde, die an Ohren und Hals hingen. Ihre Augenlider: blaugrüne Mondsicheln.
Sie sagte: »Wenn andere Leute fallen, dann können sie wieder aufstehen, sich abklopfen und weitermachen. Du nicht. Du zerbrichst. Und du musst jedes Mal rausfinden, wie du dich wieder zusammensetzt.«
Ich zog meine Hand zurück.
»Das ist, was ich sehe«, sagte sie.
Ich fragte nie wieder nach meiner Zukunft.
Die Wahrsagerin hätte es anders sagen können: Du bist ein sensibler Mensch; du brauchst ein dickes Fell. Dann hätte ich mir Hornhaut draufgeschafft. Stattdessen versuchte ich, nicht zu zerbrechen, bewegte mich reibungslos durch die Welt, folgte dem mir vorgezeichneten Weg. Ich war immer gut in der Schule, mein Haar war gelockt, mein Gesicht geschminkt, stets bereit für die nahende Liebe. Die Macht der Liebe würde mich erlösen und meinen Charakter formen. Vermutlich kam ich so zur Schauspielerei, nämlich um eine Vorstellung von den vielen Ichs zu bekommen, die ich werden könnte, wenn die Macht der Liebe mich einst fortreißen würde. Ich wollte diese anderen Leben anprobieren, mir jede neue Rolle überziehen, und die Brüche in mir bedecken.
Mein erstes Vorsprechen war für ein innovatives neues Joghurtprodukt, erdacht für Frauen, die viel unterwegs sind. Eigentlich waren das längliche Plastikbeutel mit Fruchtjoghurt zum Auszuzeln, ganz ohne Löffel. Das war kurz vor der zwölften Klasse. Die Casting-Agentin, die sich im Sommer meine Theatergruppe angesehen hatte, rief sofort nach der Probe an, und sagte, ich sei genau das, was sie wollten: ein frisches Gesicht für ein frisches Produkt mit einer großen, landesweiten Kampagne. Nichts hatte sich je so gut angefühlt. Ich war jung, würde aber nicht ewig jung bleiben. Ich wollte nicht so enden wie Linda.
Linda war eine Freundin meiner Mutter aus der Reederei. Anders als meine Mutter hatte sie ihren Job nicht aufgegeben und kam manchmal vorbei, wenn sie beruflich in der Stadt war. Ich erinnere mich an ihr kupferrotes Haar und ihre Augen einer Kleopatra, an ihre Art zu rauchen und beim Reden meinen Vater am Knie zu berühren. Wie nervös ihn diese Berührung machte. Ich glaube, meine Mutter sah gern, wie er sich dann wand, weil sie so etwas gegen ihn in der Hand hatte.
Linda war etwa fünfzig und ich ein Teenager, als ich sie das letzte Mal sah: dasselbe Haar und Make-up, dieselbe Hand am Knie. Mein Vater freute sich wohl wie eh und je. Nach dem Essen verließen er und Linda den Tisch, um ihren Wein auf dem Balkon auszutrinken, und als meine Mutter und ich den Tisch aufräumten, fragte sie mich, ob ich nicht auch der Meinung wäre, dass es für Linda an der Zeit sei, die Femme-fatale-Masche an den Nagel zu hängen. Ich habe ihr damals pflichtbewusst zugestimmt, dass Linda in ihrem Alter mit diesem Auftritt eine tragische Figur abgebe. Aber dieses Zugeständnis setzte sich in mir als Keim des Widerspruchs fest. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich sah meinen Vater gern so entspannt und glücklich. Und ich mochte Linda. Es war so vieles toll an ihr: ihre Energie, ihre Haltung und etwas Geheimnisvolles. Eine Leichtigkeit, die meiner Mutter fehlte. Ein gewisser Stil. In Linda sah ich eine Frau, die Freude geben und annehmen konnte, und ich sah, was das mit meinem Vater machte. Bis dahin dachte ich, die Unzufriedenheit meiner Mutter sei edel und großherzig: Ihr Leben wäre für sie erfüllt genug, seine üppigen Geschenke abzutun. Ich hielt die Leidensfähigkeit meiner Mutter für ein Zeichen ihrer Noblesse.
Mein Joghurt-Spot war kurz vor den Weihnachtsferien noch immer auf Sendung, während alle anderen in der Schule auf die Resultate ihrer College-Bewerbungen warteten. Ich war alledem voraus. Meine Karriere lief schon, also hielt ich mich daran und blieb in Los Angeles, lange nachdem die meisten Leute aus meiner Klasse weggezogen waren. Es lief echt gut. Fünf Jahre lang war ich genau das, was sie wollten, aber dann war mein eigentümlicher Glanz verblasst, und mit Mitte zwanzig wollte mich niemand mehr. »Sie konnten dich nicht in der Rolle sehen«, war alles, was ich von meinem Agenten zu hören bekam, bevor er mich im selben Jahr fallen ließ. Mir war völlig klar, was sie damit meinten. Ich war nur überrascht, dass sie so lange gebraucht hatten, es endlich zu kapieren. Ich hatte nie die große Leidenschaft fürs Schauspielen, ich hatte nur leidlich mitgemacht. Aber meine letzte richtige Rolle war zwei Jahre her. Ich spielte eine »junge Betreuerin im Ferienlager«, in der Neuauflage einer Serie aus den Neunzigern über reiche High-School-Kids. Eine Miniserie mit drei Episoden. In der ich ein paar Zeilen hatte. Und nach ein paar Tagen in Malibu, wo ich die meiste Zeit über mit dem Rest der Crew im Schatten rumlungerte und wir Geschichten über das Leben in den Canyons austauschten – über verschollene Menschen, Berglöwen und geheime Haschplantagen –, hatte ich ein anständiges Jahresgehalt verdient. Es war genug, um mehr haben zu wollen, aber auch genug, um Gedanken an echte Bemühungen zu zerstreuen.
Wie ich meine Zeit verbrachte, kann ich nicht so genau sagen. Ich las. Ich betrieb Dating, als wäre eigentlich das mein Job. Mit Männern hatte ich leichtes Spiel. Natürlich war es auch mehr als das, aber ich schätzte die Bequemlichkeiten, die eine Frau bei einem Date mit einem Mann genießt. Darin war ich gut erprobt. Frauen hingegen verpassten mir Lampenfieber. Mit Frauen gab es einen offenen Raum für Möglichkeiten, ein Potenzial, die Beziehung nach unseren eigenen Bedingungen zu definieren, es bedeutete aber auch, dass ich für mich selbst einstehen musste. Nach Ana hatte ich Angst vor Verletzungen. Und hinter dieser Angst steckte der Wunsch nach Liebe, nach Gefühlen, nach den Träumen, die ich in der Stille zwischen zwei Herzschlägen träumte.
Was das Schauspielen betrifft, hoffte ich vermutlich, auch weiterhin machen zu können, was ich bisher gemacht hatte. Aber nach »junge Betreuerin im Ferienlager« hatte ich keinen richtigen Job mehr an Land gezogen. In den letzten zwei Jahren hatte ich die Hauptrolle in einem Studentenfilm gespielt, hinter den Kulissen der Herzensprojekte anderer Leute ausgeholfen, und in einem Musikvideo getanzt, privat finanziert von einem Musiker, mit dem ich ein paar Monate lang ab und zu geschlafen hatte. Er war sehr schön, und unsere Körper verstanden sich viel besser als wir, was an sich ja kostbar war.
Um mich über Wasser zu halten, hatte ich die seltsamsten Jobs gemacht. Eine Weile verdiente ich genug damit, bei einer monatlichen Pokerparty in einem privaten Anwesen hinter Mullholland Drive Getränke, Snacks und die Aussicht auf meinen Arsch aufzutischen. Wer seinen Körper in ein enges Kleid zwängen konnte, bekam gutes Trinkgeld. Der Gastgeber meinte, wenn ich wollte, gäbe es noch mehr zu tun. Ob ich ein Business-Kleid hätte? Hatte ich. Es war ein Geschenk meiner Mutter zum Schulabschluss, denn »eines Tages braucht man sowas«, womit sie mir auf ihre Art zu verstehen geben wollte, dass ich Hirngespinsten nachhaschte.
»Hier ist mein Angebot«, sagte der Gastgeber. »Du kommst her zu einem ‚Meeting‘, während meine Frau zu Hause ist.« Aktenkoffer, Unterlagen, bürotaugliche Schuhe, gediegener Schmuck und Make-up. Die volle Montur. Ganz geschäftsmäßig. Und dann ficken wir auf meinem Schreibtisch. Fünfzehnhundert Piepen. Erledigt in einer Stunde.«
Eines der anderen Mädchen, mit denen ich dort arbeitete, ging schließlich auf den Deal ein, aber was weiß ich – nachdem ich ihn abgewiesen hatte, wurde es anders. Was sich bis dahin wie schnelles Geld für kaum mehr als meine Anwesenheit und Gefälligkeit angefühlt hatte, wurde fies. Wie er mit seinem Angebot Anspruch auf mich erhoben hatte. Und wie er es mir immer mehr verübelte, dass ich seinen Avancen nicht nachgegeben habe, obwohl ich bei diesen Anlässen nie als Frau auftrat, die leichte Beute war. Sein Atem in meinem Nacken, wenn ich am Vorratsschrank Nüsse auffüllte. Wie selbstzufrieden er geklungen hat, als er mich unbelehrbar nannte. Ich hatte nicht vor, nach dem Memorial Day dorthin zurückzukehren, und ich freute mich auf das lange Wochenende, um die Dinge mit meinem Vater durchzusprechen. Mein Vater brauchte keine Details zu wissen, obwohl es ihm zu erzählen wohl dazu geführt hätte, dass er mir ein paar Monatsausgaben rübergeschoben hätte. So war er mit Geschenken: pragmatisch und erratisch. Er hätte mir nie auch nur einen roten Heller gegeben, wenn ich ihn direkt danach gefragt hätte. An diesem Memorial Day-Wochenende wollte ich also nur sein Geschäftshirn anzapfen. Er konnte gut die losen Stränge aufsammeln und mit kühlem Kopf zu einem Plan verweben. So einen Plan wollte ich, irgendeine Art von Struktur.
Aber dann war er weg.
In diesen leeren Wochen der Trauer fiel mir die Aufgabe zu, den Kühlschrank aufzufüllen. Nachdem wir uns durch die Barbecue-Vorräte des Caterers gefuttert hatten, wollte ich mich auch noch durch die Speisekammer futtern, aber ich brachte es nicht über mich, irgendetwas darin anzufassen, nicht einmal eine halbleere Tüte Tortilla Chips, zusammengehalten von einem uralten Gummiband, wie sie mein Vater um seine Akten spannte, wenn sie ihm zu dick wurden. Ich brachte es nicht über mich, dieses Gummiband abzuziehen. Es war ausgeleiert und brüchig, und wenn es brechen würde, dann würde ich mich durch die Schublade unter dem Telefon in der Küche wühlen müssen, wo alle Gummibänder, Büroklammern und Werbekugelschreiber endeten. Der Schrott des Lebens, das ganze Zeug, von dem du glaubst, dass du es eines Tages mal sortieren wirst. Der bloße Gedanke an diese Schublade machte mich labil. Sein Zeug aufzuwühlen, fühlte sich bedrohlich an. Darum ließ ich die Tür zur Speisekammer zu und machte dafür längere Ausflüge zum Lebensmittelladen. Auf diese Weise zwang ich mich immerhin zu duschen, und bei den Entfernungen in dieser Stadt war es außerdem eine fantastische Methode, um Zeit totzuschlagen. An manchen Tagen verließ ich das Haus erst zum Schulschluss und nahm die Straße, die um diese Zeit immer von Müttern und Minivans verstopft war, so dass ich im Stau hocken konnte, die Sonne im Gesicht, das Radio an, und in Erwartung auf Erinnerungen daran, wie die Dinge mal gewesen sind.
Als ich in mein Apartment in der Stadt gezogen war, hatte ich mitgenommen, was ich brauchte, und weggeworfen, was ich nicht brauchte, mein Kinderzimmer war also ziemlich leer. Ich borgte mir Klamotten bei meiner Mutter: Caprihose, Ledersandalen und ein Twinset. Der Schrank meines Vaters war geschlossen, nur einmal schob ich die Tür einen Spalt weit auf und schnupperte hinein. Die Luft war abgestanden, aber voll von ihm, und kurz dachte ich, mir würde schlecht werden. Ich schloss die Tür.
Während ich ein paar Meilen mit runtergekurbelten Fenstern zum Einkaufszentrum fuhr, trockneten meine langen Haare im Wind. Von meinem wirren Haar mal abgesehen, sah ich aus wie alle Mütter hier. Die Kleidung meiner Mutter roch nach weißem Jasmin. Manchmal sah ich ihre Füße in den knallroten Schuhen stecken, ihre Beine in den hellblauen Hosen, die mir fast etwas zu eng waren. Wie meine Mutter gern betonte, hatte ich den Knochenbau meines Vaters geerbt. Das ließ mich glauben, dass sie von mir enttäuscht war, aber das Gefühl war gegenseitig. Ich hatte vielleicht starke Knochen, aber was für einem Leben hatte sie sich gefügt?
Ich schob meinen Einkaufswagen durch den Supermarkt und behielt die Sonnenbrille auf. Ich wollte etwas zwischen mir und der Welt haben, der Welt eine andere Fläche zur Interaktion bieten, mich meiner Trauer überlassen. Es war mehr als Trauer, ein Gefühl von Vergiftung, als wäre etwas nicht in Ordnung mit dem Grundwasser, das ich von meiner Haut fernhalten müsste. Ich hoffte, niemanden aus meinem Bekanntenkreis zu treffen. In unserer kleinen Gemeinde hätten mich alle, die mit mir zur Schule gegangen waren, an meinem Gang erkannt, oder an der Rückseite meiner Ohren.
Weder meine Mutter noch ich hatten es mit dem Kochen. Unser Kühlschrank war stets gut gefüllt gewesen mit Auflaufgerichten, die man an unserem Haus abgeliefert hatte wie Opfergaben für einen übellaunigen Gott, aber das hatte jetzt aufgehört, als gäbe es ein Mindesthaltbarkeitsdatum für Mitleid. Ich verstand das Ende dieser Geste als Urteil: Die erste Wallung von Trauer sollte jetzt vorüber sein, schienen die ausbleibenden Mahlzeiten sagen zu wollen. An der Frischetheke kaufte ich Mixturen, für die mein Vater den Sammelbegriff »Salat« verwendet hatte, und die nie zu verderben schienen. Gerichte, wie sie der Caterer für das Barbecue geliefert hatte, als könnte ich dadurch, dass ich den Kühlschrank wieder auffüllte, diesen Tag noch einmal erleben. Dieses Mal würde er nicht fallen.
Wenn es an der Theke keinen Kartoffelsalat mehr gab, schnürte es mir die Kehle zu und meine Nasennebenhöhlen schwollen an. Ich ging dann sofort zur Kasse, schnappte mir eine Rolle Minzdrops, zerkaute die ganze Packung, und das Menthol blies mir die Nase frei. Trotz solcher Anfälle schierer Verzweiflung hatte meine Einkaufsroutine etwas Gutes. Selbst wenn Vorratskammer und Kühlschrank voll waren, drehte ich meine Runden um die Einkaufsregale. Meine Mutter schlief, setzte sich auseinander mit den Leuten, die den Tod verwalten, oder telefonierte mit Verwandten in Übersee. Als sie mir mal den Hörer reichte, kriegte ich es so eben noch hin, mit meiner Cousine Deutsch zu sprechen. Meine Cousine und ich kannten uns nicht besonders gut, unser Austausch war kurz, pflichtbewusst und höflich. Meine Einkaufsroutine gab mir in diesen Wochen etwas Eigenes. Und wenn ich bei diesen Trips unsere Einfahrt rein- und rausfuhr, fielen mir die Männer auf.
Zuerst dachte ich, die Männer wären ein bestimmter Mann: Der alte Nachbar von gegenüber, ein Hafenarbeiter in Rente, der die meiste Zeit entweder in Alaska oder auf Hawaii verbrachte. Aber er war es nicht. Vielleicht sein Bruder oder Cousin. Oder Handwerker, dachte ich, als dort eines Tages ein mit Holz und Einkaufstaschen vom Baumarkt vollgepackter Lieferwagen gestanden hatte. Da war ein Mann im Alter meines Vaters mit einem Pferdeschwanz, der das Bauholz hineintrug, und ein kleinerer Mann, dessen Gang ein verlegenes Schlurfen war. Das erste Mal, als ich den Wagen des Handwerkers am Straßenrand vor dem Nachbarhaus sah, parkte ich auf unserer Einfahrt in einem Winkel, aus dem ich ihn im Rückspiegel beobachten konnte. Er machte Sachen wie mein Vater: Heimwerkerarbeiten mit Planen, Werkzeug, Pflanzen und Bauholz. Auf der Einfahrt stellte er orangefarbene Eimer mit Handschuhen und Malerrollen ab, die der kleinere Mann hinter die Zwergpalmen neben dem Eingang räumte, damit das Durcheinander von der Straße aus nicht so ins Auge stach. An meinem Vater muss wohl mehr dran gewesen sein als Heimwerken, dachte ich, aber jeder Versuch des Erinnerns fühlte sich künstlich an. Meine Erinnerungen hätten die Erinnerung an viele Väter sein können, dachte ich. Hatte ich schon vergessen, was ihn zu dem meinen gemacht hatte?





























