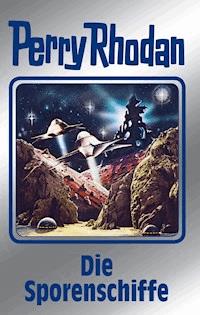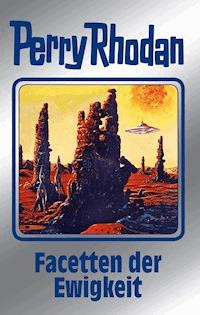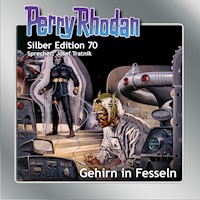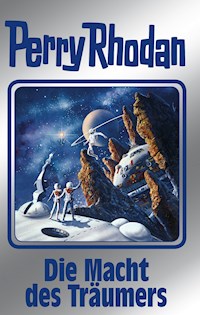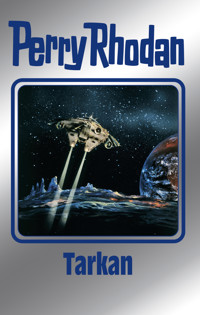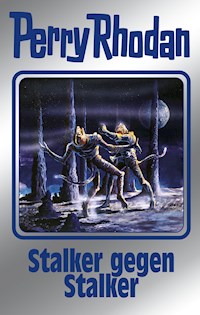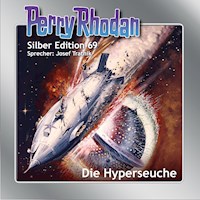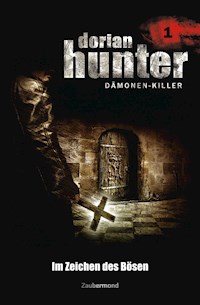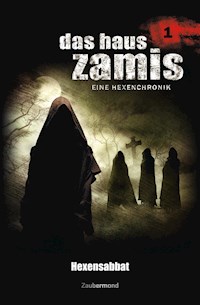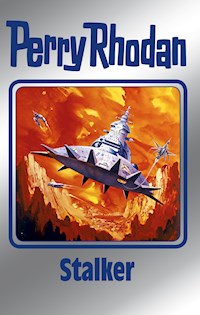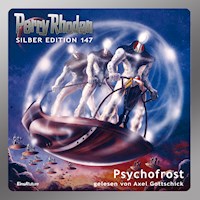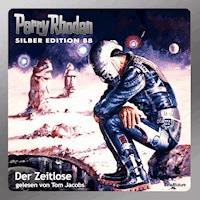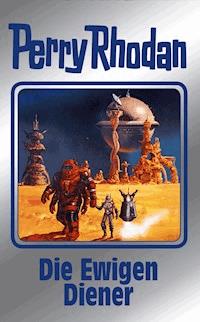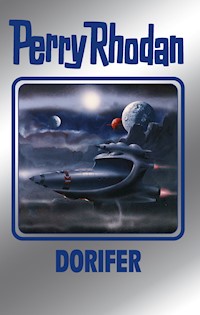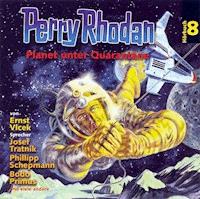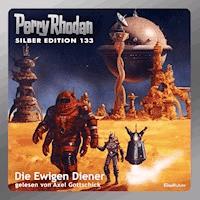Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan-Erstauflage
- Sprache: Deutsch
Alarm auf Mardi-Gras - Ein Stützpunkt in Gefahr Mehr als 400 Jahre sind seit dem Tage vergangen, da Perry Rhodan mit der BASIS von einem der schicksalsschwersten Unternehmen in den Weiten des Alls in die Heimatgalaxis zurückkehrte und auf der Erde landete. Durch seine Kontakte mit Beauftragten der Kosmokraten und mit ES, der Superintelligenz, hat der Terraner inzwischen tiefe Einblicke in die kosmische Bestimmung der Menschheit gewonnen und in die Dinge, die auf höherer Ebene, also auf der Ebene der Superintelligenzen, vor sich gehen. In folgerichtiger Anwendung seiner erworbenen Erkenntnisse gründete Perry Rhodan dann Anfang des Jahres 3588, das gleichzeitig zum Jahr 1 der Neuen Galaktischen Zeitrechnung (NGZ) wurde, die Kosmische Hanse, eine mächtige Organisation, deren Einfluss inzwischen weit in das bekannte Universum hineinreicht. Die Kosmische Hanse, als deren Leiter Perry Rhodan fungiert, besitzt jetzt, im Jahr 424 NGZ, ganze Flotten von Raumschiffen und planetarische und kosmische Stützpunkte in allen Teilen der Galaxis und darüber hinaus. Ein solcher Stützpunkt ist auch das Handelskontor auf dem Planeten Mardi-Gras. Dort kommt es unvermittelt zu alarmierenden Vorgängen, denn EIN COMPUTER SPIELT VERRÜCKT ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nr. 1008
Ein Computer spielt verrückt
Alarm auf Mardi-Gras – Ein Stützpunkt in Gefahr
von ERNST VLCEK
Mehr als 400 Jahre sind seit dem Tage vergangen, da Perry Rhodan mit der BASIS von einem der schicksalsschwersten Unternehmen in den Weiten des Alls in die Heimatgalaxis zurückkehrte und auf der Erde landete.
Durch seine Kontakte mit Beauftragten der Kosmokraten und mit ES, der Superintelligenz, hat der Terraner inzwischen tiefe Einblicke in die kosmische Bestimmung der Menschheit gewonnen und in die Dinge, die auf höherer Ebene, also auf der Ebene der Superintelligenzen, vor sich gehen.
In folgerichtiger Anwendung seiner erworbenen Erkenntnisse gründete Perry Rhodan dann Anfang des Jahres 3588, das gleichzeitig zum Jahr 1 der Neuen Galaktischen Zeitrechnung (NGZ) wurde, die Kosmische Hanse, eine mächtige Organisation, deren Einfluss inzwischen weit in das bekannte Universum hineinreicht.
Die Kosmische Hanse, als deren Leiter Perry Rhodan fungiert, besitzt jetzt, im Jahr 424 NGZ, ganze Flotten von Raumschiffen und planetarische und kosmische Stützpunkte in allen Teilen der Galaxis und darüber hinaus.
Die Hauptpersonen des Romans
Alja Symens – Chefin des Handelskontors von Mardi-Gras.
Kredo Harven – Ein »Buchhalter«.
Jost Governor – Leiter eines Demontagekommandos.
John Nack – Ein Hanse-Manager von Mardi-Gras, der mit einer Eingeborenen Kontakte knüpft.
Mimi – Eine Eingeborene von Mardi-Gras.
Albert
1.
Die Farblosen nannten sie Mimi, und sie wusste nicht, warum, denn in Wirklichkeit war sie Beerblau. Und ihr farbloser Freund, der ihr solch einen komischen Namen gab, hieß Tschonnack, obwohl er am ehesten noch Lausdick war.
Tschonnacks rundes Gesicht war von lauter Läusen gesprenkelt, aber es waren Läuse, die sich nicht bewegten. Er konnte das Gewimmel in seinem Gesicht auch nicht bleichen und nichts damit sagen. Bis auf die bräunlichen Flecken war er blass und also eigentlich auch stumm, wenngleich sein Gesicht manchmal eine rötliche Tönung bekam. Beerblau wusste nie, was ihr farbloser Freund mit dieser leichten Röte sagen wollte, sie konnte nur raten – und tippte stets daneben.
Lausdick, obwohl er körperlich ausgereift und bestimmt von beachtlichem Alter war, kam ihr manchmal wie ein Kind vor, das die ersten Versuche machte, sich anderen mitzuteilen. Auch Kinder wurden zornig, wenn sie sich vergeblich bemühten, sich treffend zu äußern, und sie drückten dann ihren Gefühlsausbruch in einem Lautschwall aus. So war es auch mit Lausdick, und seine Erregung war ansteckend. Sie griff auf die anderen Farblosen über, bis am Ende einer den anderen antönte und sie sich gegenseitig zu übertönen versuchten.
Bei solchen Gelegenheiten zog es Beerblau vor, sich heimlich davonzumachen, das heißt, in der Farbe der Umgebung.
Beerblau ging zum Volk zurück und bekundete allen, die es wissen wollten, dass sie nie mehr zu den Farblosen gehen wolle. Dann blieb sie eine Weile beim Volk, führte ihr gewohntes Leben weiter und floh die Farblosen, die sie verzweifelt suchten.
Aber das ging nie lange gut. Irgendwie war Beerblau von den Farblosen fasziniert, und sie erkannte selbst, dass die Bekanntschaft mit ihnen ihr Leben verändert hatte.
Früher war alles einfacher gewesen.
Beerblau hatte einfach gelebt und Leben in die Welt gesetzt, wie es der Brauch des Volkes war. Sie war glücklich gewesen. Sie aß, was sich ihr in den ihr genehmen Farben anbot, feierte Hochzeit, wenn der Richtige kam ... Oh, sie war sehr wählerisch, und sie ließ sehr viele Freier abblitzen, deren Hochzeitsgesicht nicht genau ihren Bedürfnissen entsprach. Und sie tat gut daran, denn irgendwann fand sich immer einer, der ihre Stimmung traf! ... Beerblau konnte endlos lange unter Büschen und Baumkronen ausharren und deren Schattenspiele mitmachen. Sie saß im ersten Morgenlicht im Kreis ihres Volkes, und sie fand sich im Abendrot in besinnlicher Runde ein, das Gesicht zum Spiegelbild des Farbenspiels vom Werden und Vergehen geöffnet.
Beerblau war jung, sie stand in der Mitte des Lebens, wie man ihr sagte. Aber sie hatte längst nichts mehr von der Unbekümmertheit der Jugend an sich. Sie war reif, auch das gestand man ihr zu.
Man verhehlte ihr jedoch auch nicht, dass sie einen eigenen Zug im Gesicht hatte. Waschwand, der älteste im Volk, der nicht mehr viel mit Farben anfangen konnte und dessen Gesicht trüb wirkte wie verschmutztes Wasser, hatte es so ausgedrückt: »Beerblau, du bekümmerst mich. Du schlägst aus der Art, denn du bist rastlos, voll Neugierde und Unzufriedenheit, voll Abenteuerlust wie die Zugvögel, die es nirgends hält. Das steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich kann darin lesen, und ich lese es dir ab, wie es mit dir weitergehen wird.«
»Ich bin glücklich«, behauptete Beerblau. »Ich bin nicht anders als die anderen, und ich habe nur die Eigenheit, dass ich die Farbe der blauen Beere am besten treffe.«
»Die blaue Beere, die den Zugvögeln am liebsten ist! Du siehst, es hat eine tiefere Bedeutung, dass du schon als Kind das Beerenblau den anderen Farben vorzogst. Alle haben dich bewundert, denn keiner konnte es dir nachmachen, und du wurdest beneidet, weil dein Beerenblau die Zugvögel anlockte und du nur hinzulangen brauchtest, um diese scheuen Tiere zu fangen. Sie wurden zu deiner bevorzugten Nahrung, so dass du immer mehr von ihnen in dich aufnahmst und immer mehr wie sie wurdest. Du hast das Gesicht eines Zugvogels.«
»Pah!«, machte Beerblau. »Du gibst solch geschwollenes Zeug von dir wie Lausdick, weil du deinem Gesicht keinen verständlichen Ausdruck mehr geben kannst. Deine Farben sind fast ebenso blass wie die Lausdicks, sie sagen nichts. Darum trägst du so dick auf, machst ein buntes, grelles Gesicht, das dabei jedoch ausdruckslos bleibt.«
»Du wirst ungerecht, Beerblau – oder soll ich dich so nennen?« Waschwand stieß durch den Mund einen Laut aus: »Mimi!«
Beerblaus Erwiderung erfolgte ebenfalls durch Lautgebung. Sie sagte: »Tschonnack.«
Damit wandte sie sich ab und suchte sich einen Platz, an dem sie mit sich allein war.
Waschwand stand nicht allein mit seiner Meinung da. Auch andere machten ihr Vorwürfe, dass sie mit den Farblosen Verbindung aufgenommen hatte.
»Das ist deine verderbliche Neugierde, Beerblau«, hielten sie ihr vor.
»Es ist meine Neugierde«, pflegte Beerblau zu bestätigen, »doch ist sie nicht verderblich. Die Farblosen sind nicht gefährlich, sie tun uns nichts. Sie haben sogar segensreich für uns gewirkt. Seit sie hier sind, erblüht unsere Welt. Die Pflanzen gedeihen, der Tiere werden mehr. Warum also sollen wir die Farblosen meiden?«
Niemand konnte ihr einen vernünftigen Grund nennen, warum man den Farblosen aus dem Weg gehen sollte. Keiner im Volk brauchte einen Grund dafür, es war eine selbstverständliche Sache. Das Volk war eben scheu.
Als die ersten Farblosen auftauchten und durch das Land des Volkes zogen, da hatten sie lange Zeit keine Ahnung davon gehabt, dass dieses Gebiet bewohnt war. Sie hatten Pflanzenproben genommen und Tiere eingefangen, um diese zu untersuchen – wie Beerblau als Mimi inzwischen von Lausdick erfahren hatte.
Nur durch Zufall war es zum Kontakt gekommen, als ein Farbloser eine Blütenprobe nehmen wollte und verblüfft feststellen musste, dass er statt einer Blüte den Kopf eines Lebewesens in der Hand hielt.
Dadurch war das Volk in Aufruhr geraten. Es floh vor den Farblosen, die ihre Bemühungen nun verstärkten, mit dem Volk in Verbindung zu treten. Schließlich hatten die Farblosen die Zwecklosigkeit ihrer Kontaktversuche eingesehen – und seit damals hatte das Volk seine Ruhe.
Man wusste, dass sich die Farblosen an der Grenze des Landes niederließen und in ihrer Farbenblindheit die Natur zerstörten und große und hässliche Gebilde errichteten, in denen sie lebten.
Manche dieser Gebilde erhoben sich in den Himmel – und verschwanden einfach in der Luft. Manchmal konnte man diese abscheulichen Gebilde aufsteigen sehen, und man hörte weit über das Land, dass sie es mit solchem Lärm und Getöse taten, wie er stets in der Nähe der Farblosen zu vernehmen war.
Aber da die Farblosen von nun an nicht mehr in das Leben des Volkes eingriffen, kümmerte man sich nicht mehr um sie und konnte wieder zu einem geregelten Alltag zurückfinden.
Gelegentlich passierte es zwar immer wieder, dass die Farblosen sich hierher verirrten. Aber man hörte sie stets schon von weitem und konnte ihnen rechtzeitig aus dem Weg gehen.
Der eigentliche Grund, warum keiner aus dem Volk etwas mit ihnen zu tun haben wollte, war der, dass sie so fremdartig waren. Das betraf nicht nur ihre körperliche Erscheinung – sie waren groß, plump und behäbig –, sondern mehr noch ihr Verhalten.
Heimliche Beobachter hatten versucht, das Verhalten der Farblosen zu studieren – wie zuwider ihnen das auch war –, ohne jedoch ihr Wesen erforschen zu können. Sie hatten einfach keine Farben, keine verständliche Ausdrucksmöglichkeit, sondern machten nur Lärm.
Sie brüllten wie Raubtiere, zischten wie Schlangen oder kreischten wie Vögel – aber ihre Gesichter waren bar jeglichen Ausdrucks.
Erst Beerblau fand heraus, dass die Lautgebung ihre einzige natürliche Verständigungsmöglichkeit war. Wie unzulänglich diese war, zeigte sich an dem Beispiel, dass Tschonnack Beerblau Mimi nannte und sich selbst diesen komischen Namen gab, obwohl er doch eindeutig Lausdick war.
Beerblau war dennoch von diesen tollpatschigen, einfältigen, aber auch gutmütigen Riesen fasziniert.
Es war vermutlich doch ihre Neugierde und ihre Abenteuerlust, die sie stets zu den Farblosen zurückkehren ließ.
Und vor sich selbst war sie ehrlich genug zuzugeben, dass sie ihr Leben stark beeinflussten.
*
Beerblau verspürte nun wieder jene Unrast in sich, von der sie wusste, dass sie ihrer Unzufriedenheit entsprang. Sie war schon eine ganze Weile dem Lager von Tschonnack und seinen Farblosen ferngeblieben, und darum war sie unausgefüllt. Nun zog es sie wieder zu den lärmenden Riesen hin.
Eigentlich hatte sie sich vorgenommen, nie wieder dort hinzugehen, denn Lausdick hatte sie enttäuscht – mehr noch, er hatte ihr einen solchen Schrecken eingejagt, dass sie noch lange danach kein vernünftiges Gesicht mehr zusammenbrachte.
Lausdick hatte ihr auf umständliche Weise erklärt, dass er und seine Farblosen sich durch die Lautsprache verständigten. Daraufhin hatte sie sich ehrlich bemüht, seine »Sprache« zu erlernen.
»Dumimi«, hatte Lausdick gesagt und auf sie gedeutet.
Beerblau verneinte und sagte daraufhin: »Mimi.«
Lausdick äußerte sich dazu durch keinen noch so schwachen Farbwechsel, sondern deutete auf sich und tönte: »Ischtschonnackteanne.«
Wieder verneinte Beerblau und stellte richtig: »Tschonnack.«
Alles was recht war, wenn er ihr schon gewisse Lautfolgen vortutete, dann sollte er auch dabei bleiben!
Lausdick nahm ihre Zurechtweisung gelassen hin – Gelassenheit äußerte sich bei ihm, dass sich das Blass um seine Gesichtsläuse nicht rötete.
Er deutete auf ein scheußliches Ding neben sich und trompetete: »Hjüpnotschula!«
»Hjüpnotschula!«, wiederholte Beerblau.
Lausdick wiederholte den Laut, und Beerblau tat es ihm gleich.
Ein anderer Farbloser mischte sich ein und ließ auf Lausdick ein furchterregendes Rattern los. Lausdick ratterte zurück, der andere Farblose gab danach nur einen einzigen Laut von sich und wandte sein Langlos-Gesicht ihr zu. So taufte sie ihn auch – Langlos.
Langlos ging zu dem hässlichen Ding, nahm ein Stück davon ab und krönte damit sein langes, farbloses Gesicht. Was er sich aufsetzte, das sah aus wie der Deckel eines Topfes, der an Schlingpflanzen hing, die wiederum mit dem großen hässlichen Ding verbunden waren.
Langlos nahm den Deckel wieder ab, hielt ihn Beerblau hin und tönte: »Mimidu!«
»Mimi!«, berichtigte Beerblau, aber sie verstand. Sie setzte den Deckel auf. Die Farblosen gerieten nun in Hektik. Beerblau hatte sie noch nie in so schneller Bewegung gesehen. Sie umtanzten das hässliche Ding wie eine erlegte Beute, und dabei bellten sie es an.
»Mimi!«
Es wurde schwarz. Und in die Schwärze drang etwas in ihren Kopf, das folgende Bedeutung hatte: »Mimi. Das ... du. Terraner ... das wir. Volk. Du lernen ...«
Beerblau riss sich daraufhin den Deckel vom Kopf und floh. Sie konnte danach lange ihre Farben nicht zusammenbringen, so stark hatte sich die Schwärze in ihrem Kopf breit gemacht.
Allmählich verblassten die Schrecken, und Beerblau begann den Vorfall von der praktischen Seite zu betrachten. Lausdick und seine Farblosen hatten ihr nichts Böses antun wollen, soviel war klar. Ihre Bemühungen zielten eindeutig darauf ab, sie mittels des hässlichen Dinges ihre Art der Verständigung zu lehren.
Je länger sie darüber nachdachte, desto reizvoller fand sie diesen Gedanken. Und schließlich war Beerblau soweit, dass sie sich auf den Weg zum Lager der Farblosen machte.
*
Beerblau erlebte mit Lausdick immer wieder neue Überraschungen.
Diesmal kam sie nicht einmal sofort dahinter, dass der Farblose ihr diese Überraschung bereitete.
Denn er kam in Gestalt eines aus dem Volk. Natürlich durchschaute Beerblau die Fälschung sofort, denn sein Gesicht war eine schreiend bunte Fratze, deren Farbkombination eine einzige Beleidigung war. Beerblau hatte dafür die entsprechende Antwort – und daraufhin löste sich die Fälschung auf.
An ihrer Stelle tauchte Lausdick auf. Er deutete – und lärmte dabei – auf ein hässliches Ding, das ein anderer Farbloser trug, und Beerblau erkannte, dass damit die Fälschung erzeugt worden war.
Sie fand, dass dies eine rührende Geste war. Jeder andere aus dem Volk hätte das als Beleidigung aufgefasst. Aber sie wusste, dass die Farblosen damit nur ihren guten Willen bekunden wollten.
Beerblau zeigte ihnen, dass sie geschmeichelt war und sich geehrt fühlte und folgte ihnen in ihr Lager. Auf dem Weg dorthin begegneten ihnen noch weitere Farbobjekte, die Beerblau als überaus geschmacklos und sinnverwirrend empfand. Doch sie wusste, was die Farblosen damit bezweckten und machte dazu eine gute Miene.
Woher sollten sie auch wissen, dass Farbe nicht gleich Farbe war!
Sie erreichten das Lager, und Beerblau begab sich sofort zum Hässlichen. Sie betrachtete es lange und eingehend, bis sie keine Angst mehr davor verspürte.
Es war ganz still um sie, als sie sich auf den vorgesehenen Platz setzte. Ein Farbloser begann aufgeregt zu schnattern, aber Lausdick brachte ihn mit einer Bewegung zum Verstummen. Er hatte neben seinen Läusen noch zusätzlich rote Flecken im Gesicht bekommen. Das verriet seine Erregung.
Er tönte: »Mimi!«
»Tschonnack!«, tönte sie zurück und war nicht minder aufgeregt, denn sie konnte es kaum erwarten, den Topfdeckel mit den Schlingpflanzen aufgesetzt zu bekommen.
Waschwand mochte schon recht haben, sie schlug völlig aus der Art. Denn was sie alles mit sich anstellen ließ, das war für einen aus dem Volk nicht schicklich. Aber sie konnte nicht anders, sie brannte darauf, dass man sie lehrte, sich bellend, trompetend und krächzend zu verständigen. Wenn sie das erst einmal geschafft hatte, dann konnte sie die Farblosen vielleicht sogar dazu bringen, sich nach Art und Weise des Volkes mitzuteilen.
Beerblau erschrak, als sich plötzlich Schwärze über sie senkte. Aber sie hielt an sich, lauschte den Geräuschen in ihrem Kopf und harrte geduldig im Dunkeln aus. Das kostete sie große Überwindung, und trotz allen Bemühens spürte sie, wie Panik in ihr aufstieg. Als sie das Dunkel nicht länger mehr zu ertragen können glaubte, da geschah das Wunder.
Sie konnte wieder sehen. Zuerst waren die Bilder ohne Farbe und ohne Tiefe. Dann bekamen die Schatten Farbtupfer und färbten sich allmählich ganz ein. Allerdings erschienen ihr die Farben verfälscht.
»Blau«, sagte eine Stimme, und Beerblau hätte darüber lachen können, denn dieser Klecks war alles andere als blau. Sie drückte instinktiv mit ihrem Gesicht aus, was blau war – und da passierte des Wunders zweiter Teil: Das Bild bekam allmählich die Farbe der blauen Beere.
»Beerblau, meine Farbe!«, dachte sie.
»Du ... sprechen ...«, erklang es in ihrem Kopf. »Du, Mimi, du Beerblau – eine Dirto. Dein Volk: Dirto. Ich: John Nack.«
Sie sah Lausdick vor sich und erkannte, dass sie seinen Namen bis jetzt fälschlicherweise wie Tschonnack ausgesprochen hatte. Er hieß John Nack. Aber Lausdick gefiel ihr besser.
Er verschwand und machte anderen Bildern Platz. Sie bekam das Gebilde im Grenzland des Volkes zu sehen – jene Anhäufung von Hässlichkeiten, in denen die Farblosen lebten und von wo aus sie ihre hässlichen Gebilde in die Luft aufsteigen ließen.
Zu diesen Bildern wurden ihr Laute vermittelt.