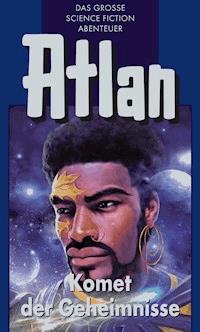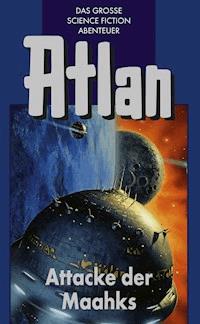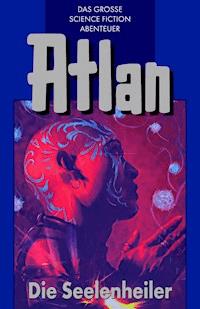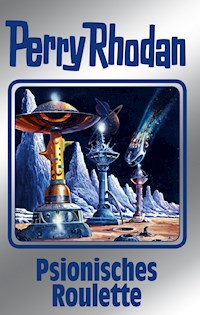
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan-Silberband
- Sprache: Deutsch
Es ist eine neue Erkenntnis für die Menschheit der fernen Zukunft: Die Naturgesetze des Universums werden seit Milliarden von Jahren durch riesenhafte Gebilde gesteuert. Zu ihnen gehören der monströse Frostrubin und das geheimnisvolle Tiefenland. Wenn diese Gebilde außer Kontrolle geraten, können viele Sterneninseln ins Chaus gestürzt werden – mit zahllosen Todesopfern. Um die ungeheure Gefahr abzuwehren, muss sich der Arkonide Atlan einem Psionischen Roulette stellen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nr. 146
Psionisches Roulette
Cover
Klappentext
Kapitel 1-10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kapitel 11-20
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kapitel 21-30
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Kapitel 31-41
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Nachwort
Zeittafel
Impressum
Nicht nur Perry Rhodan muss verblüfft zur Kenntnis nehmen, dass sich sein Bild vom Universum ändert: Die Naturgesetze des Universums werden seit Milliarden von Jahren durch riesenhafte Gebilde gesteuert. Zu ihnen gehören der monströse Frostrubin und das geheimnisvolle Tiefenland.
Geraten diese Gebilde außer Kontrolle, können viele Sterneninseln ins Chaos gestürzt werden – mit zahllosen Todesopfern. Deshalb ist Rhodan darauf bedacht, die Mission der Endlosen Armada nach Jahrmillionen zu einem positiven Ende zu bringen. Er muss die sogenannten Chronofossilien in der Milchstraße aktivieren.
1.
»Ihr kommt hierher, und alles, was ihr mir zu bieten habt, ist die Nachricht eures Versagens?« Lord Mhuthan, Beherrscher des Landes gleichen Namens, starrte die beiden Vermummten zornig an. Sie fühlten sich unbehaglich, das war ihnen anzumerken. »Die Grauen Lords haben ihr Vertrauen in euch gesetzt«, herrschte er die Besucher an. »Trotzdem ist es euch nicht gelungen, Starsen in Grauland zu verwandeln. Andere waren nicht so erfolglos.«
Offener Triumph sprach aus den Worten des Grauen Lords. Seit einem Tiefenjahr war das Land Mhuthan Graugebiet, ein eindrucksvoller Erfolg für ihn.
»Wir sind auf Gegner gestoßen«, versuchte der Älteste eine Rechtfertigung.
»Gegner?«, unterbrach der Lord verächtlich. »Natürlich hattet ihr Gegner zu bekämpfen, das war eure Aufgabe.«
»Es handelt sich um Abgesandte der Kosmokraten ...«, wagte der Fratervorsteher einen erneuten Vorstoß.
»Und das war zu viel für euch? Abgesandte der Kosmokraten sind für uns überwindbar, das beweisen die Beispiele aus früherer Zeit.«
»Diese sind anders. Wir sind sicher, dass es sich bei ihnen um Ritter der Tiefe handelt.«
Lord Mhuthan brauchte eine Weile, bis er das verdaut hatte. Er lachte dröhnend. »Ritter der Tiefe, sagt ihr? Habt ihr mehr Ausreden für eure Unfähigkeit?«
»Es ist, wie wir sagen«, antwortete der Älteste. »Diese Ritter werden unserer Sache weiter schaden. Deshalb schlagen wir vor, die anderen Grauen Lords zu verständigen.«
Mhuthan schwieg. »Das werde ich nicht tun«, sagte er schließlich, etwas ruhiger geworden. »Euer Bericht ist keine ausreichende Begründung für einen solchen Schritt.«
Mit einer herrischen Geste forderte er die Besucher auf, zu gehen.
Unter der Tür hielt der Fratervorsteher kurz inne. »Verzeih!«, sagte er. »Die Ritter der Tiefe werden höchstwahrscheinlich versuchen, Starsen über einen der Tortransmitter zu verlassen. Es wäre ratsam ...«
»Auf eure Ratschläge kann ich verzichten«, unterbrach Lord Mhuthan und wies die beiden Flüchtlinge aus Starsen schroff aus dem Raum.
In Starsen war eine Kraft am Werk, die er ernst nehmen musste. Gänzlich ausschließen konnte Lord Mhuthan nicht, dass es sich bei den Erwähnten tatsächlich um Ritter der Tiefe handelte.
Er befahl einen der Roboter herbei und ließ ihn ein Abbild der Schaltzentrale projizieren, von der aus die Transmitter überwacht wurden. Sorgfältig prüfte er alle Speicherdaten. Es gab keine auffälligen Anzeigen, aber das konnte sich ändern – vor allem, wenn sich wahrhaftig Ritter der Tiefe an den Anlagen zu schaffen machten.
Gewiss, er hatte beeindruckende Erfolge vorzuweisen. Ohne ihn wäre das Land Mhuthan nicht zu Graugebiet geworden. Doch einen oder gar zwei leibhaftige Ritter der Tiefe zu fangen ... der Gedanke war überaus verlockend.
Sicherlich kannten Ritter der Tiefe einige Geheimnisse, die den Grauen Lords bislang verborgen geblieben waren. Schon das würde nahezu jeden Aufwand rechtfertigen – und machte es Mhuthan zugleich unmöglich, die anderen Lords zu verständigen. Er war nicht gewillt, einen Erfolg zu teilen.
Spontan sorgte er dafür, dass die Starsentransmitter von seiner Tiefengondel aus überwacht wurden. Schon beim nächsten Transmitterimpuls würde eine Spezialschaltung die Sendung umleiten. Ein gebührendes Empfangskommando musste rechtzeitig bereitstehen. Keine schlagkräftigen Kampfmaschinen, sondern einfache Roboter, die schnell in ihren Fähigkeiten reduziert werden konnten. Mochten die geheimnisvollen Ritter der Tiefe darauf hereinfallen und glauben, die Grauen Lords hätten technisch wenig aufzubieten.
2.
Der erste Blick genügte. Die Transmitterstation, in der Atlan, Jen Salik und Lethos-Terakdschan materialisiert waren, machte einen düsteren, Unheil verkündenden Eindruck. Grau war die vorherrschende Farbe, wenn die drei Ritter der Tiefe diese triste Schattierung überhaupt als Farbe bezeichnen wollten. Der Boden vibrierte leicht; irgendwo in der Nähe arbeiteten mächtige Maschinen.
»Wo sind wir jetzt?«, fragte Salik.
Atlan zog die Stirn in Falten. »Mein Extrasinn behauptet, dass möglicherweise unser Transmittersprung manipuliert wurde.«
»Dann wird derjenige nicht lange auf sich warten lassen, der das veranlasst hat.« Salik sah sich angespannt um.
Die Station schien verlassen zu sein. Alles wirkte ungewohnt trist und grau. Sogar die TIRUNS der drei hatten einen schmutzig wirkenden Grauton angenommen.
Während sie den Transmitterbereich verließen und tiefer in die Station eindrangen, rekapitulierte der Arkonide die Fähigkeiten der Schutzanzüge. TIRUN, den Begriff hatte Lethos-Terakdschan genannt, bedeutet nichts anderes als Tiefen-SERUN. Die eng anliegenden Anzüge aus weichem, porös wirkendem Stoff passten sich wie ein Chamäleon ihrer Umgebung an. Das aktuelle Grau täuschte möglichen Beobachtern Grauleben vor. Wie galaktische SERUNS regelten auch diese Anzüge den Körperhaushalt ihrer Träger. Sie wandelten alle Ausscheidungen in einem nahezu vollendeten Recyclingsystem um und versorgten die Träger mit sämtlichen notwendigen Aufbaustoffen und Spurenelementen. Eine Nahrungsaufnahme im herkömmlichen Sinn war nicht mehr notwendig. Die technischen Einrichtungen wurden über Gedankenbefehle geschaltet, das galt nicht zuletzt auch für den starken Individualschutzschirm und das umfangreiche Waffenarsenal.
»Achtung!«, rief Jen Salik.
Aus dem Augenwinkel nahm Atlan wahr, dass Lethos-Terakdschan unsichtbar wurde – ein Leichtes, da es sich bei der hochgewachsenen Gestalt ohnehin nur um eine Materieprojektion handelte.
Der Grund für Lethos' Verschwinden? Ein klobiger Roboter ratterte auf Laufketten heran. Das kastenförmige Gebilde wirkte schrottreif.
Atlan handelte instinktiv, er stieß Salik zur Seite und warf sich selbst in die andere Richtung. Der Strahlschuss des Roboters blitzte zwischen ihnen hindurch und hinterließ an der mattgrauen Wand einen hellrot brodelnden Fleck. Der Arkonide hatte schon seinen Schutzschirm aufgebaut und aus der rechten Handgelenkspasse eine Waffe ausgefahren.
Atlans erster Schuss traf den Waffenarm des klapprigen Roboters, der zweite den kantigen Leib. Die nachfolgende Explosion zerstörte den Roboter.
»Was sollte das?«, fragte Salik.
»Unser Empfangskommando«, antwortete Atlan. »Sehr freundlich, stelle ich fest.«
»Du meinst, die Attacke war eine Farce?«
»Jemand will mehr über uns in Erfahrung bringen – oder uns in Sicherheit wiegen.«
»Versucht, die Station zu verlassen«, schlug Lethos-Terakdschan vor.
Jeder TIRUN war in der Lage, die Gefühlsschwingungen anderer TIRUN-Träger aufzufangen. Auf ähnliche Weise war es möglich, dass Atlan und Jen Salik die telepathischen Botschaften Lethos-Terakdschans verstehen konnten.
Sie stießen auf weitere Roboter, wenn auch nur auf eine lächerliche Ansammlung kaum funktionsfähiger Maschinen. Aber diese Roboter eröffneten sofort das Feuer.
Die beiden Ritter der Tiefe reagierten mit absoluter Präzision. Die Schüsse der Angreifer wurden von den Schutzschirmen der TIRUNS absorbiert. Die Roboter hielten jedoch der Gegenwehr nicht stand, sie stürzten entweder erstarrt zu Boden oder explodierten. Atlan und Salik nutzten die Gelegenheit, sich zurückzuziehen.
Nicht weit von ihnen entfernt öffnete sich wie von Geisterhand bewegt ein Türschott. Offenbar hatte Lethos-Terakdschan einen geeigneten Weg gefunden.
»Ihm nach!«, rief Atlan.
Bereits eine Viertelstunde später war klar, dass die Transmitterstation deutlich größer sein musste als zunächst angenommen. Sie erstreckte sich zudem über mindestens ein Dutzend Etagen.
Mit der Waffe in der Hand deutete Atlan auf eine leicht konkav gewölbte Wand. »Sieht aus, als hätten wir die Peripherie erreicht«, meinte er.
»Das hilft uns enorm.« Jen Saliks sarkastisches Lächeln verriet zugleich, dass sein Spott nicht boshaft gemeint war.
Sie liefen weiter und stießen auf den nächsten schrottreifen Roboter. Er schoss sofort. Atlan erwiderte das Feuer. Obwohl der Roboter einen schwachen Schutzschirm aufbaute, hielt er der auftreffenden Energie nicht stand. Ein Feuerball flammte auf, begleitet von einer schwachen Druckwelle, die Fragmente des auseinanderbrechenden Roboters meterweit verstreute.
In der nahen Wand entstand eine Öffnung. Auf der anderen Seite schien sich nur ein neuer Abschnitt der Station zu erstrecken: Grau in allen Schattierungen.
Erst aus unmittelbarer Nähe erkannten die beiden Männer, dass sie an der Außenwand der Station standen. Vor ihnen erstreckte sich eine kontrastarme Landschaft wie ein sturmumtostes Hochmoor.
»Knapp hundert Meter«, schätzte Atlan, als er an der stumpfgrauen Metallwand hinab in die Tiefe sah. Ein Blick nach oben enthüllte, dass die Station um die zweihundertfünfzig Meter hoch sein mochte.
»Worauf warten wir?«, fragte Salik.
Atlan antwortete mit einem knappen Lachen.
Sie verließen die Station und schwebten über ein unheimlich anmutendes Land hinweg. Hinter ihnen wurde die Konstruktion der Transmitterstation deutlicher.
Der untere Bereich, in dem Atlan, Salik und der Hathor Lethos-Terakdschan materialisiert waren, erschien wie eine tortenförmige Plattform, einen viertel Kilometer hoch und knapp zweitausend Meter durchmessend. Darauf erhob sich ein kegelförmiger Turm. Am Fuß eineinhalb Kilometer dick, verjüngte er sich bis auf rund zweihundert Meter. In einer Höhe von knapp eineinhalb Kilometern wölbte sich der Turm zu einem schüsselförmigen Aufsatz, dessen Grenze nahe der Tiefenkonstante lag. Atlan erkannte an der Schüssel facettenähnliche Gebilde, deren Sinn und Zweck ihm unklar blieben.
Trostlos, freudlos, leblos – das war der spontane Eindruck, den die beiden Männer von der Station und ihrer Umgebung hatten.
»Vorsicht«, sagte eine ruhige Stimme. Neben Salik und Atlan wurde Lethos-Terakdschan wieder sichtbar. »Spürt ihr es?«
Jen Salik nickte zögernd.
»Es ist nicht die Landschaft allein«, bemerkte der Hathor. »Hier ist eine Kraft wirksam, die unmittelbar auf die Psyche wirkt.«
»Der Tiefeneinfluss«, murmelte Atlan. Er spürte es einigermaßen deutlich. Da war eine Ausstrahlung, die seine Empfindungen unaufhaltsam zu verschieben schien: weg von allem Lebendigen, Vitalen, hin zum Grau.
»Die TIRUNS halten den Einfluss weitgehend ab«, erklärte Lethos. »Außerdem seid ihr als Ritter der Tiefe ohnehin sicher vor dem Tiefeneinfluss. Es sei denn, diese Kraft wirkt konzentriert und zielgerichtet, dann werdet auch ihr Schwierigkeiten bekommen.«
»Langsam verstehe ich in ganzer Tragweite, welchem Schicksal Starsen entgangen ist«, sagte Jen Salik.
Während sie redeten, hatten sie sich weiter von der Transmitterstation entfernt. Der Boden war von düsteren grauen Pflanzen bewachsen.
»Warum, um alles in der Welt, wollten die Grauen Lords Starsen in diesen grässlichen Zustand versetzen?«, fragte Salik. Im nächsten Moment schien er keine Antwort mehr zu erwarten. Angespannt blickte er den Wesen entgegen, die zögernd näher kam.
Die Fremden, vermutlich Bewohner des Landes, waren aufgerichtet über zwei Meter groß und wirkten kräftig. Sie liefen auf zwei Beinen und hatten zwei Armpaare mit augenscheinlich gut ausgebildeten Greifwerkzeugen. Unten am Körper baumelte zudem ein viertes, verkümmert erscheinendes Gliedmaßenpaar. Die Hände dieser Wesen ließen jeweils zwei Finger und einen Daumen erkennen, an den Füßen wuchsen zwei Zehen, zudem eine kräftige Fersenkralle.
In respektvollem Abstand blieben die Bewohner des Graulands stehen. Sie lehnten sich ein wenig zurück und stützten sich dabei mit den verkümmerten Gliedmaßen ab. Ihre Gesichter erinnerten an Boxerhunde oder Bulldoggen – vor allem die Nasen und die dunklen Schlappohren, aber auch der mürrische Gesichtsausdruck passten dazu. Über den Augen saßen borstig aufgewölbte Brauen, ansonsten waren die Gesichter haarlos.
»Wir sind Abaker, und wir leben hier«, sagte einer. »Wer oder was seid ihr? Grauleben?«
»Das kann man unschwer erkennen«, gab Atlan zurück. Er wies auf seinen Anzug.
Sichtlich beeindruckt musterten die Abaker die grauen Monturen. »Dann ist es gut.« Der Anführer kratzte sich hinter dem linken Ohr. »Wir dachten schon, ihr wolltet Ärger machen.«
»Keineswegs«, beteuerte Salik.
Die Gesichter der Abaker spiegelten die Gefühle, die der Tiefeneinfluss ihnen aufzwang: Verdruss, Reizbarkeit und Schwermut. In den dunklen Augen war bei genauem Hinsehen allerdings tief versteckter Schmerz zu erkennen.
»Wenn ihr Grauleben seid, gehört ihr zu uns«, meinte der Abaker. »Wir sind ebenfalls Grauleben. Seit einem Jahr. Früher waren wir anders ...«
Vorübergehend änderte sich der Gesichtsausdruck des Sprechers, gleichzeitig spürte Atlan Wut in sich aufsteigen. Wut über den gewaltsamen Eingriff in die Gemüter der Abaker, deren ursprüngliches Wesen ganz anders gewesen war.
»Früher kannten wir den Sinn des Lebens noch nicht. Erst jetzt hat alles seine richtige Ordnung.«
Was Atlan für Sekundenbruchteile über den TIRUN gespürt hatte, war der Eindruck eines gut gelaunten Lebenskünstlers gewesen, der Besseres zu tun hatte, als sich das Leben mit Arbeit und Pflichterfüllung zu vermiesen. Völlig gewandelt hatte sich der Charakter der Abaker wohl noch nicht – zwar wirkten sie reichlich verdrießlich, trotzdem zeigten sie keine Aggressivität.
»Wir sind auf der Suche nach zwei Fremden, die sich hier eingeschlichen haben«, verkündete der Abaker unerwartet. »Sie sind kein Grauleben, wurde uns gesagt.«
»Ihr werdet sie bestimmt finden«, entgegnete Jen Salik.
»Hoffentlich«, schnaufte der Abaker. »Kommt, Leute, weiter!«
Seufzend, wie unter dem Druck einer schweren Last, machten sich die Abaker auf den Weg.
»Entsetzlich«, murmelte Salik, der ihnen betroffen hinterherblickte. Er war merklich blass geworden. »Mir wird übel«, seufzte er. »Als hätte ich etwas Verdorbenes gegessen.«
»Ausgeschlossen«, mischte sich Lethos-Terakdschan ein. »Mit den TIRUNS kann so etwas nicht passieren.«
»Trotzdem ist mir schlecht!«, beharrte Salik.
Atlan räusperte sich. »Wenn ich tief in mich hineinhorche ...«
»Ich spüre nichts«, unterbrach ihn Lethos. »Aber vielleicht macht sich bei euch doch der Tiefeneinfluss bemerkbar?«
Atlan schüttelte den Kopf. Es war eine zögernde, unsichere Bewegung, als lausche er in dem Moment tief in sich hinein.
»Ich fühle mich krank, fast wie bei einer Grippe«, murmelte Salik.
»Grippe?«, fragte Lethos-Terakdschan.
»Eine Infektionskrankheit, eher lästig als bedrohlich«, bemerkte Atlan. »Der Auslöser sind Viren, die jedoch nur ungeschützte Organismen beeinträchtigen.«
Er sah Jen Salik an. Der schmächtige Terraner kaute auf seiner Unterlippe. Ihre Gedanken kreisten vermutlich um das gleiche Problem ... Die Zellaktivatoren, die sie trugen, machten ihre Träger nicht nur biologisch unsterblich, sie verliehen ihnen eine fast vollkommene Immunität gegen Viren, Bakterien und Gifte.
»Wo, und vor allem, mit was, haben wir uns angesteckt?«, fragte Salik.
»Bei den Abakern?«, rätselte Atlan.
Sein Extrasinn analysierte das Problem. Einmal mehr empfand der Arkonide das Wirken des Logiksektors überaus angenehm und nützlich.
Sporen, erkannte der Extrasinn, und Atlan sprach die Feststellung aus, damit die Freunde es hören konnten. Und er fügte hinzu: »Wir stehen in einem Sporennebel, den die TIRUNS nicht wahrnehmen.«
»Es war ein Fehler, mit offenem Helm herumzulaufen«, erkannte Salik. »Inzwischen ist es wohl egal.«
»Die Keime sind in unglaublicher Menge in uns eingedrungen«, redete Atlan weiter. Zugleich suchte er nach einem festen Halt, damit er nicht einknickte. »Die Immunabwehr ist damit überfordert, und das gilt sogar für den Zellaktivator. Trotzdem behauptet mein Extrasinn, dass keine akute Gefahr für uns bestehe.«
Salik erging es nicht anders. Er wollte etwas erwidern, doch wurde nur ein heiseres Ächzen daraus. Er taumelte und wäre wohl gestürzt, hätte Lethos-Terakdschan nicht eingegriffen.
»Nicht die Geduld verlieren!«, mahnte der Hathor. »Es ist eine reine Zeitfrage.«
Atlan hatte den Eindruck, innerlich zu glühen. Der Arkonide spürte jeden Herzschlag mit schmerzhafter Wucht und in seinen Adern glaubte er das Blut heiß pulsieren zu spüren. Im nächsten Moment schien sich Eiseskälte in ihm auszubreiten.
Immer schneller vollzog sich dieser Wechsel, erst nach endlos lang anmutenden Minuten flaute alles ab. Das normale Körpergefühl stellte sich wieder ein.
3.
»Lass das, Bonsin!«
»Warum denn, Vater, es macht so viel Spaß.«
Mit unbewegter Miene sah Frobo zu, wie der Junge seine Zeichnung vervollständigte. Es war unverkennbar das Gesicht des alten Wolbert, der als einer der weisesten Abaker im Unterland galt. Der Ausdruck, den Bonsin ihm verpassen wollte, war jedoch eine verzerrte Karikatur. Frobo seufzte. Früher hatte er selbst solche Zeichnungen in die Wände des Unterlands geritzt, nur lag das lange zurück.
Trotz des unüberhörbaren Seufzers arbeitete Bonsin eifrig weiter. Es schien ihm Spaß zu machen, und das stimmte Frobo verdrießlich.
»Hör auf!«, rief Frobo verärgert und nahm Bonsin den Ritzkeil aus den Händen. »Such dir Sinnvolleres«, schlug er vor und wandte sich zum Gehen. Nach wenigen Schritten blickte er jedoch zurück. Bonsin hatte sich einem Lehmklumpen zugewandt und angefangen, eine Figur zu formen.
Borla, seit Jahrzehnten Frobos Weib, sah kaum auf, als er die Wohnhöhle betrat. Wieder seufzte Frobo, bevor er sich auf die Sitzbank fallen ließ und die Beine ausstreckte. »Mit dem Jungen geht es so nicht weiter«, sagte er.
»Richtig«, herrschte Borla ihn an. »So geht es nicht. Früher, weißt du, früher ...«
Frobo winkte ab. Früher war überhaupt alles anders gewesen ... In den Wohnhöhlen hatte es Helligkeit und Wärme gegeben, nun war das Feuer erloschen. Vor wenigen Jahren war das Leben noch Freude gewesen – mittlerweile war es Last und Bedrückung.
»Hast du Glaymwurzeln bekommen?«, fragte Borla.
»Keinen Keim.« Frobo schüttelte den Kopf. »Die Märkte sind leer, und wenn es Ware gibt, taugt sie nicht viel.«
»Wie soll ich eine vernünftige Mahlzeit zusammenbringen?«
Auch Borla wurde nicht mehr froh, und das bedrückte Frobo besonders. Er hatte sie als lebensprühende Jung-Abakerin zur Frau genommen, als Gefährtin für alle Tage des Glücks und des Frohsinns, heute musste sie mit ihm Elend und Trübsinn teilen.
»Bonsin, komm zum Essen!«, rief Borla.
»Keine Lust«, gab der Junge von draußen zurück.
Frobo erhob sich schwerfällig und ging zum Eingang. »Was soll das heißen?«, bellte er. »Warum hast du keine Lust?«
Bonsin kam zögernd näher. Er war mit Gesteinsstaub bepudert. »Einfach so«, antwortete er lachend. »Oder kannst du deine Lust begründen?«
Was da aus Bonsin sprach, war keine Frechheit, das wusste Frobo. Der Junge hatte nur die Frage gestellt, die ihn gerade interessierte. Frobo war ratlos. Zu allen Widerwärtigkeiten des Lebens hatte er das Problem eines verhaltensgestörten erst dreißigjährigen Kindes.
»Setz dich zum Essen!«, herrschte er den Jungen an.
»Erst waschen«, meinte Bonsin.
»So kann es nicht weitergehen.« Frobo blickte seine Frau wütend an, zumal aus dem Hintergrund Bonsins Singen und Pfeifen erklang. Der Junge pfiff und trällerte selbst dann vergnügt, wenn ihm der Pelz gewaschen wurde. »Was machen wir, falls es unheilbar ist?«
Borla war ratlos. Sie sah aus, als wolle sie genau diese Frage weit von sich schieben.
Bonsin kam. Er lachte vergnügt, als er den Topf mit dem dampfenden Inhalt sah. »Riecht toll!«
Während Frobo missmutig an dem Brei löffelte, den es zum vierten Mal in Folge gab, formte Bonsin mit dem Löffel Breiberge und Täler und staute die Sauce als kleinen See auf. Schließlich mischte er alles durcheinander und löffelte mit hörbarem Behagen.
»Noch heute werde ich das ändern«, verkündete Frobo nach dem Essen. Bonsin hatte die Wohnhöhle schon wieder verlassen, von draußen drang sein Kichern herein. »Ich nehme Kontakt zu den Meistern auf. Vielleicht sogar zu Dovhan selbst.«
Borla sah ruckartig auf. Ihre Miene verriet Verlegenheit. »Muss das sein?«, fragte sie zögernd.
Frobo nickte. Er wusste, woran sein Weib dachte. Die Sache lag schon lange zurück, aber sie war nicht vergessen. »Irgendwie ist Meister Dovhan ja daran beteiligt«, sagte er schroff. »Wenn wir mit Bonsin nicht klarkommen, muss er uns helfen, so wie er uns damals geholfen hat.«
»Er könnte das als Undankbarkeit auffassen«, wandte Borla ein. »Erst machst du den Fehler mit dieser Arznei und musst zu Meister Dovhan gehen. Nun willst du dich beschweren, dass wir trotz deines Fehlers damals ein Kind bekommen haben, nur weil es nicht so ist wie die anderen?«
»Nicht so hastig! Ich will mich nicht beschweren, sondern Dovhan um Hilfe bitten. Vielleicht hat er etwas, mit dem er Bonsin verändern kann.«
»Mag sein«, stimmte Borla zu. Sie erlaubte sich ein Glas Absud, während Frobo den Tisch frei machte. »Aber du solltest nicht allein zu Meister Dovhan gehen. Nimm jemanden mit.«
»Und wen?«
»Den alten Wolbert. Er hat schon des Öfteren mit den Meistern verhandelt, außerdem ist er ruhig und besonnen, kein solcher Hitzkopf wie du. Und Bonsin vertraut ihm.«
Als Frobo wenig später die Wohnhöhle des alten Wolbert betrat, platzte er mitten in eine Art Vollversammlung hinein. Nahezu alle wichtigen Abaker waren da.
»Du kommst wie gerufen«, sagte Wolbert, der es sich auf einem zerschlissenen Fell bequem gemacht hatte. »Ich wollte dich holen lassen. Wir sind der Meinung, dass etwas geschehen muss, und zwar bald.«
»Völlig richtig«, erklang es von den Versammelten. »So geht es nicht weiter.« Frobo, der das selbst oft genug sagte, fand die Phrase diesmal reichlich abgedroschen und inhaltsleer.
»Dass die Zeiten härter geworden sind, weiß jeder.« Wolbert hatte zwei Arme vor dem Oberkörper verschränkt, mit den anderen gestikulierte er. »Wir haben uns geändert und uns den veränderten Zuständen angepasst. Trotzdem wird das Leben hier unten langsam unerträglich.«
»Was willst du dagegen tun?«, wollte Frobo wissen.
Wolbert setzte eine gewichtige Miene auf. »Wir ziehen hinauf zu den Meistern.«
»Wir?« Frobo sah sich in der Runde um. Mindestens zwanzig Abaker waren da.
»Jawohl, alle, die hier leben. Männer, Frauen und Kinder. Wir ziehen zu den Meistern und bitten sie, dass sie uns helfen.«
»Es wären an die fünfhundert Personen, in der Mehrzahl Kinder!«, rief Frobo. »Der Weg ist weit und beschwerlich. Wie sollen wir das schaffen?«
Wolbert verzog die Mundwinkel. »Schade, dass ausgerechnet du das vorbringst. Ich wollte dich als Führer vorschlagen. Du kennst den Weg zu Meister Dovhan am besten von uns allen.«
»Mag sein«, antwortete Frobo verwirrt.
»Ja oder nein?«, drängte Wolbert. »Wir brauchen deine Entscheidung. Sofort.«
Frobo wollte sich nicht drängen lassen. Er sah jedoch ein, dass er dem Wunsch der anderen entweder zustimmen oder die weite Reise zu den Meistern mit Bonsin allein antreten musste.
»Einverstanden«, sagte er nach einigem Zögern.
Frobo war verwirrt, als er später die Versammlung verließ. Was war mit den Abakern geschehen? Was hatte alle so sehr verändert? Er fand keine Erklärung. Sie alle waren lebenslustig gewesen und hatten es stets fertiggebracht, ihrem Dasein die besten Seiten abzugewinnen. Ein trübsinniger, geschweige denn schwermütiger Abaker war die absolute Ausnahme gewesen, geradezu ein Kuriosum – mittlerweile war es umgekehrt.
Während des Rückwegs huschten einige Twiller vor ihm über den Weg. Die possierlichen Nagetiere hatten früher jeden mit ihrem munteren Gebalge in Entzücken versetzt. Auch das war vergangen, trotz der Tatsache, dass die Twiller ein Geschenk Dovhans waren. Dovhan ebenso wie die anderen Meister meinten es immer gut mit den Abakern, Frobo wusste das aus eigener Erfahrung. Doch was bedeutete es, dass in jüngster Zeit ein gewisser Korlan, der mehrere Wegstunden entfernt mit seiner Sippe hauste, zu einer Versammlung mit einem scheußlich anzusehenden Geschöpf erschienen war? Und vor allem, dass er dieses Wesen als seinen Kampfgefährten vorgestellt hatte? Seit wann kämpften Abaker, seit wann bekamen sie von den Meistern solche Monstren geschenkt? Frobo wollte das herausfinden. Wollte? Er musste, konnte gar nicht anders.
»Was hast du erreicht?«, fragte Borla, als er die gemeinsame Höhle wieder betrat.
»Alle werden gehen«, antwortete Frobo. »Das ist ein Beschluss der Versammlung.«
»Alle zu Meister Dovhan?«, fragte Borla entgeistert.
»Die ganze Sippe. Auch die Kinder. Pack die Sachen zusammen, wir brechen sehr bald auf.«
»Was sollen wir alle bei den Meistern?«, entfuhr es Borla. »Genügt es nicht, wenn zwei oder drei sich auf den Weg machen?«
»Die Versammlung hat es beschlossen«, gab Frobo zornig zurück. Borlas Nähe verschlechterte seine Laune zunehmend. Sie war zänkisch geworden und nörgelte nur an ihm herum. Seine Gefährtin von einst war ein übellauniges Weib geworden, und Frobo war gerade noch einsichtig genug, an sich selbst Züge zu entdecken, die ihm früher ebenfalls fremd gewesen waren.
Die einzige Person, die sich jeder schlechten Laune entzog, war Bonsin. Er war in eine der Nebenhöhlen gegangen und spielte dort.
Frobo ging zu ihm. »Schluss mit dem Unsinn!«, bestimmte er. »Pack deine Sachen zusammen, wir gehen auf eine lange Reise.«
»Ich habe es schon von den anderen Jungs gehört«, sagte Bonsin. »Wir alle gehen zu den Meistern?«
Frobo nickte. Die Meister hatten immer alles in Ordnung gebracht, was im Leben der Abaker schiefgelaufen war. Warum nicht auch diesmal?
Langsam bewegte sich der Tross durch die Gänge und Höhlensysteme. Es gehörten Erfahrung und Sachverstand dazu, sich im Unterland zurechtzufinden. Frobo war einer der wenigen mit dieser Erfahrung. Er hatte mehrmals den Weg zu Meister Dovhan gefunden, und vor allem der letzte Besuch, dessen Resultat Bonsin war, haftete ihm deutlich im Gedächtnis.
»Werden wir lange brauchen?«, erkundigte sich Bonsin.
»Einige Schlafenszeiten«, antwortete Frobo. »Mach dir keine Sorgen, es ist nicht gefährlich.«
Bonsin sah seinen Vater verwundert an. »Ich habe keine Angst«, behauptete er ernsthaft.
»Gut so.« Frobo wusste nicht recht, was er mit dem neugierigen Sohn anfangen sollte. Die Themen, die ihm selbst hinter den Ohren brannten, waren die geistige Verfassung der Abaker und Bonsins Absonderlichkeiten. Für beides war der Junge nicht der rechte Gesprächspartner. Zudem bekam Frobo bald genug zu tun. In der Marschkolonne der Fünfhundert kam Streit auf.
»Nimm ihn weg!«, keifte ein älterer Mann. »Er ist schmutzig und unappetitlich. Eine Frechheit, dieses Viehzeug überhaupt mitzunehmen.«
Der Junge, dem die Tirade galt, hatte seinen Twiller auf die Arme genommen und hielt ihn an sich gepresst. Angst über die bösartige Verbitterung des alten Mannes war in den Zügen des Kindes zu erkennen.
»Beruhige dich, Fanner«, schritt Frobo ein.
»Warum?«, ereiferte sich der Alte. »Warum soll ich mich beruhigen? War es meine Idee, mit der ganzen Sippschaft herumzuziehen? Habe ich diesem Lümmel erlaubt, sein verdrecktes Vieh mitzunehmen? Wahrscheinlich hat der Twiller jede Menge Krankheitserreger im Fell, und das Ende dieser Reise wird nur ein Bruchteil von uns erleben. Ich sage es, laut und deutlich, damit jeder es hören kann: Dies wird für uns Abaker ein Todesmarsch! So ist es und nicht anders.«
»Halt den Mund!«, fuhr Frobo auf. »Was verstehst du davon? Du kannst nur stänkern und jedem das Leben vergällen. Am liebsten würde ich dich hier zurücklassen.«
»Würde er das, der vornehme Herr? Sind wir schon so weit, dass du Befehle über Leben und Tod geben kannst?«
»Davon ist nicht die Rede.« Frobo wurde immer unbehaglicher; schnell hatte sich eine größere Menge um ihn und den Alten geschart. Die meisten Abaker nahmen den Streit zum Glück nicht allzu ernst.
»Hör mal, du Zausel, schnauze meinen Vater nicht an, sonst bekommst du es mit mir zu tun!«
Ausgerechnet im ungünstigsten Moment mischte sich Bonsin ein. Mit in die Hüften gestemmten Fäusten baute er sich vor Fanner auf.
Dem Alten verschlug es fast die Sprache. »Du willst mir drohen?«, fragte er lauernd.
»Ich lasse nicht zu, dass du meinen Vater beleidigst. Und wenn du es trotzdem tust, dann ...«
»Wie willst du mich daran hindern? Mich erschlagen?«
Frobo lachte. Offenbar war Fanner noch so weit bei Sinnen, dass er der Situation eine heitere Note abgewinnen konnte. Die Vorstellung, dass ein Abaker auf einen anderen Abaker mit einer Waffe losging, war absurd.
»Viel schlimmer«, antwortete Bonsin. »Ich werde dir Knoten in die Ohren machen, sobald du schläfst, und ich kann Knoten machen, die außer mir niemand aufbekommt. Außerdem kann ich deinen Bauch rot anpinseln.«
In lautem Gelächter löste sich die Anspannung, selbst Fanner konnte sich ein meckerndes Kichern nicht verkneifen.
Frobo nutzte die Gunst des Augenblicks. »Wir rasten hier!«, bestimmte er. »Die Pause haben wir uns verdient.«
Ein Teil der Abaker war sichtlich erschöpft. Der Weg war konstant angestiegen, und vor allem die Älteren hatten nicht die Kraft, das allzu lange durchzuhalten. Sogar Borla warf Frobo einen dankbaren Blick zu.
Der Rastplatz war nicht schlecht gewählt: eine geräumige Höhle, in der sogar ein schwaches Nachglühen des kalten Feuers existierte, das früher diese Räume erhellt hatte. So konnten die Abaker wenigstens leidlich gut sehen, als sie die Vorräte auspackten.
»Die Stimmung ist schlecht«, kommentierte Borla kauend. Sie gab eine behutsam gedämpfte Loper-Lende an Frobo weiter. Er nickte und schlug hastig die Zähne ins Fleisch. Es war fad im Geschmack, aber dennoch besser als der Standardbrei, an den er sich hatte gewöhnen müssen.
»Die Leute sind missmutig, und es wird immer schlimmer, weil sie sich gegenseitig damit anstecken«, sagte Borla.
Frobo schwieg. Der anstrengende Marsch hatte die Abaker ermüdet, ihn selbst ebenfalls. Wenigstens fürs Erste satt, lehnte er sich gegen den Fels und sah hinüber zu den Gefährten. Ein Teil schlief, andere hatten die Köpfe zusammengesteckt und flüsterten miteinander. Frobo schauderte. Es war kein Vergleich zu früher. Lachen hätte durch die Höhle schallen müssen, dazu laute Gesänge; etliche hätten getanzt oder akrobatische Kunststücke zur Erheiterung aller vorgeführt – so wie es Bonsin tat, der kleine Steine aufgesammelt hatte und sie immer schneller von einer Hand in die andere wandern ließ. Sein Gesicht zeigte Konzentration, aber kein Anzeichen von Missbehagen.
Nach zwei Stunden setzten die Abaker den Marsch fort.
Sie trafen auf eine andere Sippe, doch es hagelte keine Einladungen. Niemand schien gewillt zu sein, aus der Begegnung ein Fest zu machen, wie es seit ewiger Zeit Brauch war. Im Gegenteil, die anderen Abaker starrten Frobos Haufen nach, als hätten die Weiterziehenden das durchwanderte Gebiet ekelhaft verunreinigt.
Verärgert ließ Frobo weitermarschieren, bis die ersten seiner Leute laut über Gliederschmerzen klagten. Erst da gab er die Erlaubnis für ein Schlaflager.
»Bonsin, komm her!«, rief Borla. »Wenn du willst, kannst du in der Nähe nach Wasser suchen.«
»Klar will ich«, jubelte der Junge und machte sich davon. Borla sah ihm kopfschüttelnd nach. Wenn er so gehorsam und aufmerksam war, warum ärgerte er die ganze Sippe mit seinem Übermut? Selbst jetzt pfiff Bonsin ein Lied, dessen spöttischer Text überhaupt nicht der Lage angemessen war.
»Meister Dovhan wird die Sache schon hinbekommen«, versprach Frobo, dem Borlas Blick nicht entgangen war. Ächzend streckte er sich aus.
Es war ein ungemütlicher Ort. Nur ein paar trübe Fackeln erhellten die große Höhle, deren Boden bedeckt war mit ausgedörrtem Ackerland. Früher musste hier viel gewachsen sein, die gerade noch erkennbaren Furchen zeigten, dass nahezu die gesamte Fläche bestellt worden war. Mittlerweile war das wuchernde Gestrüpp hartfaserig und ungenießbar, es taugte nicht einmal als Schlafunterlage.
Bonsin kam mit einem Beutel voll Wasser zurück. »In der Nähe gibt es eine Quelle«, lachte er. »Kann ich nach dem Essen dort baden?«
Frobo stimmte zu. Er half Borla dabei, aus den Vorräten eine Mahlzeit zu mischen. Ab und zu hob er den Kopf und blickte in die Runde. Die herrschende Lethargie verhieß für die nächsten Tage nichts Gutes.
Als er erwachte, war es dunkel. Die Fackeln und das Lagerfeuer waren heruntergebrannt. Erst nach einiger Zeit nahm Frobo das dunkle Rot der letzten Glutreste wahr. Und er sah eine Gruppe Schleimspeier, die sich dem Lager genähert hatte. Obwohl die handspannenlangen Reptilien in Schwärmen auftraten, waren sie harmlos und nur für Kleingetier gefährlich. Infolgedessen waren ihre unregelmäßigen Besuche bei den Abakern gern gesehen, denn sie schafften ihnen alles Ungeziefer vom Hals, das die Nahrungsvorräte bedrohte.
Diese Gruppe war besonders groß. Es mussten einige Tausend sein, die langsam und fast geräuschlos auf ihren dürren Beinen herankamen. Im vagen Schimmer des fast erloschenen Lagerfeuers sah Frobo die typischen Lichtreflexe auf der faltigen Schuppenhaut der Schleimspeier.
Er stieß Borla an. »Wach auf, Besuch!«, sagte er halblaut. Borla wandte den Kopf, sah die Schleimspeier, und zum ersten Mal seit Langem sah Frobo wieder ihr vertrautes Lächeln.
»Wundervoll«, flüsterte sie. »Wir sollten die anderen wecken.«
Frobo nickte. Das Angenehmste an den Schleimspeiern war, dass man sie melken konnte. Hinter zwei kräftigen Beinzangen, die sogar eine Abakerhaut schmerzhaft zu zwicken vermochten, saß bei den Reptilien eine Schleimdrüse. Drückte man den Leib eines Schleimspeiers dicht hinter den Kiefern zusammen, sonderte er seinen leicht bläulich schimmernden Schleim ab. Tiere, die etwas davon abbekamen, gerieten unglaublich schnell in einen rauschartigen Zustand, der sie taumeln oder sogar zusammenbrechen ließ – für die Schleimspeier war es danach leicht, diese Beute zu reißen. Auf Abaker wirkte das Sekret ebenfalls berauschend, wenn auch erheblich schwächer. Frobo erinnerte sich an ein Fest, zu dem unverhofft eine Gruppe Schleimspeier erschienen war. Es war die turbulenteste Nacht geworden, die es jemals gegeben hatte. Im Archiv der Sippe waren die damals entstandenen Lieder und Gedichte verzeichnet, das Beste, was Abaker je produziert hatten.
»Genau das Richtige, um die Stimmung zu heben«, sagte Borla.
Frobo richtete sich langsam auf. Er hörte einen gellenden Schrei. Die ersten Schleimspeier hatten einen am Rand der Gruppe schlafenden Abaker erreicht und ihn heftig gebissen.
»Was soll das?«, schrie der aus dem Schlaf Geschreckte. Frobo erkannte den jungen Grassa, einen der Kräftigsten in der Gruppe. Grassas Gesicht war wutverzerrt.
Frobo riss die Augen weit auf. Ein Schleimspeier hatte sich an Grassas linkem Bein festgebissen, zwei weitere hatten ihre Drüsengeschosse auf den Schläfer abgefeuert. Dass ein Schleimspeier ein so viel größeres Lebewesen angriff, war mehr als erstaunlich. Grassa schäumte vor Wut.
»Sie sind toll geworden!«, rief ein anderer Abaker. »Sie greifen uns an!«
Die Behauptung klang unglaublich. Doch schon zeigte sich, dass die immer friedlichen Schleimspeier tatsächlich angriffen. Panik brach aus. Die Abaker sprangen auf, stolperten übereinander oder über Gepäckstücke. Jeder dachte nur daran, wie er sich in Sicherheit bringen konnte, und in diesen verstörten Haufen hinein sprangen immer mehr Schleimspeier. Überall erklangen Wut- und Schmerzensschreie.
»Ruhe bewahren!«, brüllte Frobo.
Ein feiner Schmerz durchzuckte seinen Arm. Eines der Biester hatte sich an seinem Handgelenk festgebissen. Hitze pulsierte in Frobos Leib, und dann endlich begriff er. Auch die Schleimspeier hatten sich seit dem Erkalten des lebenspendenden Feuers in den Höhlen verwandelt. Während die lebenslustigen Abaker nur unleidlich geworden waren, hatten sich die friedlichen Schleimspeier in Bestien verwandelt, und das angenehm berauschende Sekret ihrer Drüsen hatte sich ebenfalls verändert. Dem Geschrei nach zu schließen und den Empfindungen, die von Frobo selbst Besitz ergriffen, verwandelte das Sekret die Getroffenen in Raufbolde. An den Rändern des Schlafplatzes prügelten viele Abaker schon aufeinander ein. Frobo begriff, dass diese Szenen bald zum mörderischen Kampf aller gegen alle werden mussten.
Aus dem Getümmel erklang plötzlich helles Gelächter. Kein anderer als Bonsin lachte so herausfordernd. Frobo machte einen Schritt in die Richtung. Endlich war es an der Zeit, seinem verkommenen Sprössling gründlich die Meinung zu sagen. Was fiel dem Burschen ein, in dieser Situation hemmungslos zu lachen? Zu allem Überfluss spielte Bonsin auf der kleinen Flöte, die Frobo ihm zum fünfundzwanzigsten Geburtstag geschenkt hatte. Die ersten Töne schallten durch die Höhle und mischten sich mit den Schmerzenslauten der Abaker. Bonsin spielte eine fröhliche Weise zu dem Gemetzel.
Frobo schrie vor Wut.
Mit einem Schlag trat Ruhe ein. Bonsins Spiel klang durch die Höhle. So bewegend hatte er nie gespielt. Die Klänge, die er seinem Instrument entlockte, ergriffen nicht nur die Abaker, sondern auch die Schleimspeier, die ihre Angriffe sofort einstellten. Frobo spürte, dass sich sein Puls beruhigte und die Anspannung von ihm abfiel.
Sacht wiegten sich die Abaker im Rhythmus. Die Schleimspeier krochen ein Stück davon. Am Rand der Höhle, nur wenige Schritte vor Bonsin, drängten sie sich zusammen. Es waren mittlerweile so viele, dass Frobo der Atem stockte. Wenn der Junge zu spielen aufhörte und die Wirkung der Musik verwehte ...
Nicht nur das Leben der Abaker hatte sich in letzter Zeit erheblich verändert, alle anderen Bewohner des Unterlands waren ebenso von der unheimlichen Wandlung befallen. Frobo kam zu der unbequemen Einsicht, dass es auf dem Weg zu Meister Dovhan mehr Hindernisse und Gefahren geben würde, als er befürchtet hatte. Die Abaker waren mürrisch und verdrießlich geworden, die Schleimspeier angriffslustig und zornerregend; das Licht allein mochte wissen, was aus den übrigen Sippen, Völkern und Einzelwesen geworden war, die sich im Unterland tummelten.
Bonsin ließ das Instrument sinken. Er lachte die Abaker an, während die Schleimspeier lautlos davonkrochen.
4.
Aus geröteten Augen starrte Meister Dovhan auf den Bildschirm. In gewaltiger Vergrößerung erschien das Präparat, das er vor wenigen Minuten unters Mikroskop gelegt hatte. Es war ein verwirrendes Muster verschlungener Molekülketten. Obwohl die entscheidenden Elemente von der Positronik farblich hervorgehoben wurden, fiel es dem Tiziden schwer, die entscheidenden Strukturen des Präparats herauszufinden. Er reagierte unzufrieden. Das Präparat war nicht so ausgefallen, wie er es sich vorstellte.
Seit Jahren war Meister Dovhan vornehmlich mit dieser Aufgabe befasst, dabei war er der Lösung des Problems erheblich näher gekommen. Der theoretische Ansatz seiner Forschung hatte sich allerdings ins Gegenteil verkehrt.
Die Positronik lieferte befehlsgemäß die Vergrößerung des zweiten Präparats, dann ließ sie beide Bilder abwechselnd aufscheinen. Theoretisch brauchte Dovhan nur nach solchen Partien zu suchen, die aufgrund dieser Wechselprojektion zu blinken begonnen hatten. Genau an jenen Bereichen waren die Präparate unterschiedlich strukturiert. Wenn das Experiment gelang, musste es möglich sein, den richtigen Ansatz für eine Verbesserung zu finden.
Es wurde ein Fehlschlag. Der einzige Unterschied bestand in einer geringfügig anderen Farbschattierung bei den energetischen Strömen, und diese Abweichung lag in einer Größenordnung, die Dovhan als Messfehler ansehen musste.
»Wieder nichts«, stieß er zornig hervor. Ihm gingen die Ideen aus, nach welchen Kriterien er den entscheidenden Erbbaustein aufspüren sollte.
Sein Forschungsgegenstand war der Tiefeneinfluss. Damit beschäftigten sich viele Tiziden. Es galt, in den genetischen Code einzudringen und einen Faktor zu ergänzen, der die Wirkung des Tiefeneinflusses abschwächte, sie bestenfalls völlig aufhob. Vor allem Dovhan hatte Jahrzehnte an diesem Problem verbracht. Er hätte sich rühmen können, die Forschung beachtlich vorangebracht zu haben, aber nun wusste er, dass es ihm misslungen war. Frühere Auswertungen hatten ergeben, dass eine genetisch codierte Immunität gegen den Tiefeneinfluss möglicherweise das Vordringen des Graulebens beeinträchtigt hätte. Dazu durfte es selbstverständlich nicht kommen. Dovhan war sich der Schwere seiner Aufgabe und der damit verbundenen Schwierigkeiten bewusst.
Bei jedem anderen Forschungsgegenstand wäre die Verfahrensweise klar gewesen. Zuerst hätte es geheißen, den Immuncode für den Tiefeneinfluss zu finden, und dann, ein Gegenmittel, das diesen Einfluss außer Kraft setzte. Doch unter keinen Umständen durfte immunes Leben entstehen, und seien es nur Versuchstiere oder gar Mikroorganismen. Das Problem bestand darin, dass es Dovhan nicht möglich war, den zu Versuchsbeginn unerlässlichen Nachweis zu führen, dass es eine solche Immunität überhaupt gab.
»Alles ist sinnlos«, murmelte der Tizide und schaltete ab. Er verließ das Labor und ging zur Wohnsektion.
Als Leiter der vielleicht wichtigsten Forschungsstation war Meister Dovhan recht gut über die jüngsten Entwicklungen informiert. Er wusste daher, dass dem Grauleben Gefahr von zwei Personen drohte, die sich als Ritter der Tiefe ausgaben. Gerade deshalb war es extrem wichtig, dass er mit seinen Forschungen weiterkam.
Der Tizide nahm eine einfache Mahlzeit zu sich. Dann wählte er aus seinen reichhaltigen Vorräten ein hochwirksames Aufputschmittel. Die Wirkung stellte sich rasch ein. Dovhan fühlte sich wieder munter, seine Bewegungen wurden schneller und geschmeidiger.
Er kehrte ins Zentrallabor zurück. Erneut betrachtete er die Präparate, und wieder war seine Reaktion ein unbehagliches Knurren. »So geht es nicht«, stellte er fest. Es zeichnete sich endgültig ab, dass die Lösung ohne praktische Erprobung nicht möglich war, und trotzdem schreckte er davor zurück. Er würde sich bei den Grauen Lords Ärger einhandeln, wenn er biologisches Leben erbrütete, das gegen die segensreiche Form des Graulebens unempfindlich war – vor allem, wenn es sich bei diesem Probeleben um etwas handelte, das möglicherweise andere Formen infizieren konnte. Ein Bakterium mit Grauresistenz war für die Tiziden, die Gen-Techniker, eine albtraumhafte Vorstellung.
Meister Dovhan dachte über Möglichkeiten nach, das Kernproblem zu isolieren und so zu gestalten, dass er es unter Kontrolle halten konnte. Ein Selbstversuch war vielleicht die beste Lösung, wie so oft in der Geschichte der Tiziden.
Erst vor Kurzem hatte er ein neues Virus an sich selbst erforscht. Ihm gefiel nur der Gedanke nicht, sich nach so geringer Erholungszeit erneut als Versuchsobjekt einzusetzen. Aber blieb ihm überhaupt eine Wahl?
Meister Dovhan machte sich an die Arbeit. Testmaterial stand in hinreichender Menge zur Verfügung, stets hielt er genügend eigene Gewebeproben und Blutvorräte zur Verfügung, um damit experimentieren zu können. Er wählte eine Zellkultur, die bei entsprechender Stimulation vor allem geistige Fähigkeiten entwickeln würde.
Aufmerksam studierte Dovhan die Vergrößerung. Das Bild zeigte Ausschnitte seiner eigenen Erbsubstanz, wenngleich nicht in der Form, in der sie ursprünglich vorhanden gewesen war. Jahrzehnte der Forschung hatten den Gen-Code des Tiziden immer wieder verändert, vom Ursprungsmaterial waren nur noch Ausschnitte vorhanden. Der größte Teil aller Änderungen war sinn- und nutzlos und stammte von erfolglosen Experimenten. In Verbindung mit neuen Änderungen konnten alte Codeverschiebungen trotzdem zu ungeahnten, mitunter höchst unwillkommenen Veränderungen führen.
Meister Dovhan begann, seinen Gen-Code neu zu initialisieren, vor allem bestimmte er die Multi-Codes, die in seine Erbmasse eingearbeitet werden sollten. Multi-Codes waren erprobte Gen-Veränderungen, die nach Belieben abgerufen und gekoppelt werden konnten, eine Art schnelles Testprogramm für die einzuarbeitenden Mutationen. In gewisser Weise war diese Arbeit mit dem Programmieren einer Positronik vergleichbar. Um zu funktionieren, mussten die Multi-Codes so eingearbeitet werden, dass sie kurzfristig nicht erneut überschrieben werden konnten.
Dovhan testete den Code überaus sorgfältig, bis er endlich zufrieden war. Aus dem Erbmaterial einer Hefezelle hatte er einen Virus-Code aufgebaut, der bei Infizierten für eine vollständige Spaltung der Geistestätigkeit sorgte. Jeder Sinnesreiz wurde in einen rationalen und einen emotionalen Teil getrennt. Den Erkrankten würde anschließend nur der rationale Teil zugänglich sein.
Dovhan lächelte, als er diesen Baustein in sein eigenes Erbgut einpflanzte. Das mutierte Hefevirus hatte sich als ausgesprochen wirksames Verhörmittel erwiesen, mit dem nahezu jede Intelligenz gesprächig zu machen war. Während sich im Unbewussten des Verhörten die Gefühle aufstauten, vor allem Angst, Schmerz und Wut, blieb es dem wachen Verstand vorbehalten, diesen Sachverhalt sachlich zu analysieren. Jedem Probanden musste rasch deutlich werden, dass er bei diesem Verfahren an handfesten psychosomatischen Folgeschäden des Emotionsstaus zugrunde gehen musste. Folglich waren die Verhörten bald bereit, ihre Informationen preiszugeben, und nur die wenigsten waren rational genug, sich klarzumachen, dass sie damit ihr Todesurteil unterschrieben.
Meister Dovhan wollte diesen Code aber nicht zu Verhörzwecken einsetzen, sondern um die einzelnen Komponenten des Tiefeneinflusses getrennt untersuchen zu können. Vorsichtshalber verband er den Code mit einem anderen, der die Wirkung kontrollier- und abrufbar machte.
Als er den ersten Teil der Arbeit beendete, war er völlig erschöpft. Mittlerweile versagte sogar das Aufputschmittel. Dovhan zog sich in seinen Schlafbereich zurück. Bevor er sich zum Schlafen legte, injizierte er sich einen bakteriologischen Kampfstoff, den er im Auftrag der Grauen Lords entwickelt hatte. Außerdem schloss er die Kontakte der telemetrischen Überwachung an seinen Körper an. Die ihn beaufsichtigende Positronik würde ihn wecken, falls die Werte sich durch die Wirkung des Kampfstoffs besorgniserregend verändern sollten.
»Vorzüglich«, murmelte Meister Dovhan, als er eine Stunde nach dem Erwachen seinen Körper betrachtete. Auf der kreidig weißen Haut hatten sich schwärzliche Flecke gebildet, ein deutliches Zeichen dafür, dass der Kampfstoff wirkte. Auf Lebewesen, die keinen derart widerstandsfähigen Metabolismus hatte wie die Tiziden, musste das Mittel einen verheerenden Einfluss haben.
Dovhan kehrte ins Labor zurück und injizierte sich ein Medikament, das die Wirkung des Kampfmittels neutralisierte. Aus Gründen, die seine Kollegen nicht verstanden, legte er immer wieder Wert darauf, seinen ursprünglichen Zustand zu rekonstruieren, wohingegen andere Gen-Techniker die experimentellen Veränderungen einfach weiterwachsen ließen. Das hatte mit der Zeit dazu geführt, dass von einem einheitlichen Äußeren der Tiziden keinesfalls die Rede sein konnte; einige von Dovhans Kollegen boten sogar für die Augen eines Tiziden einen ausgesprochen scheußlichen Anblick.
Im Brutschrank lagerte eine Zellkolonie, die weiterverarbeitet werden konnte. Dovhan narkotisierte einen Fleck seines Körpers, dann pflanzte er sich die Kolonie ein. Das war standardisiertes Vorgehen. Die Tiziden verwendeten ihre unerhört leistungsfähigen Körper, um vollständige Lebewesen zu Testzwecken zu erbrüten. Die Auswirkungen dieses Verfahrens auf den eigenen Metabolismus gaben den Forschern treffendere Hinweise auf Fehler im Gen-Programm, als es dem besten Analysator möglich gewesen wäre. Das galt vor allem für submikroskopische Lebensprozesse, die bei herkömmlichen Verfahren schon durch den Eingriff der Instrumente empfindlich gestört, wenn nicht gar zum Erliegen gebracht wurden.
Der nächste Schritt war einfach und lästig zugleich. Dovhan nahm eine Droge zu sich, die das Wachstum der eingepflanzten Zellen förderte. Entwicklungen, die Wochen oder Monate gebraucht hätten, konnten so auf wenige Tage reduziert werden, eine unerlässliche Voraussetzung für wirksame Forschung.
Nach einiger Zeit entnahm er dem wuchernden Zellknoten an seinem Leib eine erste Probe. Die optische Vergrößerung zeigte die Erbsubstanz dieser Zelle. Pedantisch analysierte Dovhan alle Werte, dann erst gab er sich zufrieden. Jeder Teilcode saß exakt an der gewünschten Stelle.
In der Folge wuchs die Geschwulst und wurde deutlich strukturiert. Bald ließ der Gewebeknoten erkennen, dass aus ihm ein vollständiger Tizide hervorgehen würde, ein Ebenbild Dovhans. Es war das Äußerste an Selbstversuch, das je ein Tizide gewagt hatte. Meister Dovhan würde damit entscheidende Erkenntnisse über den Tiefeneinfluss und das Grauleben gewinnen.
War es erst einmal gelungen, die spezifische Eigenart des Tiefeneinflusses und des Graulebens zu isolieren und Anwendungen zugänglich zu machen, dann ließen sich in der Folge unschwer Hilfsmittel ersinnen, das Grauleben genetisch so abzusichern, dass nichts und niemand diesen Fortschritt alles Lebendigen mehr verhindern konnte.
Aus seinem Körper erwuchs inzwischen ein zweiter lebender Leib. Dass dieses Kunstgeschöpf seine Gesichtszüge trug, störte Dovhan nicht, er machte sich nur Sorgen wegen des Ausdrucks auf diesem Gesicht. Es wirkte maskenhaft starr und in den Augen loderte ein Feuer, das den Meister überraschte. Er hatte zu spät bemerkt, dass ihm aller Sorgfalt zum Trotz bei der Programmierung des Brut-Gens ein Fehler unterlaufen war. Sein Miniaturzwilling hatte ein Raubtiergebiss bekommen. Aber solange das gesamte Experiment unter Kontrolle blieb, war dieser Fehler vernachlässigbar. Dovhan empfand ihn jedenfalls nicht als Beeinträchtigung.
Der Meister widmete sich gerade der Feinstruktur einer Gewebeprobe, als sich einer der Roboter bei ihm meldete. Dovhan gebot über eine Schar nützlicher Maschinen. Lord Mhuthan hatte sie ihm zur Verfügung gestellt. Die Roboter verrichteten die groben Arbeiten und waren für seinen Schutz da. Dovhan fragte sich immer wieder, vor wem oder was ihn die Roboter zu beschützen hatten, denn weit und breit war kein Feind zu sehen.
»Was gibt es?«, fragte er ungeduldig.
»Abaker«, antwortete der Roboter. Sooft Dovhan die schnarrende Stimme hörte, amüsierte er sich und war stolz auf seine Arbeit. Einem Gen-Techniker seines Formats wäre eine solche Panne nicht unterlaufen. Dabei kamen sich die Schöpfer der leblosen Maschinen besonders wichtig vor.
»Schick ihn weg!«, entschied Dovhan. »Ich habe zu tun und darf nicht gestört werden.«
»Es sind etliche Abaker«, berichtigte der Roboter.
»Jemand, den ich kenne?«
»Die Kreatur Frobo. Er wird von einer großen Schar begleitet. Ich habe vierhundertsechsundneunzig gezählt, aufgeschlüsselt ...«
»Die Gesamtzahl genügt«, sagte Meister Dovhan schnell. Sobald er den Roboter gewähren ließ, bekam er einen statistischen Vortrag zu hören. Bei komplexen Experimenten war es mitunter nützlich, wenn die Maschine über die nebensächlichsten Kleinigkeiten referieren konnte. Im Alltagsleben war diese Gründlichkeit entnervend.
»Was wollen sie?«
Dovhan fragte eher, um Zeit zu gewinnen, nicht aus Neugierde. Knapp fünfhundert Abaker, eine Sippe also. Das ließ schwerwiegende Probleme oder gar Forderungen erwarten.
»Höchstens zwei dürfen eintreten. Der Rest muss draußen warten.«
Der Roboter verließ den Raum. Dovhan schaltete die Versuchsanordnung aus, danach gab er seinem Zwilling zu essen. Nachdenklich betrachtete er das bedrohlich wirkende Gebiss, mit dem das knospende Geschöpf über die Nahrung herfiel.
Im Besucherraum warteten zwei Abaker. Meister Dovhan erkannten den Älteren der beiden sofort. Es war Frobo, der ihn schon mehrmals aus dem Unterland aufgesucht hatte, mal als Abgesandter seines Stammes, mal in eigener Sache. Neben Frobo stand ein Junge, Dovhan schätzte ihn auf knapp dreißig Tiefenjahre, ein aufgeweckter Kerl, gut gewachsen für einen Abaker und mit hellwachen, flinken Augen.
»Mein Sohn Bonsin, Meister«, sagte Frobo nach einigem Zögern.
»Hm«, überlegte Dovhan. »Dein Sohn. Langsam erinnere ich mich.«
Frobo ... Das war jener Abaker, der von ihm Hilfe erbeten hatte, weil er zwar eines seiner empfängnisverhütenden Mittel genommen hatte, die Wirkung aber im Nachhinein bereute. Der Meister entsann sich, was er damals angeregt hatte. Bonsin war offenkundig das Ergebnis dieser Bemühungen. Einmal mehr war Dovhan mit sich und seiner Arbeit zufrieden.
Frobos zaghaftes Verhalten erklärte er sich damit, dass Bonsin von den besonderen Umständen seiner Geburt nichts wusste und nach Frobos Willen auch nichts darüber erfahren sollte. Nun, das war Frobos Sache.
»Kommst du seinetwegen?«, fragte Dovhan.
»Das auch.« Der Abaker seufzte. »Eigentlich eher grundsätzlich: Es sieht schlimm aus.«
Langatmig und gewunden brachte Frobo die Beschwernisse vor, unter denen er und sein Volk zu leiden hatten. Anfangs nahm Dovhan die Klagelitanei nicht sonderlich ernst, schließlich hörte er aufmerksamer zu und fing an, sich zu ärgern. Was fiel diesen Burschen ein, ihn damit zu behelligen? Die Abaker hielten sich womöglich für etwas Besonderes. Der Unterton in Frobos Stimme klang deutlich nach Forderung. Aber es kam einem Abaker nicht zu, von einem Tiziden etwas zu fordern, schon gar nicht unter den gegenwärtigen Bedingungen.
»Kommt mit!«, sagte Dovhan energisch. »Ich werde euch etwas zeigen.«
Er ging voran zu jenem Raum seiner Forschungsstation, der »Halle des Ruhms« genannt wurde. Ausstellungsstücke und Forschungsunterlagen zeigten dort die Erfolge der Tiziden in den letzten Jahrhunderten. Es war, wie Meister Dovhan sehr wohl wusste, eine beeindruckende Darstellung. Mehrere Prunkstücke dieser Halle waren unauslöschlich mit seinem Namen und seinem Rang als Gen-Techniker verbunden.
Frobo reagierte sichtlich ergriffen, als er die hohe Kuppelhalle betrat, deren Deckenwölbung als Projektionsfläche für die aufgezeichneten Unterlagen diente. Dovhan wählte die Informationen an, die er den Abakern zeigen wollte.
Schon die ersten Filmsequenzen ließen Frobo ächzen ...
»Sie werden lästig, und das Übel wird mit jedem Monat schlimmer«, stellte Meister Ghanthior grimmig fest. »Wir müssen dagegen einschreiten.«
Die Gemeinschaft der Gen-Techniker stand um einen Tisch herum, auf dem der Grund des beklagten Übels zu sehen war. Die Tiziden hatten einige Exemplare des überaus lästigen Ungeziefers eingefangen, mehr als ein Dutzend der Plagegeister krabbelten in dem Glaskasten herum.
»Sie sehen scheußlich aus«, klagt Geselle Ivther, dessen persönlicher Ausbilder Meister Ghanthior war.
»Es gibt keine scheußlichen Geschöpfe«, tadelte Ghanthior streng. »In solchen Fällen dürfen wir uns nie von Vorurteilen leiten lassen. Tatsache ist dennoch, dass diese Abaker unsere Nahrungsmittelvorräte auffressen, den Rest verunreinigen und sich binnen kurzer Zeit derart stark vermehrt haben, dass sie Gesundheit und Wohlbefinden aller Bewohner dieser Region bedrohen. Deshalb müssen wir gegen die Plage vorgehen, aber nicht, weil sie nach unseren Vorstellungen scheußlich aussehen.«
Geselle Ivther nahm die Zurechtweisung schweigend an. Er wusste, dass er in Meister Ghanthior den besten Ausbilder gefunden hatte, den ein Gen-Techniker bekommen konnte. Trotzdem fand er die Abaker scheußlich. Sie waren gierige, gefräßige Krabbler und überall anzutreffen. Leider wegen ihrer Beweglichkeit auch nur schwer zu erwischen.
»Wir könnten es mit Gift und Fallen versuchen«, schlug ein anderer Geselle vor. Die Unsinnigkeit seines Vorschlags bewies, dass er erst seit Kurzem ausgebildet wurde. Ein Gen-Techniker arbeitete niemals mit solch groben Mitteln.
»Aussichtslos, ihre Vermehrungsrate ist zu hoch. Außerdem würden wir damit andere Geschöpfe gefährden. Wir müssen einen besseren Weg finden.«
»Wie wäre es mit einem Krankheitserreger, speziell für die Abaker gezüchtet? In anderen Fällen haben wir gute Erfolge erzielt.«
Wieder machte Meister Ghanthior eine ablehnende Geste. »Die Gefahr wäre zu groß, dass wir diese Spezies völlig ausrotten. Wir empfinden sie als Schädlinge, aber wir wissen bislang nicht, was sie darüber hinaus bewirken können. Schließlich kennen wir keineswegs alle Lebensbereiche im Tiefenland. Und vergesst nicht, dass wir sie hier eingeschleppt haben. Dass sie im Tiefenland ungeahnt gute Lebensmöglichkeiten finden und sich rasend schnell vermehren würden, konnten wir nicht ahnen.«
»Wenn dies nicht der angestammte Lebensraum der Abaker ist, warum rotten wir sie nicht ganz einfach aus? Nach so kurzer Zeit können sie hier keine nützliche Wirkung entwickelt haben.«
»Wir versuchen es mit einem Minimalprogramm«, entschied Meister Ghanthior. »Als Erstes werden wir sie ein wenig größer machen, damit sie leicht zu entdecken sind. Außerdem werden wir ihre Vermehrungsrate entscheidend senken.«
»Und wie?«, fragte der Geselle Ivther.
Ghanthior reagierte mit einer geringschätzigen Geste. »Das Verfahren ist uralt, nicht einmal von uns entwickelt, aber es ist einfach anzuwenden und funktioniert. Wir werden viele Abaker züchten und ihre Fruchtbarkeit herabsetzen. Diese Abaker werden wir anschließend freilassen.«
Anhaltendes Murmeln verriet, dass längst nicht jedem der Gen-Techniker dieses uralte Verfahren geläufig war. Die Vorstellung, eine Landplage durch Züchtung zu vergrößern, entsetzte sie. Allerdings waren es nur die Adepten und Gesellen, die ihre Verwirrung äußerten. Die sechs Meister wussten sehr genau, wovon Ghanthior redete.
»Unsere Züchtungen werden sich mit der Standardform der Abaker vermischen und ihr verändertes Erbgut weitergeben. Auf die Weise wird die geringere Vermehrungsrate bald allgemeines Merkmal dieser Spezies werden, von vereinzelten Exemplaren abgesehen.«
»Und da diese Einzelexemplare sich weiterhin rasch vermehren werden, haben wir die Plage unverändert.«
Meister Ghanthior lächelte verhalten. »Nein«, widersprach er. »Wir werden den Abakern ein weiteres Geschenk machen und dem Übel damit ein für alle Mal ein Ende bereiten.« Er legte eine Kunstpause ein und fuhr dann bedächtig fort: »Wir steigern ihre Intelligenz, wenigstens bis auf das Niveau domestizierter Geschöpfe, vielleicht sogar etwas höher. In jedem Fall so weit, dass sich neue Verhaltensweisen ausprägen.«
»Intelligenz als Mittel gegen eine Ungezieferplage?«
»Wenn diese Intelligenz ausreicht, Begriffe wie Sitte und Moral zu entwickeln, dann ist sie effektiver als alles, was wir genetisch implantieren können. Wir dürfen die Intelligenz der Abaker nur nicht so weit steigern, dass sie erkennen könnten, wie sehr ihre neue Moral oder Gesellschaftslehre ihren natürlichen Veranlagungen widerspricht. Das zu tun, wäre ein Verbrechen.«
»Es wäre sogar mehr«, warf Datrider ein, Großmeister und der ranghöchste Tizide im Raum. »Es wäre ein Fehler.«
Ghanthior zeigte sich zufrieden. Die Billigung des Großmeisters hatte er, demnach konnte die Arbeit beginnen.
Frobo musste sich festhalten, um nicht umzufallen. Er wollte nicht glauben, was er soeben erfahren hatte, doch die Bilder waren eindeutig. In der Projektion tummelten sich Abaker – gerade einmal handspannengroße Geschöpfe, die erst bei genauem Hinsehen als Abaker zu erkennen waren.
»Das war die erste Stufe«, klang Meister Dovhans Stimme durch den Raum.
Die Bildwiedergabe zeigte die veränderten Abaker. Sie waren größer geworden und ein wenig schwerfälliger in ihren Bewegungen. Trotzdem blieben sie geschicklich und fraßen, wie die Filmausschnitte zeigten, kleinere Schädlinge. Einigen Tiziden war es offenbar gelungen, die Abaker sogar ein wenig zu dressieren. Die typischen Hängeohren waren schon zu erkennen, und von den acht Beinen der ehemaligen Schädlinge entwickelten sich die vordersten beiden zu Greifwerkzeugen.
»Die nächste Stufe«, fuhr Meister Dovhan fort.
Offensichtlich waren Generationen vergangen. Die Tiziden hatten sich, aus welchen Gründen auch immer, mit den ersten Eingriffen ins Erbmaterial der Abaker nicht zufriedengegeben. Der neue Typus war erheblich größer, die erwachsenen Exemplare hätten Frobo bis ans Knie gereicht. Einzelne dieser Geschöpfe übten sich bereits im aufrechten Gang. Das hintere Beinpaar verkümmerte und zwang die Abaker dadurch zu einer anderen Körperhaltung. Außerdem hatten diese Abaker bereits piepsend schrille Stimmen.
»Unablässig haben wir Tiziden an der Vervollkommnung unseres Werks gearbeitet«, berichtete Dovhan. »Ich kann sagen, dass es unsere gründlichste und vollkommenste Arbeit war, eine Leistung, die uns wohl niemand nachmachen wird. Erst heutzutage sind wir fähig, diese grandiose Leistung vielleicht zu überbieten.«
Als sei er damit gemeint, gab Dovhans kleiner Zwillingskopf ein boshaftes Knurren von sich.
Meister Dovhan setzte den Vortrag fort ...
»Ich habe Erstaunliches gefunden, Meister!«
Meister Trahnver wartete ab, bis sich der Geselle ehrfurchtsvoll genähert hatte. Das Gesicht des Gesellen verriet einen Anflug von Stolz – eine Regung, die der Meister bei seinen Mitarbeitern gar nicht schätzte.
»Du arbeitest woran?«, fragte er herablassend.
»Am Abaker-Projekt.«
»Das ist noch nicht abgeschlossen?«
Natürlich wusste der Meister, dass das Projekt weiterhin durchforscht wurde. Es galt inzwischen als eine Art Lehrstück für Gesellen. Sie bekamen nur dann die Zulassung zur Meisterprobe, wenn sie nachweisen konnten, dass ihnen am Erbmaterial der Abaker eine Verbesserung gelungen war, die mit früheren Änderungen zusammenpasste. Wegen der zahllosen Eingriffe in die genetische Substanz der Abaker war ohnehin nur mehr selten Vervollkommnung zu erreichen.
»Meine Arbeit besteht darin, die in jüngster Zeit vorgeschlagenen Änderungen auf Kompatibilität zu prüfen«, antwortete der Geselle mit akzentuierter Höflichkeit.
Trahnver nickte. Es war eine stumpfsinnige Tätigkeit, die zahllosen Einzelfunktionen miteinander zu vergleichen und durchzurechnen. Der Meister wusste es aus Erfahrung, ihm war als Geselle eine ähnliche Last aufgebürdet worden, und das machte ihm sein Gegenüber wenigstens etwas sympathischer.
»Mir ist aufgefallen, dass eine bestimmte Gruppe genetischer Codes im Labormaterial der Abaker doppelt vorhanden ist«, berichtete der Geselle.
Meister Trahnver winkte ab. Dergleichen war nicht neu.
»Ich weiß, dass es so etwas öfter gibt«, fuhr der Geselle fort. »In diesem Fall hielt ich es für ratsam, mich bei dir zu melden. Darf ich die Gruppe vorführen?«
Mit einer Handbewegung gab der Meister die Erlaubnis. Aufmerksam sah er zu, und der Geselle machte seine Sache recht gut. Der junge Tizide ließ sich durch die Anwesenheit des berühmten Meisters – Trahnver war Anwärter auf die Würde des Großmeisters – nicht aus der Fassung bringen. Es würde festzustellen sein, ob das auf gesunder Selbsteinschätzung beruhte oder auf Überheblichkeit.
»Es ist diese Gruppe, Meister.«
Mit einem raschen Blick überflog Trahnver die Darstellung; es war eine kleine Demonstration für den Gesellen, dass er darauf verzichtete, sich vom positronischen Analysator Hilfestellung geben zu lassen.
»Eine mit Intelligenzsteigerung verbundene Körperänderung«, bemerkte der Meister. »Diese Phänotyp-Veränderung ist uralt, es ist das Meister Ghanthior-Gen.«
Der Geselle zeigte im Gesicht den Ausdruck der Hochachtung, die Meister Trahnver grundsätzlich forderte. »Und nun sieh dir diesen Abschnitt an«, bat er.
Der Meister brauchte nur Sekunden für sein Urteil. »Identisch«, stellte er fest. In seiner Stimme schwang ein wenig Verärgerung mit, dass er dieser Lappalie wegen in seiner Forschungsarbeit unterbrochen worden war.
»Identisch, ja. Allerdings stammt dieses zweite Gen aus dem Original-Abaker-Material.«
Die Stimme des Gesellen klang triumphierend, und Meister Trahnver war sich sofort der Konsequenzen bewusst, falls die Behauptung stimmte. Er prüfte alles nach.
»Tatsächlich«, sagte er und machte aus seinem Erstaunen kein Hehl. »Das würde bedeuten ...«
»... dass die Abaker früher oder später eine ähnliche Entwicklung genommen hätten wie die, die von uns eingeleitet worden ist. Dieser Code wird seltsamerweise durch ein ungeheuer mutationsanfälliges Gen unwirksam gemacht, das für die Färbung des Fells verantwortlich ist. Sobald es freigesetzt worden wäre, und das hätte jederzeit geschehen können, wären die Abaker von sich aus geworden, wie sie heute sind, und höchstwahrscheinlich sogar entschieden intelligenter.«
Meister Trahnver machte eine Geste des Unwillens. Es war ziemlich blamabel für die Zunft der Gen-Techniker, wenn herauskam, dass sie sich viel zu sehr angestrengt hatten, um etwas zu erreichen, das sich mit minimalem Aufwand auf andere Weise hätte durchsetzen lassen. Weitaus wichtiger aber war die Tatsache, dass die in diesem speziellen Gen codierte natürliche Entwicklung der Abaker nun von einer ganz anderen Basis ausging.
Der Meister prüfte die Daten genauestens. Er rechnete die Mutationen hoch und simulierte mit dem Rechner Entwicklungsvarianten. Er kam zu dem erschreckenden Ergebnis, dass die Abaker wegen dieses Förderungsgens bei natürlicher Entwicklung eines Tages mit den Tiziden gleichziehen würden. Jedenfalls was die geistigen Fähigkeiten anging.
»Ich danke dir«, sagte der Meister freundlich. »Ich bin sicher, dass dir diese Arbeit schnellstens die Meisterwürde einbringen wird, sofern du in der Lage bist zu schweigen.«
»Von mir erfährt niemand etwas«, beteuerte der überglückliche Geselle. »Und was wird nun aus den Abakern? Lassen wir der Entwicklung freien Lauf, oder ...?«
Der Meister brauchte nicht lange zu überlegen. Draußen vor der Forschungsstation ging ein Trupp Abaker der Beschäftigung nach, für die sie in äonenlanger Arbeit entwickelt worden waren. Immer fröhlich, immer heiter, geschickt, beweglich, kunstfertig, spaßig anzusehen, dabei freundlich und willfährig – für die Tiziden eine stete Quelle der Erheiterung und der Erholung, manchmal die einzige Abwechslung in dem sonst eintönigen Forscherleben. Damit sollte es bald vorbei sein?
Der Meister nahm eine weitere Berechnung vor. Ihr Ergebnis war, dass etliche Jahrtausende vergehen mussten, bis sich die Abaker eigenständig weiterentwickeln würden – vorausgesetzt, das doppelt vorhandene Gen wurde aus ihrem Erbmaterial entfernt ... ein Eingriff, der sich mühelos bewerkstelligen ließ ...
Die Unterrichtsstunde in Abakergeschichte war beendet, und offenkundig hatte Frobo die Lektion begriffen. Er wirkte erschüttert.
»Das alles liegt sehr lange zurück«, sagte Meister Dovhan. »Viel ist inzwischen passiert. Ihr Abaker habt euch weiterentwickelt, desgleichen wir Tiziden. Für uns stellen sich in dieser Welt neue, völlig andere Aufgaben, und das gilt ebenso für euch Abaker.«
»Mit den alten Zeiten ist es also für immer vorbei?«, fragte Frobo zaghaft. »Keine Feste?«
»Keine«, sagte Meister Dovhan ohne Umschweife. »Euer Leben wird, wie das unsere, einen von Grund auf anderen Sinn bekommen. Ich bin jedoch sicher, dass besonders ihr Abaker die neue Aufgabe ebenso zuverlässig erfüllen werdet wie eure frühere Rolle. Und so, wie Tiziden und Abaker in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, jeder an seinem Platz, werden wir in Zukunft zum Wohl des Ganzen Hand in Hand arbeiten.«
Frobo nickte bedächtig. »Heißt das, dass wir einfach umkehren sollen, in unsere Höhlen zurückgehen und dort ... ja, was sollen wir dort tun?«
Dovhan setzte eine überlegene Miene auf. »Wir haben große Pläne mit euch. Ich bin bereits an der Arbeit, neue Entwicklungen vorzubereiten, die euch ungeahnte Möglichkeiten eröffnen werden. Sei versichert, dass eine große Verantwortung auf euren Schultern liegen wird. Du wirst mir zustimmen, dass angesichts umwälzender Ereignisse an stete Festlichkeiten nicht zu denken ist, dafür seid ihr einfach zu schade.«
Instinktiv richtete Dovhan seinen Blick auf den jungen Abaker. Bonsin starrte vor sich hin, sein Gesicht wirkte verschlossen. Meister Dovhan spürte seinen Zwilling leicht zucken.