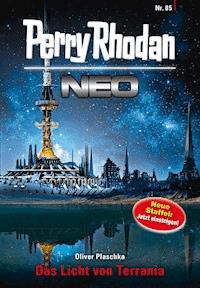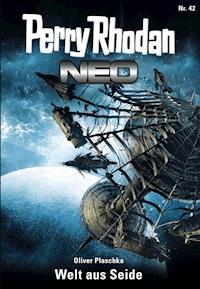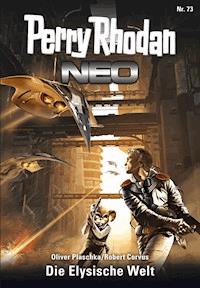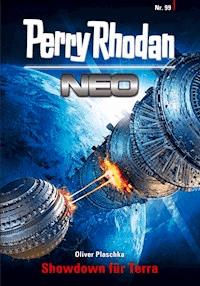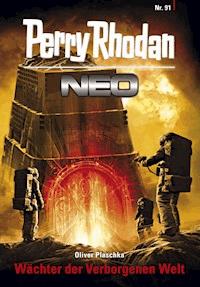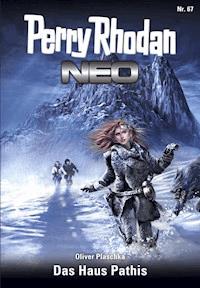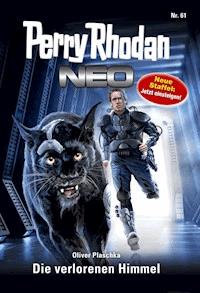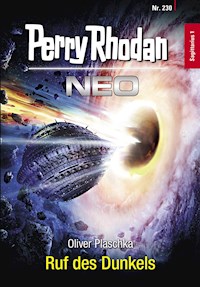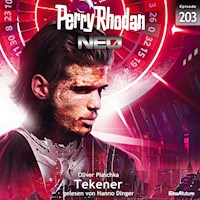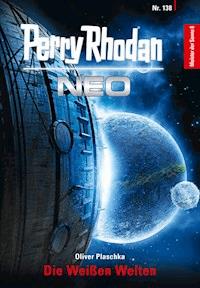
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Perry Rhodan digitalHörbuch-Herausgeber: Eins A Medien
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan Neo
- Sprache: Deutsch
2036 entdeckt der Astronaut Perry Rhodan auf dem Mond ein außerirdisches Raumschiff. Seither erlebt die Erde einen enormen Aufschwung. Im Sommer 2051 leben die Bewohner der Erde in Frieden, alle Gefahren scheinen bewältigt. Die Menschheit kann weiter an ihrer Einigung arbeiten. Dann tauchen fremde Raumschiffe auf – es sind die Sitarakh. Mit überlegener Technik reißen sie die Macht an sich. Ihre Ziele sind weitestgehend unbekannt, ihre Herrschaft ist total. Die Lage auf der Erde wird immer verzweifelter. Bereits zwei Millionenstädte haben die Invasoren vernichtet: Dubai und New York. Auch im Weltraum hat die Terranische Flotte eine erbitterte Niederlage erlitten. Immerhin ist Perry Rhodan mit vielen Mitstreitern ins All entkommen, wo ihm die mächtigen Liduuri ihre Unterstützung zusagen. Allerdings muss er auch ihnen helfen. Dabei bereist Rhodan DIE WEISSEN WELTEN ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 138
Die Weißen Welten
Oliver Plaschka
Cover
Vorspann
Prolog
Teil I – Die schlaflose Stadt
1. Leyle
2. Christophe Lente
3. Leyle
4. Christophe Lente
5. Leyle
Teil II – Das Auge im Zentrum der Nacht
6. Julian Tifflor
7. Gucky
8. Julian Tifflor
9. Perry Rhodan
10. Julian Tifflor
11. Perry Rhodan
12. Julian Tifflor
Teil III – Welt der Erleuchteten
13. Perry Rhodan
14. Julian Tifflor
15. Der Weiße Magier
16. Perry Rhodan
17. Julian Tifflor
Teil IV – Nocturne
18. Die Logik des Arkoniden
19. An Bord der TERRANIA
20. Eine Frage des Geschmacks
21. Die Crew der SD 23
22. Marshalls Weitsicht
23. Der Wert des Lebens
24. Der Rat des Administrators
25. Der Kater und die Anchet
26. Thoras Stärke
Epilog
Impressum
PERRY RHODAN – die Serie
2036 entdeckt der Astronaut Perry Rhodan auf dem Mond ein außerirdisches Raumschiff. Seither erlebt die Erde einen enormen Aufschwung. Im Sommer 2051 leben die Bewohner der Erde in Frieden, alle Gefahren scheinen bewältigt. Die Menschheit kann weiter an ihrer Einigung arbeiten.
Dann tauchen fremde Raumschiffe auf – es sind die Sitarakh. Mit überlegener Technik reißen sie die Macht an sich. Ihre Ziele sind weitestgehend unbekannt, ihre Herrschaft ist total.
Die Lage auf der Erde wird immer verzweifelter. Bereits zwei Millionenstädte haben die Invasoren vernichtet: Dubai und New York. Auch im Weltraum hat die Terranische Flotte eine erbitterte Niederlage erlitten.
Immerhin ist Perry Rhodan mit vielen Mitstreitern ins All entkommen, wo ihm die mächtigen Liduuri ihre Unterstützung zusagen. Allerdings muss er auch ihnen helfen. Dabei bereist Rhodan DIE WEISSEN WELTEN ...
Prolog
Da war eine Stimme, die zu ihm sprach.
»Wach auf«, sagte die Stimme.
Und so erwachte er.
Er lag in einem Raum, den er nicht kannte, auf einem Bett, an das er sich nicht erinnern konnte. Wo war er? Wie war er hierhergelangt?
Und – eine Frage, so drängend, so absurd, dass er sie kaum zu stellen wagte – wer war er?
Der Raum gab ihm keine Antwort darauf.
Es war ein Krankenhauszimmer. Weiße Wände, weiße Decke, summende Maschinen. Außerdem: Wenn man sich derartig schwach fühlte wie er, befand man sich entweder in einem Krankenhaus oder man wurde gerade gefoltert. Aber es war niemand außer ihm da.
Wieso war niemand da? Jemand hatte doch zu ihm gesprochen ...
Er wollte etwas sagen, aber keine Worte drangen aus seinem Mund. Seine Zunge fühlte sich an, als hätte sie tagelang trocken am Gaumen geklebt. Er hatte keinen Hunger, keinen Durst. Künstliche Ernährung? Vielleicht – doch sein Mund, seine Haut sehnten sich nach Wasser.
Eine Maschine summte. Die Kopfstütze seines Betts richtete sich auf.
Nun sah er auch einen Teil des Bodens, sah die Maschinen, die Anzeigen: Herzschlag, EEG. War das sein EEG? Es wirkte eigenartig; allerdings hatte er keine Ahnung, wie sein EEG normalerweise aussah. Wie auch, wenn er nicht einmal wusste, was in seinem Führerschein stand ...
Monk. Ein Name: Monk.
Der Name machte ihm Angst. Was bedeutete er? War er ein Mönch? Nein, es sei denn auf eine sehr groteske, sehr verdrehte Art und Weise.
Monk war ein Verbrecher. Monk hatte geglaubt, das Ende aller Tage sei nahe. Weil die Außerirdischen gekommen waren. Nur die Auserwählten würden überleben.
Er war nicht mehr Monk. Wollte nie wieder Monk sein.
Monk war ein Mörder. Man hatte ihn verurteilt, ihn weggesperrt.
Weshalb war er hier?
Eigentlich lautete sein Name ja Moncadas ...
War er verrückt geworden? Hatte die Vergangenheit ihn eingeholt? Wer hatte zu ihm gesprochen?
Endlich gelang es ihm, den Kopf zu drehen, sich umzusehen. Nein, er war definitiv allein in diesem Zimmer. Nur die Maschinen, keine Ärzte. Das Licht brannte, das EKG piepste, aber niemand war da.
»Hallo?«, brachte er hervor, doch es war nur ein heiseres Rabenkrächzen. »Ist da wer? Ich brauche Hilfe.«
Müsste sein Erwachen nicht jemandem aufgefallen sein? Anscheinend nicht. Aber sollte sich nicht irgendwo in seiner Reichweite ein Rufknopf für genau solche Fälle befinden? Seine Finger tasteten umher.
Und mit seinen Fingern, ebenso natürlich wie unwillkürlich, tastete auch sein Geist.
Da waren Stromkreise, überall. Sie führten von den Maschinen hinaus aus dem Zimmer und zu anderen Maschinen. Geduldige Stromkreise, pflichtschuldige Stromkreise. Sie überwachten, meldeten, warteten ab, verrichteten ihren Dienst. Einer war besonders drängend.
Seine Finger fanden einen Knopf. Er drückte darauf.
Nun waren alle Stromkreise in heller Aufruhr. Kommt schnell! Kommt her!, riefen sie. Doch sie erhielten nie eine Antwort.
Träumte er? Nein, erkannte er. Das war, was er tat – sein wahrer Name lautete Josue Moncadas, und er war Interruptor. Ob ein Interruptor oder der Interruptor war einerlei, denn seine Mutantengabe war einzigartig. Er konnte Stromkreise unterbrechen und kontrollieren. Nur wenn er sich übernahm, machte ihm das zu schaffen.
Allmählich erinnerte er sich, was geschehen war.
Er hatte lange für seine zweite Chance, sein neues Leben gekämpft, und er war dankbar dafür. Er hatte sich auf die Seite von Perry Rhodan und der anderen Mutanten gestellt. War mit ihnen in den Einsatz gezogen, mehr als einmal.
Dann hatte er der Mutantin Tani Hanafe geholfen, die gefährliche Bujun-Bombe an Bord der CREST zu entschärfen. Die Interaktion mit Hanafe und die Entschärfung des uralten Artefakts waren fordernder gewesen als alles, was er jemals zuvor getan hatte. Er hatte das Bewusstsein verloren.
Neue Fragen drängten sich ihm auf: Wie viel Zeit war seitdem vergangen? War die Gefahr gebannt? War er immer noch auf dem Raumschiff?
Er versuchte, sich aufzusetzen.
Es kostete ihn all seine Kraft, aber schließlich gelang es ihm. Seine letzte Frage konnte er als Erstes beantworten: Er war nicht mehr im Weltraum. Da war ein Fenster hinter den Maschinen um sein Bett, und das Fenster zeigte auf einen Park hinaus. Wäre es nur ein Hologramm, er würde die Stromkreise spüren. Die Bäume und Gebäude dort draußen waren echt. Es war hell, ein Sommertag.
Ansonsten war das Zimmer leer. Die Tür zum Flur war nur angelehnt. Es war auffällig still. Wo waren die Schwestern, die Pfleger, die hustenden Patienten?
Er merkte, dass er noch an einem Tropf hing. Achtlos zog er die Kanüle aus seinem Arm. Andere Geräte trug er nicht am Körper, dazu war das Krankenhaus zu modern. Das Terrania Medical Center? Wahrscheinlich. Wenn er sich nicht mehr im Leerraum befand, dann war in der Tat eine Menge Zeit vergangen ...
Auf dem Nachttisch neben seinem Bett stand eine Uhr. Mit zitternden Händen nahm er sie auf.
16.52 Uhr. Am 15. Juni 2051.
2051! Das hieß ...
Er hatte fast genau zwei Jahre verschlafen. Zwei Jahre!
»Positronik«, murmelte er schwach. Es brauchte zwei Versuche, bis sie auf ihn reagierte.
»Ja, Sir?«
»Wo sind alle? Ich brauche einen Arzt ...«
»Unzureichende Informationen. Das temporäre Notprotokoll ist in Kraft.«
»Das Notprotokoll?«
Die Positronik gab keine Antwort.
Er beschloss, sich mit eigenen Augen ein Bild zu machen.
Langsam, ganz langsam, setzte er die Füße auf den Boden. Der Boden war kalt, aber nicht schmerzhaft kalt. Er nahm sich Zeit mit dem Aufstehen. Seine Beine hatten ihn zwei Jahre lang nicht mehr getragen ...
Seine Beine gaben nach.
»Positronik«, sagte er wieder. »Ich benötige einen Rollstuhl.«
»Wünschen Sie, dass eine robotische Pflegekraft Ihnen einen Rollstuhl bringt?«
»Ja!«, schnappte Moncadas und zog sich mit letzter Kraft auf das Bett zurück.
Eine Minute später hörte er draußen auf einem Flur ein Surren. Etwas stieß gegen die halb geöffnete Tür und schob sie auf. Ein kleiner, weißer Roboter mit einer freundlich runden Plastikverkleidung kam ins Zimmer gerollt. Mit seinen kleinen Kinderarmen stieß er einen Rollstuhl vor sich her.
Etwas mit dem Roboter stimmte nicht. Erst konnte Moncadas es nicht richtig erkennen. Dann, sobald der Roboter den Rollstuhl abstellte und neben ihn fuhr, sah Moncadas, was ihn gestört hatte: Der Roboter hatte eine leichte Schieflage und einen Fleck auf der Schulter, der aussah wie getrockneter Kaffee. Außerdem hatte jemand mit einem dicken, schwarzen Stift ein großes X über jedes seiner Augen gemalt.
»Sie baten um einen Rollstuhl, Sir.«
»Danke!«, erwiderte Moncadas. »Ist alles in Ordnung mit dir?«
Der Roboter stieß ein leises Roboterlachen aus, bei dem es Moncadas eiskalt den Rücken hinunterlief. Wer baute solche Maschinen?
»Alles bestens, Sir. Wie geht es uns heute?«
»Das weiß ich noch nicht. Besser, nehme ich an.« Vorsichtig ließ er sich in den Rollstuhl sinken. »Ich habe Durst.«
Der Roboter rollte zum Waschbecken und brachte ihm eine Tasse Wasser, die Moncadas in großen Schlucken leerte.
»Jemand hat mir mit gesprochen«, sagte er.
»Es ist niemand hier«, stellte der Roboter fest.
»Was soll das heißen, es ist niemand hier? Dies ist doch ein Krankenhaus?«
»Ja, Sir.«
»Das TMC?«
»Terrania Medical Center, sehr wohl, Sir.«
»Wo sind dann alle?«
»Das temporäre Notprotokoll ist in Kraft.«
»Was bedeutet das?«
Der Roboter lachte höflich und gab keine Antwort.
Moncadas hatte den starken Verdacht, dass wer immer dieses Notprotokoll verfügt hatte, nicht damit gerechnet hatte, dass es jemals zum Tragen kam.
Oder dass dann noch irgendwer lebte, der dumme Fragen stellte.
Was war nur passiert?
Mit schwachen Bewegungen seiner Arme stieß sich Moncadas zum Fenster. Er sah den Park mit seinen weiten Straßen und dahinter die Silhouette zweier Gebäude. Ein Ausschnitt der weitläufigen Anlage des TMC. Am Fuß eines Baums lag der weiße Kittel eines Arztes am Boden. Eine umgestürzte Gehhilfe lehnte an einer Bank. Sonst war der Park verlassen.
Niemand war in den anderen Fenstern zu sehen. Keine Wagen fuhren zwischen den Gebäuden. Keine Flugzeuge flogen am Himmel.
Auf einmal bekam es Moncadas mit der Angst zu tun, doch er wusste nicht mehr, wovor er eigentlich Angst hatte.
»Ich muss hier raus«, rief er und rollte ungeachtet der Schmerzen in seinen Armen zur Tür. »Aus dem Weg!«, herrschte er den Roboter mit den durchgestrichenen Augen an. »Verschwinde!«
Der Roboter gehorchte und gab die Tür frei. Moncadas zwängte sich hinaus und rollte über einen verlassenen Flur.
Man hatte sich keine Mühe mehr gemacht, ihn aufzuräumen.
Kleine Rollwagen mit kaltem Essen standen in den Ecken. Zwei Fliegen saßen am Rand einer Suppenschale. Die Suppe war dick, geronnen, kurz davor, Schimmel anzusetzen.
Weiter hinten im Flur lagen Pads und Krankenakten aus Mehrwegpapier über den Boden verstreut. Hinter einer Rezeption stapelte sich durcheinandergeworfene Bettwäsche. Es sah aus, als hätte sich dort jemand ein Lager gebaut.
Ein Kommunikationsterminal blinkte. Monk rollte näher. Es zeigte dreiundzwanzig verpasste Anrufe, aber keine Nachricht.
Er glaubte, etwas zu hören.
»Ist da wer?«
Keine Antwort. Vielleicht hatte er sich auch getäuscht ...
Mit großen Augen rollte Moncadas durch die verlassene Klinik. Er sah keine Spuren für einen Kampf, aber etwas hatte die Ärzte gezwungen, das Krankenhaus aufzugeben. War es vielleicht zu einem Seuchenausbruch gekommen?
Schweiß trat auf seine Stirn.
Aus den Schildern an den Fahrstühlen und an den Kreuzungen schloss er, dass er sich auf einer Station für Langzeitpatienten befand. Die Türen waren alle angelehnt. Er warf einen Blick in die anderen Zimmer und sah zerwühlte Betten, vergessene Taschen, achtlos hingeworfene Kleider.
Es sah nicht so aus, als wären die Leute hastig geflohen. Eher wirkte es, als sei es ihnen einfach nicht mehr wichtig gewesen, ihre Sachen mitzunehmen.
Manchmal glaubte er, den Klang ferner Schritte zu hören – Schritte, die sich rasch entfernten. Doch wann immer er die nächste Ecke erreichte, fand er den Gang verlassen vor, also tat er es für den Moment als Einbildung ab.
Im letzten Zimmer, das er probierte, fand er eine Patientin. Es war eine alte Frau mit dünnem, grauem Haar und eingefallener Haut. Sie hing an einem Tropf, so wie zuvor auch er, und hatte eine Atemmaske auf dem Gesicht. Dieselben Geräte wie in seinem Zimmer wachten über ihren Schlaf.
Erschöpft verharrte er in der Tür, nahm den Anblick in sich auf. Er war also nicht der Einzige, den man zurückgelassen hatte.
Wie viele Menschen wie sie lagen noch auf den Zimmern? Warteten auf die Rückkehr der Ärzte, auf Hilfe, auf eine Erklärung? Er streckte seine geistigen Fühler aus, suchte nach einem Informationsfluss, der ihm Antwort geben könnte ...
»Monk!«, sagte die Stimme.
Es war dieselbe Stimme, die ihn geweckt hatte. Es war nicht die Stimme der Frau in ihrem Bett. Es war eine männliche Stimme, und sie kam von überall zugleich und nirgends.
»Monk ...«
»Ich bin nicht Monk!«, brüllte er. »Mein Name ist Moncadas! Josue Moncadas!«
»Monk«, wiederholte die Stimme. »Moncadas ...« Wie Echos, wie Wellen auf einem Teich breitete sich die Stimme immer weiter aus, im Rhythmus seiner Namen: »Monk ... Moncadas ...«
Moncadas schrie, wendete den Rollstuhl und fuhr hinaus auf den Flur, versuchte, der Stimme zu entkommen, doch sie hallte nicht durch die Flure. Sie hallte in seinem Verstand.
»Ich ... bin ... nicht ... Monk!«, knirschte er, mit Tränen in den Augen. Er hatte keine Kraft mehr. Er hatte Angst, dass er wahnsinnig wurde oder es bereits war. Er hatte Angst ...
»Wo bist du?«, fragte die Stimme. »Was ist passiert?«
»Wo ich bin?«, echote Moncadas. »Was passiert ist?« Dass diese unheimliche Stimme, die ihn fast um den Verstand brachte, sich dieselben Fragen stellte wie er, schien fast schlimmer als alles andere. »Geh weg!«, schrie er. »Lass mich allein!«
Völlig entkräftet ließ er sich ausrollen. Seine Arme schmerzten von der ungewohnten Anstrengung. Er schluchzte. Er war beinahe gestorben, aus zwei Jahren Koma erwacht. Doch das, was er hier erlebte, war ein Albtraum. Der alte Monk hätte vielleicht geglaubt, dass er im Fegefeuer wieder aufgewacht war, um für seine Sünden zu büßen ...
Und er hatte recht gehabt, wurde ihm da klar: Monk, der religiöse Fanatiker, der er einst gewesen war, hatte recht gehabt. Dies war das Ende aller Tage. Nur die Auserwählten überlebten. Das Ende ...
Sein Kopf sackte auf die Brust.
Er hörte, wie sich ein Surren näherte. Er schaute auf und sah den Roboter mit den durchgestrichenen Augen.
»Sie sind erschöpft«, merkte der Roboter an.
Moncadas gab keine Antwort.
»Sie sollten schlafen«, riet der Roboter.
Moncadas nickte schwach.
Der Roboter rollte hinter ihn. Langsam, mit aufheulendem Getriebe, schoben die kleinen Kinderarme ihn zurück in sein Zimmer.
Schlafen, dachte Moncadas. Der Gedanke war trostreich. Einfach nur schlafen ...
Seine Lider schlossen sich.
Vielleicht ist es ja das, was mit den Leuten passiert ist, dachte er noch. Vielleicht sind einfach alle nach Hause gegangen, um zu schlafen ...
Teil I
Die schlaflose Stadt
1.
Leyle
Das Gebrüll der Bestie erschütterte den Stardust Tower. Es ließ den Staub auf den zerschlagenen Tischen hüpfen. Es ließ die Scheiben in den Fenstern erzittern und ging ihr durch Mark und Bein.
Die Bestie, dachte Leyle, doch es fiel ihr schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Sie wusste aus Erzählungen ungefähr, was eine Bestie war. In jedem Fall wusste sie, was ein Haluter war – sie hatte Fancan Teik gekannt. Eine der faszinierendsten Lebensformen, die sich jemals von ihr hatten untersuchen lassen: ungeheuer effizient, enorm widerstandsfähig – und extrem gefährlich.
Eine Bestie war all das, nur weitaus schlimmer. Eine Bestie – diese Bestie – hatte Fancan Teik getötet: auf der Welt, die man danach Teiks Grab getauft hatte. Von daher konnte Leyle sich lebhaft vorstellen, was das Fremdwesen mit ihnen allen anstellen würde, wenn sie nicht rechtzeitig entkamen.
Beim ersten Schrei dieser lebenden Kampfmaschine hatten Leyles Beine sie davongetragen, kaum dass sie wusste, wie ihr geschah. Es war, als ob der Laut ihren Körper auf einer unterschwelligen, rein biologischen Ebene anspräche. Der Laut war Gefahr. Der Laut war Angst. Sie schämte sich dafür – denn als Ärztin sollte sie keine Angst empfinden. Sie sollte zuerst für andere da sein. Doch es bedurfte aller Kraft, die sie noch aufzubieten vermochte, stehen zu bleiben und zurückzusehen.
Der Stardust Tower, Regierungssitz Terranias und stolze Bodenstation des Weltraumfahrtstuhls zu Terrania Orbital, war nur noch eine Trümmerwüste, ein verheertes Schlachtfeld durchbrochener Wände, geborstener Türen, umgestürzter Einrichtungsgegenstände und grausig zugerichteter Opfer. Sie hatten sich mit klopfendem Herzen in Richtung der fünfzigsten Etage vorgearbeitet und sich gefragt, was für diese schreckliche Zerstörung verantwortlich war. Nun kannten sie die Antwort: Es war ein einziges Wesen – die Bestie Masmer Tronkh.
»Frank?«, rief Leyle. »Professor?« Als müsste sie gegen eine starke Strömung ankämpfen, setzte sie mühsam einen Schritt vor den anderen, zurück in die Richtung, aus der sie gekommen war. Zurück zu ihren Gefährten, die noch irgendwo dort vorne sein mussten.
Das ohrenbetäubende Gebrüll ertönte ein weiteres Mal, und diesmal erkannte sie eindeutig, dass es nicht bloß ein Schrei, sondern ein Name war: Rhodans Name. Die Bestie brüllte Rhodan.
Und da, als hätte sich ein Schalter in ihr umgelegt, schlugen Leyles Gefühle von Angst zu Ärger um. Was hatte dieses Biest für ein Problem mit Rhodan? Und wieso, verdammt, war Rhodan nicht hier, sodass sein Problem nun zu ihrem wurde?
Ihre Schritte beschleunigten sich. Als besäße sie einen Extrasinn, wie die Arkoniden ihn hatten, sah sie sich selbst erstaunt dabei zu, was sie da tat. Wieso um alles auf der Welt lief sie der Gefahr entgegen? Sie konnte das wirklich gut, ihren Verstand ausschalten und sehenden Auges in ihr Verderben laufen. Die Jahre bei den Menschen hatten ihr offensichtlich schwer zugesetzt ...
Zum Glück wurde ihr Mut auf keine weitere Probe mehr gestellt. Gerade spähte sie um die nächste Ecke, als ihr Frank Haggard, Professor Ephraim Oxley und Jason D. Whistler bereits entgegengestolpert kamen.
»Leyle!«, rief Haggard verängstigt, aber sichtlich erfreut, sie zu erblicken.
»Los, schnell raus hier! Nur raus!«, keuchte der Professor und rannte sie fast über den Haufen.
Leyle ließ sich nicht zweimal bitten.
Gemeinsam taumelten sie den Flur in Richtung des nächstgelegenen Antigravschachts entlang, während ein oder zwei Stockwerke über ihnen die Bestie tobte und ihr Vernichtungswerk an den Büros der Regierungsvertreter vollzog.
Was tut die Bestie da eigentlich?, fragte sich Leyle unwillkürlich. Es klang, als hüpfte sie wie ein wütendes Kind auf und ab, ein Kind von mehreren Tonnen Körpergewicht. In blindem Zorn hieb Tronkh auf Wände, Böden und Decke ein, und der Flur, durch den sie flohen, zitterte unter jedem Schlag. Was glaubte er, mit dieser Aktion zu bezwecken?
Angst und Schrecken verbreiten, gab sie sich selbst die Antwort. Vielleicht sollte man von einer außer Kontrolle geratenen Killermaschine nicht allzu viel Logik erwarten. Vielleicht, dachte sie mit einem Anflug von Hoffnung, hatte Tronkh die Eindringlinge noch nicht bemerkt.
»Hier lang!«, rief der junge Whistler, der von allen in der Gruppe der Schnellste war, auch wenn er in seinem Leben sicher mehr Zeit vor dem Computer als auf dem Sportplatz verbracht hatte.
»Der Antigravschacht funktioniert doch nicht!«, protestierte Haggard. Auch er war ungeachtet seiner mehr als sechzig Jahre gut in Form; jahrelanges Rugbyspiel hatte den Australier abgehärtet.
Und von der Wirbelsäulenverletzung, die ich ihm behandelt habe, keine Spur, dachte Leyle nicht ohne Stolz.
»Egal!«, schnaufte Oxley, ein paar Jahre jünger als Haggard, doch seines Zeichens leider ebenso brillant wie übergewichtig – man sah ihm an, wie sehr ihm jedes seiner Pfunde zu schaffen machte. »Wir haben keine Zeit zu verl...«
Der Rest seines Satzes ging in einem neuerlichen Beben unter, als die Bestie irgendwo in ihrem Rücken – ganz in der Nähe! – durch die Decke brach.
Da erkannte die Ärztin, wie naiv ihre Hoffnung auf ein heimliches Entkommen gewesen war.
»Wir schaffen das!«, beharrte Whistler und starrte in den Antigravschacht, der nur vom dumpfroten Licht der Notbeleuchtung erhellt wurde. Ein Warnhinweis klärte sie darüber auf, dass das Antigravitationsfeld auf diesem Stockwerk zusammengebrochen war. Die letzten drei Etagen hatten sie die Treppe nach oben genommen. »Die Sicherungssysteme weiter unten werden uns abfangen. Na los!«
Wie ein unsicherer Schwimmer auf einem Sprungturm trat er in den Abgrund und ließ sich in den Schacht fallen. Eine kurze Schrecksekunde lang verweigerten Leyles Beine ihr den Dienst, dann nahm ein neuer, urweltlicher Schrei ihr die Entscheidung ab, und sie folgte ihm. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass Haggard und Oxley es ihr gleichtaten. Angst war ein starker Antrieb.
Fast zehn Meter stürzte sie im freien Fall und konnte einen Aufschrei nicht unterdrücken. Dann tauchte sie in den Bereich der Schwerelosigkeit ein, die normalerweise im ganzen Schacht herrschte. Natürlich hieß das, dass sie zwar nicht weiter beschleunigte, aber noch immer mit beinahe fünfzig Stundenkilometern an den Stockwerken vorbeifiel.
Dann griffen die automatischen Sicherheitssysteme, die erkannten, wenn ein Passagier den Schacht unsachgemäß benutzte, und bremsten sie auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit ab. Einen Moment drehte sich ihr der Magen um, im nächsten hatte sie schon das Ende des Schachts erreicht.
Über ihr ertönte ein Geräusch, als bräche der Turm entzwei. Leyle hob den Kopf und erblickte die Bestie.
Tronkh war durch die Wand des Schachts gestoßen wie ein riesenhafter, dunkler Bohrkopf, der sich quer in einen Tunnel schob, ein grobschlächtiger, sechsgliedriger Albtraum, der nun wild um sich schlagend in einem Regen aus Stahlbeton und Plastikteilen den Schacht herabstürzte, während ringsum aus der Verkleidung Funken schlugen. Entweder die Bestie hatte die Sicherheitssysteme zerstört oder sie war schlicht zu schwer dafür – in jedem Fall raste sie ungebremst auf Leyle und ihre Begleiter zu.
»Schnell raus!«
Sie schafften es gerade noch, den Schacht im Erdgeschoss zu verlassen, bevor hinter ihnen die Bestie vorbeischoss und Sekundenbruchteile später in den Kellergeschossen mit der Wucht eines rasenden Lastkraftwagens ins Fundament einschlug.
Mit klopfendem Herzen schauten sie einander an. Oxley war kreidebleich – der füllige Hyperphysiker war am Ende seiner Kräfte. Sein Schnauzbart zitterte, Schweiß stand auf seiner Stirn, und der Neurostreamdimmer an seinen Schläfen drohte ständig zu verrutschen.
Auch Whistler wirkte überfordert. Wie der junge Mann selbst eingeräumt hatte: Die Wirklichkeit war schrecklicher als die virtuellen Spiele, in denen er sich vielleicht mehr zu Hause fühlte.
»Weiter!«, drängte Haggard die erschöpfte Gruppe. »Wir müssen den Quadrokopter erreichen, ehe dieses Monster uns erwischt!«
Schon drang ein Grollen und Poltern aus der Tiefe zu ihnen herauf. Leyle spürte das Adrenalin in ihren Adern, fand schlagartig zu neuer Kraft.
Sie rannten den Flur im Erdgeschoss entlang zum Ausgang. Einst war dies ihr Arbeitsplatz gewesen – im Terrania Central, dem ersten Krankenhaus der Stadt, hatte sie zu Zeiten des Protektorats ihren Dienst versehen, ehe so vieles anders wurde und sie schließlich die Leitung des frisch gegründeten Terrania Medical Centers übernahm.
Sie erreichten die verheerte Empfangshalle, die sie schon auf dem Herweg passiert hatten. Nun war auch klar, was sich wie ein Panzerwagen Einlass in den Stardust Tower verschafft und die Türen ins Innere geschleudert hatte. Wahrscheinlich hatten sie die Bestie nur knapp versäumt. Sie war in den Stardust Tower eingebrochen, hatte sich in die höheren Stockwerke vorgearbeitet und offensichtlich nicht gefunden, was sie gesucht hatte.
Das Einzige, was Tronkh mittlerweile entdeckt hatte, waren Leyle und ihre Gefährten.
Sie stürzten nach draußen auf den verlassenen Vorplatz. Die heiße Sommerluft Terranias schlug ihnen entgegen. Voraus lag der glitzernde Goshunsee, in der anderen Richtung der ehemalige Fürsorgerpalast, nun Hauptsitz der General Cosmic Company. Die Stadt dazwischen lag wie ausgestorben. Leyle sah bereits die Ecke, hinter der sie den Quadrokopter gelandet hatten, und schöpfte neue Hoffnung.
Sie hatten die halbe Strecke zum Kopter zurückgelegt, als hinter ihnen ein schallender Lärm erklang, bei dem sich Leyle die feinen Härchen ihrer Arme aufstellten. Als Medizinerin kam sie nicht umhin, den Vorgang mit Interesse zu registrieren – Aras verfügten nur über sehr wenig Körperbehaarung, und dieses den Menschen so geläufige Phänomen war in Leyles eigener Kultur nur unzureichend dokumentiert.
Dann begriff sie, dass Masmer Tronkh gelacht hatte. Und sie gestattete sich einen Blick zurück.
Die Bestie saß vor dem Eingang des Stardust Towers wie ein übergroßer, muskelbepackter Wachhund. Ihre Haut war im Tageslicht von einem dunklen Türkis, fast metallisch, eine Echsenfarbe. Der Höllenlärm aus ihrer Kehle klang wie das hämische Schnappen einer Schrottpresse.
Sie genießt es!, dachte Leyle. Sie hat es nicht eilig. Sie will ihren Spaß mit uns!
»Los, voran!«, scheuchte Oxley Whistler vor sich her, der wieder mit seiner Cyberbrille hantierte. »Dafür ist jetzt keine Zeit!«
»Vielleicht kann ich uns eine Ablenkung verschaffen!«, widersprach der junge Ingenieur und stolperte weiter. Schon kamen seine Überwachungsdrohnen, die vor dem Stardust Tower auf seine Rückkehr gewartet hatten, aus dem Himmel herangesaust.
Wie auf ein Signal hin sank die Bestie auf ihre mittleren Gliedmaßen herab, machte einen gewaltigen Satz die Stufen vor dem Tower herab und galoppierte auf allen vieren auf sie die Fliehenden zu, während sie mit den Vorderarmen mühelos Whistlers Drohnen aus der Luft schlug. Sie zerplatzten wie altes Geschirr.
»Das war die Ablenkung?«, höhnte der Professor.
»Die Selbstzerstörung der Drohnen hätte mehr Energie freisetzen sollen«, keuchte Whistler. »Aber sie haben kurz vorher noch einen Notruf abgesetzt. Vielleicht bekommen wir Hilfe ...«
Leyle wünschte, sie könnte daran glauben. Whistlers Einfallsreichtum in allen Ehren – sie mussten dieser verzweifelten Lage so schnell wie möglich entkommen, sonst kam jede Hilfe zu spät.
Sie bogen um die Ecke und sahen vor sich den Quadrokopter. Doch noch ehe sie ihn erreichen konnten, flog ein großer, dunkler Schatten über sie hinweg. Die Bestie war aus dem Anlauf sicher fünfzig Meter weit gesprungen. Nun schlug sie in die Wand des nächstgelegenen Gebäudes, stieß sich ab, setzte abermals über Leyles Gruppe hinweg und landete direkt neben der Flugmaschine. Das breite Maul mit den Kegelzähnen grinste ihnen höhnisch entgegen. Darüber drohten drei riesige, rote Augen in dem finsteren Mondgesicht.
Panik erfasste Leyle. Fast wäre sie gestolpert, doch Frank Haggard packte sie am Arm.
Die Bestie hob eine Faust und ließ sie auf den Kopter niedersausen. Die Maschine brach unter dem Hieb entzwei wie eine Wellblechhütte. Die Bestie ließ abermals ihr infernalisches Lachen ertönen.
In diesem Moment kamen zwei Drohnen der Terra Police angeflogen. Leyle wusste weder, woher sie kamen, noch, wie sie bislang der Außerdienststellung durch die neuen Herren der Stadt entgangen waren oder weshalb sie ausgerechnet nun ausrückten. War der Notruf von Whistlers Flugsonden doch vernommen worden?
Die Polizeidrohnen umkreisten den Kopf der Bestie wie zwei tumbe, riesenhafte Hummeln und redeten aus ihren Lautsprechern sturköpfig auf Masmer Tronkh ein.
»Sie gefährden die öffentliche Sicherheit in diesem Bereich. Stellen Sie Ihre Aktivitäten umgehend ein, und ergeben Sie sich! Wiederhole, ergeben Sie sich! Hände über den Kopf!«
Das Grinsen im Gesicht der Bestie wurde breiter, während sie langsam erst ein, dann ein weiteres Armpaar hob. Auch das war ein Spiel – die Drohnen stellten keine Gefahr für sie dar.
Was hätte Leyle in diesem Augenblick nicht für die militärischen Systeme gegeben, die zu Zeiten des Protektorats noch durch die Straßen patrouilliert waren. In Terrania aber herrschten starke Vorbehalte gegenüber einer Maschinenherrschaft, wie Kritiker es nannten. »Terrania – eine Stadt für die Menschen!«, lautete das oft gehörte Motto.
Die Bestie pflückte sich eine der Drohnen aus der Luft und steckte sie sich ins Maul.
»Los!«, flüsterte Haggard.
Da erwachten seine Begleiter endlich aus ihrer Starre und rannten zurück Richtung Tower.