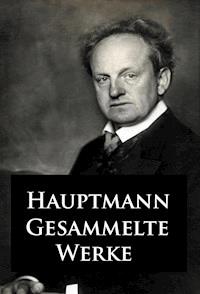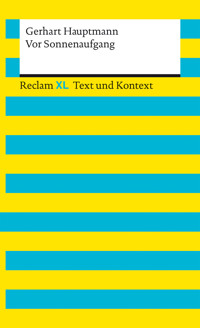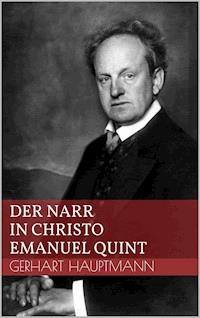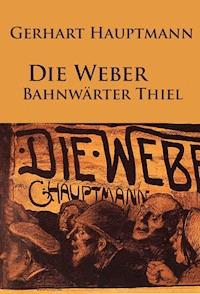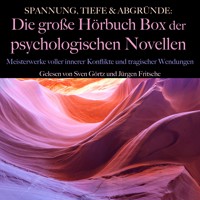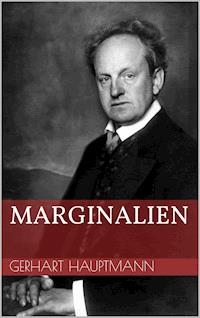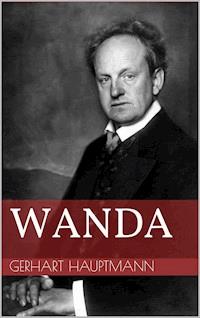Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wundersamerweise gehört dieses Buch zu den unbekannteren Werken Hauptmanns, obwohl es Spannung bis zum Schluss verspricht! Lorenz Lubota ist in seinem Leben voller Armut nie etwas Aufregendes widerfahren. Das ändert sich als er die 13-jährige Veronika, die aus einer wohlhabenden Familie stammt, trifft und Gefühle für sie entwickelt. Wissend, dass er ihr nichts bieten kann, setzt er alles daran, um sie für sich zu gewinnen - mit verheerenden Folgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhart Hauptmann
Phantom - Aufzeichnungen eines ehemaligen Sträflings
Saga
Phantom - Aufzeichnungen eines ehemaligen Sträflings
Coverbild/Illustration: Thanks to hanen souhail @hanenphotography for making this photo available freely on Unsplash
https://unsplash.com/photos/7YBFVqN3uwo
Copyright © 1922, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726956559
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Phantom
Meine Frau hat mir das kleine Zimmerchen in der Frontspitze eingerichtet, darin sitze ich nun. Gegenüber rauscht der Dorfbach unter Eschen und Weiden. Ich höre unter mir die Schelle des Kramlädchens, das meine Frau versorgt. Es geht gut und ernährt uns vollkommen bei bescheidenen Ansprüchen.
Ich werde aber noch etwas anderes anfangen müssen. Erstlich bleibt mir freie Zeit, alsdann habe ich geistige Bedürfnisse. Übrigens ist mir sehr wohl, und ich fühle mich wie in Abrahams-Schoss.
Ich rauche Pfeife. Das kostet mich so gut wie nichts, denn wir haben den Knaster im Kramladen. Rauchen belebt die Phantasie. Es macht zugleich ruhig. Ich gewinne zum Beispiel dadurch die Fähigkeit, gleichzeitig einen Zustand angenehmer Musse zu empfinden und mit der Feder meine Gedanken aufzuzeichnen. „Schreibe doch,“ sagt übrigens meine Frau, „es kann ja möglicherweise ein Buch daraus werden.“
Ich schreibe alles ganz einfach so hin, was mir durch die Seele geht.
Wenn es mir übrigens gelänge, ein Buch zu machen, warum sollte ich nicht auch ein zweites, ein Drittes schreiben können? Dann wäre ich Schriftsteller. Auf die natürlichste Weise hätte ich dann die gesuchte Nebenbeschäftigung gefunden.
Dieses Haus, das mein Schwiegervater vor einem halben Jahr gekauft hat mitsamt dem Kramlädchen, hat ja auch der Witwe eines ähnlichen Menschen gehört. Sie hiess Frau Wander. Wander war Schullehrer und hatte wegen gewisser Ansichten seinen Posten aufgeben müssen. Er fand nach langem Umherirren, wie ich, dies Asyl und darin sein Auskommen. Seine Lebensarbeit, die er möglicherweise in demselben Zimmer begonnen und vollendet hat, ist ein fünfbändiges deutsches Sprichwörterlexikon.
*
Ich bin hier vorläufig unbekannt. Meine Frau und mein Schwiegervater haben dies Dörfchen im Hirschberger Tale ausgesucht, weil sie nicht wollten, dass immerfort Anlass gegeben würde, über meine „Irrfahrten“ zu reden, aber auch aus dem Grunde, um mich aus einer Umgebung zu bringen, die auf Schritt und Tritt in mir Erinnerungen wecken und wachhalten müsste.
Da fällt mir ein: bin ich nicht eben dabei, ihre Absicht zu durchkreuzen?
Ja und nein.
Wenn ich hier über mein Schicksal nachdenke, einen Überblick meiner Vergangenheit zu gewinnen suche und mich bemühe, alles mir Denkwürdige mit Wahrhaftigkeit aufzuzeichnen, so ist dies unter anderem der Versuch, mich aus dem Banne der Erinnerungen freizumachen, und ganz etwas anderes, als unfreiwillig wieder in ihren Bann zu geraten, was wahrscheinlich in Breslau geschehen würde.
Ich wünsche die Stadt nie wiederzusehen.
Vielleicht würde man nach Geschehnissen, wie ich sie hinter mir habe, nicht mehr leben können, wenn nicht alles Vergangene tatsächlich unwirklich wäre. Vergangenes wirkt nun einmal in keinem Falle mehr mit der Kraft der Wirklichkeit. Ich muss mit grosser Gelassenheit, Geduld und Sorgfalt vorgehen, wenn ich die einzelnen Umstände meines grossen Erlebnisses überhaupt noch in meinem Geiste Hervorrufen will. Die letzten natürlich sind die lebendigsten, während alle die, welche vor meinem Eintritt ins Zuchthaus liegen, weit weniger deutlich und trotzdem weitaus wichtiger sind.
*
Ich habe sechs Jahre, vier Monate und einundzwanzig Tage im Zuchthause gesessen. Das ist eine harte Tatsache, die ich lieber gleich hinsetzen will. Es wäre mir mehr als unangenehm, Leser durch ihr Verschweigen erschlichen zu haben, wenn wirklich einmal aus meinem traumhaft entschwundenen Erlebnis ein fertiges Buch geworden sein sollte. Es bleibt dann Tatsache und werde hiermit ausdrücklich betont, dass sein Verfasser im Zuchthaus gesessen hat.
*
Ich würde diese Zeilen ganz gewiss nicht schreiben, ja ganz gewiss nicht mehr leben, wenn nicht meine heutige Frau Marie, geborene Starke, gewesen wäre. Starke ist ein verbreiteter Name. Es liegt aber nahe, der Wahrheit gemäss zu sagen, dass meine heutige Frau nicht nur Starke heisst, sondern eine Starke ist, obgleich sie rein äusserlich ein sanftes und freundliches Wesen auszeichnet. Mein Schwiegervater war Buchbinder. Ist seine Tochter stark gewesen, so hat sie an ihm noch ausserdem und jederzeit eine starke Stütze gehabt.
Mein Schwiegervater ist achtzig Jahr. Er verkauft unten im Laden. Er ist ein bewunderungswürdiger Mann.
Wir haben hier im Dorf einen seltsamen Schulmeister: getaufter Jude, Dr. Levin. Sein Vater war in Berlin Bankier, und sehr wohlhabend. Man sagt, dass Dr. Levin auf den grössten Teil seines Vermögens zugunsten seiner Geschwister verzichtet hat. Er war Staatsanwalt und sollte zum Oberstaatsanwalt avancieren, als er absprang und nach entsprechender Vorbereitung sich hier als Volksschullehrer anstellen liess. So konnte er, wie er sagt, sein soziales Gewissen beruhigen. Aus Gefälligkeit bindet mein Schwiegervater für Dr. Levin noch hie und da Bücher ein.
Ich habe Dr. Levin gelegentlich dies und das aus meiner Vergangenheit mitgeteilt. Er bestärkt mich darin, es aufzuschreiben.
Er hat ein behagliches Arbeitszimmer im Giebel des Schulhauses eingerichtet. Als ich ihm neulich einige Bücher gebunden zurückbrachte, hielt er mich fest. Ich musste mit ihm eine Zigarre rauchen und Kaffee trinken. Da habe ich ihm das Bild gezeigt.
Meine Frau weiss von dem Bilde nichts.
Ich habe dies Bild von Melitta erhalten.
Als nämlich meine Beziehung zu Melitta in voller Blüte stand, hatte ich ihr in einer vertraulichen Stunde meine Schwäche für Veronika Harlan, die Eisenhändlerstochter, mitgeteilt. Melitta war gutartig. Eines Tages liess sie sich photographieren und sah im Atelier des Photographen dies Bild. Es war ihr nicht schwer, ihn zu überreden, es ihr abzulassen, da sie das Kinderköpfchen darauf so überaus schön fände. Auch Dr. Levin fand es überaus schön.
Es ist schön, jawohl, doch hat es Gott sei Dank keine Gewalt mehr über mich.
*
„Keine Gewalt mehr über mich.“
Diese Behauptung muss modifiziert werden.
Heute bin ich mit Gottes Hilfe ein kerngesunder. Mann. Diese Gesundheit habe ich in den Jahren der völligen Einsamkeit in meiner Gefängniszelle und in der Folgezeit erlangt, wo ich durch Freundlichkeit des Direktors in der Anstaltsbibliothek beschäftigt wurde. Ich konnte da auch meine Bildung vervollständigen.
Da ich kerngesund bin, hat das Bildchen keine Gewalt mehr über mich. Als das Urbild dieses Bildchens seine Gewalt über mich antrat, war ich achtundzwanzig Jahre alt und, weil kränklich von Kindesbeinen an, dem Wesen nach älter. Von Jugend auf bin ich kränklich gewesen, sagte ich; wirklich krank wurde ich ungefähr in meinem zweiundzwanzigsten Jahr. Ich hustete viel und hatte dabei mehrere Jahre lang jedesmal Blut im Taschentuch. Das hatte sich übrigens verloren, als meine seelische Krankheit begann.
Man sagt, dass die früher sogenannte Auszehrung, also das Lungenleiden, das Liebesleben steigere. — Aber darauf kann ich vielleicht später zurückkommen. Es ist übrigens eine Angelegenheit der ärztlichen Wissenschaft, festzustellen, inwieweit Körper auf Seele zu wirken vermag.
Soviel glaube ich sagen zu können, dass, als der Funke in meine Seele fiel, sich in Seele und Körper ein ungeheurer Brennstoff angesammelt hatte.
Was war das nun für ein Funke und von welcher Herkunft war dieser Funke? Da hätte ich nun die Wahl, ihn entweder aus himmlischem oder aus höllischem Feuer bestehen zu lassen, seine Herkunft aus Himmel oder Hölle abzuleiten. Eigentlich, wenn ich noch in der Tage wäre, mit diesen Begriffen zu operieren, hätte ich keineswegs die Wahl. Da nämlich aus diesem Funken ein wahrer Hallenbrand entstanden ist, könnte ein Christ niemals zugeben, es sei ein himmlischer Funke gewesen. So hat es denn auch der Anstaltsgeistliche, Pastor Walkmüller, einen höllischen Funken genannt und es dann natürlich sehr leicht gefunden, alle schrecklichen Folgen für mich und andere aus dieser Brandstiftung des Satans abzuleiten.
Eine solche Vereinfachung würde der Wahrheit, die mein Zweck ist, nicht dienlich sein.
Ich habe soeben das Bild der dreizehnjährigen Eisenhändlerstochter wiederum aufmerksam betrachtet und muss sagen, dass es von berückendem Liebreiz ist. Jungfrau, Mutter, Königin! würde der Altmeister sagen. Schlechterdings ein Gnadenbild. Es würde nicht wundernehmen, wenn man von nah und fern zu ihm wallfahrtete.
Ein rechtgläubiger Katholik könnte einwenden: der Teufel habe sich wohl auch gelegentlich in seiner List sogar der ahnungslosen Mutter Gottes bedient, um Seelen ins Verderben zu locken.
Wenn ich also sagte: das Bild hat keine Gewalt mehr über mich, so meine ich, es hat im Sinne des Missbrauches durch den Teufel keine Gewalt mehr über mich.
*
Ich will den Satan hiermit verabschieden, ihn nochmals zu bemühen, wird, wie ich hoffe, nicht nötig sein.
Ich bin einfach durch einen Brand gleichsam in Asche gelegt worden, weil ich dem Einbruch des göttlichen Feuers gegenüber, nach meinem Maulwurfsdasein, völlig wehrlos gewesen bin.
Insofern aber, als dieses Bildchen der Abglanz des göttlichen Feuers ist, hat es noch heute Gewalt über mich und wird sie bis an mein Ende behalten.
Ich habe Veronika Harlan zuerst erblickt, als ich, ein armer Magistratsschreiber, eines Mittags wie gewöhnlich nach Hause ging. Vor dem Breslauer Rathaus steht die Staupsäule. Es sind Ringe daran, an denen das Kind sich zu schaffen machte. Man schrieb den achtundzwanzigsten Mai, ein Datum, das ich aus vielen Gründen begreiflicherweise nicht vergessen kann. Trotzdem die Passanten aufmerksam wurden, konnte die Gouvernante das Interesse des Kindes nicht von der Staupsäule ablenken. Sie versuchte mehrmals, das auffällig schöne Geschöpf mit dem offenen safrangelben Haar von den Stufen herabzulocken. Es gelang ihr nicht. Ich weiss nur, dass mir der Hut vom Kopfe flog — es hatte mich jemand angestossen —, und wie das Kind Deshalb in ein unwiderstehlich herzliches Lachen geriet.
Ohne das Erlebnis dieses Augenblicks würde ich wahrscheinlich noch heute bürgerlich unbescholten sein, und es wäre mir Leiden über Leiden erspart geblieben. Aber ein Sprichwort, freilich kein deutsches, aus der Sammlung des ausgezeichneten Wander, sagt: Noch das eigene Leiden ist einem teurer als fremdes Glück! Und wenn ich gefragt würde, ob ich an jenem Morgen das scheinbar so harmlose, doch so folgenschwere Erlebnis lieber nicht gehabt hätte, so müsste ich antworten:
Ich will lieber mein Leben als dieses Erlebnis hergeben.
*
Dieses Bekenntnis würde meinen ehemaligen Richtern mit dem Ausdruck tiefster Verstocktheit, einem Mann von Weltverstand mit dem Ausdruck höchster Narrheit gleichbedeutend sein. Lebe ich so lange und behalte ich Luft und Fähigkeit, bis alles gesagt ist, was ein rundes und vollkommenes Bekenntnis rund und vollkommen macht, und lesen es dereinst meine Richter, so könnte es sein, dass sie ihre Meinung ändern. Sie werden vielleicht erkennen, wie schief, wie lückenhaft, wie unwahr mein in den Protokollen befindliches Geständnis im Grunde ist. Dagegen wird der Mann von Weltverstand, der mich schon jetzt für närrisch erklärte, seine Meinung am Schlusse für bestätigt erachten. Ich selbst, sofern ich über meine Aufgabe nachdenke, obenhin nachdenke allerdings, kann nicht umhin, sie darin zu sehen, die Geschichte eines Dummkopfes, eines Narren und eines Verbrechers ineinander zu flechten.
Freilich hoffe ich, indem ich dies tue, mich über den Dummkopf, den Narren und den Verbrecher erheben zu können — oder sagen wir, alle drei abzuschütteln.
*
Um etwas von meiner Herkunft zu sagen.
Mein Vater war Zollkontrolleur, er hatte die Kontrolle der Schnapsbrennereien unter sich. Bei diesen Gelegenheiten wurde er viel traktiert, und war eines Tages zum ausgesprochenen Potator geworden.
Da er selten zu Haus war, von Berufs wegen herumreisend und auf Gasthäuser angewiesen, ging neben den Diäten der grösste Teil seines Einkommens drauf. Hätte ihn nicht zur rechten Zeit Der Schlag getroffen, hätte man ihn möglicherweise aus dem Amt gejagt, und Mutter hätte die Pension eingebüsst. Mehrmals hatte sie bereits Fehlbeträge der Kasse gedeckt, wozu sie einmal die nötige Summe bei Tante Schwabe, was eine saure Arbeit war, erbetteln musste.
Das Leben meiner Mutter war schwer.
Durch den Vater vollkommen enttäuscht, fast vollkommen verlassen und vollkommen unglücklich gemacht, hielt sie sich, wie es in solchen Fällen geht, an die Kinder. Sie hatte zwei Söhne und eine Tochter. Ich war der Älteste. Solange mein Bruder und meine Schwester, die jüngste unter uns, Kinder waren, ging es soweit ganz gut. Als sie das siebzehnte, achtzehnte Jahr überschritten hatten, zeigte es sich, dass man sich an sie durchaus nicht weiter halten konnte. Das war zu der Zeit, als meine Mutter bereits im fünften Jahr Witwe war.
Es bestand immer ein ganz besonders gutes Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir. Wann es begonnen hat, weiss ich nicht. Ich glaube, sehr früh. Es bestand bereits, als ich merkte, dass mich mein Vater nicht leiden konnte. Da er auch meist mit meiner Mutter im Kampfe lag, schloss ich mich naturgemäss an sie an.
Ich vermag nicht zu sagen, wann ich ihr erklärter Liebling wurde. Es muss schon vor dem Tod des Vaters gewesen sein. Sie nannte mich damals schon oft ihren einzigen Trost. Später, als ich bei einem Rechtsanwalt Schreiber geworden war und ihr jeden Ersten das volle Gehalt in ihre Hände legte, hörte ich sie nicht selten sagen, dass ich ihre einzige Stütze sei.
Die Wohnung, welche wir nach dem Tode des Vaters bezogen, lag im ersten Stock eines altertümlichen Häuschens der Taschenstrasse. Wir haben sie bis zum Eintritt der Katastrophe, also etwa acht Jahre lang, innegehabt. Sie war sehr Klein, sehr dunkel, aber trotzdem nicht unbehaglich. Solche altväterische Bürgerhäuschen mit ihren kleinen Fenstern und niedrigen Stuben haben meist einen grossen Reiz. Ich dachte nichts anderes, als dass ich gemeinsam mit meiner Mutter Diese Gelasse bis ans Ende unserer Tage bewohnen würde.
Ich nahm in dem kleinen Haushalt die Stelle des Vaters, die Stelle des Hausherrn ein. Bedeutend älter als meine Geschwister, war ich schon darum für sie eine Autorität. Es wurde mir aber überdies bei jeder Gelegenheit in Gegenwart der Geschwister die väterliche Gewalt über sie von der Mutter attestiert. Sie fiel auch darum an mich, weit ich lange Zeit der einzige Verdiener war. Als mein Bruder und meine Schwester gelegentlich ebenfalls etwas verdienten, haben sie doch niemals auch nur einen roten Heller an meine Mutter abgeführt.
Die väterliche Gewalt habe ich meines Wissens niemals missbraucht.
Aus Schonung für meine Lungen und meinen Kehlkopf hatte ich mir eine leise Sprechweise angewöhnt. Sie ist mir zur zweiten Natur geworden. Deutlich steht es mir noch vor der Seele, wie bei der Verhandlung mir mehrere unter den Herren Geschworenen: ,,Lauter! Lauter!“ zuriefen. Diese verhaltene Sprechweise habe ich im Verkehr mit meinen Geschwistern, auch wenn ich sie zu ermahnen oder zurechtzuweisen hatte, nie zu beschleunigen oder verstärken brauchen. Ich darf sagen, ich genoss bei ihnen eine mit Bewunderung gemischte Achtung, eine so unbeschränkte Autorität, wie sie selbst mein Vater niemals besessen hatte.
„Du solltest Lehrer werden, besser, du hättest sollen Lehrer werden“, sagte meine Mutter zuweilen, wenn sie bemerkte, wie ich mir mit meinen Geschwistern Mühe gab und ihnen Geschichtszahlen, Bibelsprüche und dergleichen abhörte. Ich unterliege gewiss keiner Selbsttäuschung, wenn ich mir das Zeugnis ausstelle, dass ich ihnen in der Tat ein allzeit bereitwilliger und geduldiger Berater, Helfer und Lehrer gewesen bin. Auch fand ich wirklich am Lehren Gefallen.
Als die Mutter wieder einmal ihr „Du hättest sollen Lehrer werden“ gesagt hatte, kam mir der Gedanke, ob dies nicht am Ende, ich war damals fünfundzwanzig Jahre, jetzt noch möglich sei. Der Gedanke belebte, ja begeisterte mich, sofern man irgendeinen der weniger gedrückten Seelenzustände, dessen ich damals fähig war, als Begeisterung bezeichnen kann. Binnen kurzer Zeit hatte ich genügend Auskünfte eingeholt, benützte zum erstenmal einen Teil des Gehaltes zum Bücherkauf und begann mich, jede dienstfreie Stunde benützend, auf das Mittelschullehrerexamen vorzubereiten.
Bis dahin hatte ich in einem Zustand natürlicher Resignation, ohne zu denken, vor mich hingelebt. Während ich Englisch, Französisch und die übrigen Fächer trieb, winters und sommers in meinem kleinen behaglichen Zimmerchen, dessen Tür sich auf eine Holzgalerie des Höfchens öffnete, tat ich zum ersten Male etwas, das einer wirklichen eigenen Initiative entsprang. Deshalb hatte ich dabei ein besonderes Wohlgefühl und fühlte mein Selbstbewusstsein wachsen.
Ich habe des doppelten Knochenbruches noch nicht erwähnt, den ich leider einmal als Kind erlitt. Mein Vater hatte eine bei meinem sanften, zur Unterordnung neigenden Wesen kaum sehr angebrachte militärische Art, mit mir zu verkehren. Klang der Name Lorenz, so hiess ich nämlich, von seiner Stimme gesprochen durchs Haus, so verlor ich fast immer alle Besinnung. In einem solchen Zustand eine Treppe herunterhastend, rutschte ich aus und brach das Bein. Die Knochen wurden von einem Pfuscher schlecht zusammengeleimt, so dass das betroffene Bein kürzer wurde. Um den Schaden zu heben, wurde es von einem anderen Pfuscher gewaltsam nochmals gebrochen, worauf es schliesslich, nach der Heilung, noch kürzer geworden war. Ich hinke seitdem, und das hat besonders damals nicht wenig auf meine Lebensführung eingewirkt. Aus begreiflichen Gründen mied ich die Spiele der Kinder, an denen ich mich bis dahin leidenschaftlich beteiligt hatte, und wandte mich stillen Beschäftigungen zu, am liebsten im Zimmer und überall dort, wo niemand anderes zugegen war.
Ich glaube, ich habe erst während der Untersuchungshaft wirklich denken gelernt und den Segen des eigenen Denkens empfunden. Ein Anfang dazu war indessen gemacht, als ich den Beschluss gefasst hatte, auf den Lehrerberuf hinzuarbeiten und, wie gesagt, war ein zweifellos erhöhtes Selbstbewusstsein die wohltätige Folge davon.
*
Uberhaupt war das begonnene Selbststudium für mich in jeder Beziehung wohltätig, und ich denke an die dabei verbrachten Stunden mit Vergnügen zurück. Das weiss meine Frau und hat darum auch dieses Zimmer dem, worin ich damals meine Studien trieb, so ähnlich als möglich zu machen gesucht. Der alte Kachelofen, an den ich mein Arbeitstischchen gerückt hatte, war schokoladenbraun. Vielleicht auf Rat meines Schwiegervaters hat sie mir diesen ganz ähnlichen, an dem nun das alte Tischchen wiederum steht, setzen lassen. Unterrichtsbriefe erstand ich mir lieferungsweise. Ich schaffte mir nach und nach auch die übrigen unumgänglichen Lehrbücher an. Meine Mutter schwankte dabei zwischen Besorgnis und Billigung. Ihr Vater war ein wohlsituierter Bürger Breslaus, seines Zeichens Kürschner, und die letzten vier Jahre vor seinem Ende sogar Stadtrat gewesen. Nun hatte sie zwar in jeder Beziehung resigniert, aber es schmeichelte doch ihrem Selbstgefühl, in mir nun nicht mehr den elenden Schreiber eines Rechtsanwalts, sondern den künftigen Mittelschullehrer zu sehen. Andererseits machte sich der Ausfall an Wirtschaftsgeld empfindlich bemerkbar, den sie infolge der Bücherkäufe erlitt. Später, als mein Interesse für Literatur und also auch für Bücher sich über den Rahmen meines Lehrerpensums hinaus entwickelte und ich Reclam-Heftchen und auch etwas kostspieligere Klassikerausgaben zu kaufen begann, habe ich Mutter manchmal in Tränen gefunden, und ich hatte viel Mühe, sie zu trösten und zu beruhigen. Ich konnte sie allerdings nie davon überzeugen, dass das Geld, für nicht zum Examen unbedingt gehörige Bücher ausgegeben, nicht weggeworfen sei.
Unnütz zu sagen, dass durch Schiller und Goethe mein Gesichtskreis erweitert, meine Vorstellungswelt unendlich bereichert wurde. Aber meine damals beginnende, von meiner Mutter so sehr beklagte Schwäche für Bücher hat insofern einen nicht hoch genug zu bewertenden anderen Vorteil für mich gehabt: ohne sie hätte ich meinen Schwiegervater und meine jetzige Frau niemals kennengelernt, und ich glaube, ich habe schon ausgesprochen, ich würde in diesem Fall nicht mehr leben.
*
Ich weiss noch genau, wie erschrocken ich war, als eines Tages Marie Starke zu mir ins Zimmer trat und mir den von ihrem Vater frisch gebundenen Uhland brachte. Sie ist ebenso alt wie ich, und wir waren damals beide vierundzwanzig Jahre. Sie kam ohne Hut, hatte schlicht gescheiteltes dunkles Haar, braune Augen und trug um die Schultern ein blaues Tuch. Unsere Lebenslagen hatten eine gewisse Ähnlichkeit, insofern ich meiner Mutter den Versorger und sie ihrem verwitweten Vater die Hausfrau zu ersetzen hatte. Ihr Äusseres hatte schon damals etwas Frauliches. Sie glich einer hübschen jungen Frau.
Erschrocken war ich, weil ich damals vor Frauen eine ganz unbegreifliche Scheu hatte. Ausser meiner Mutter, meiner Schwester und, nicht zu vergessen, Tante Schwabe hatte ich weder Frau noch Mädchen kennengelernt. Ich habe natürlich gelegentlich in Verkaufsläden mit Inhaberinnen und Verkäuferinnen Worte gewechselt, aber das ist eine Sache, die an dem vorher erwähnten Umstand nichts ändert. Selbst mit Dirnen habe ich, weniger aus Keuschheit als aus Furcht, nie etwas zu tun gehabt. Schliesslich war es ja auch viel zu kostspielig.
Marie Starke hatte eine sehr natürliche, unbefangene und offene Art. Ich war selber angenehm überrascht davon, wie schnell ich Furcht und Befangenheit los wurde. Ich habe vergessen, was etwa bei ihrem ersten Besuch zur Sprache kam. Sie erkannte jedenfalls bald, dass meine vornehmste Sorge ebenso meine Mutter, wie ihre vornehmste Sorge der Vater war: Sie vergötterte förmlich ihren Vater, wie ich meine Mutter beinahe wirklich vergötterte.
In diesen Beziehungen trafen wir uns.
Wir freuten uns auch über manche andere Gemeinsamkeit und seltsamerweise darüber, dass wir beide nicht heiraten wollten und unseren Beruf Sarin sahen, ich meine Mutter und sie ihren Vater bis an ihr und sein Lebensende zu pflegen.
*