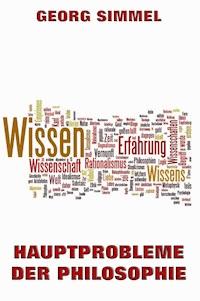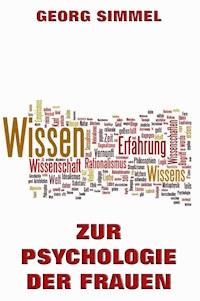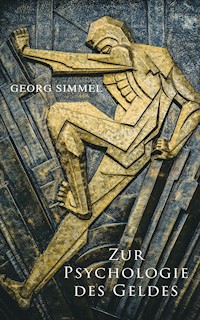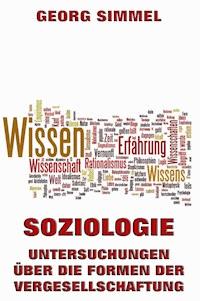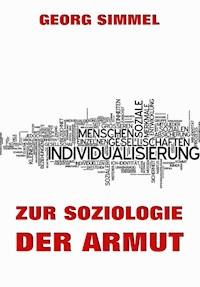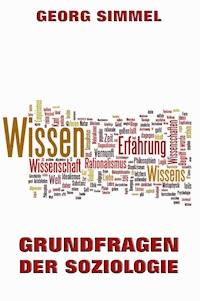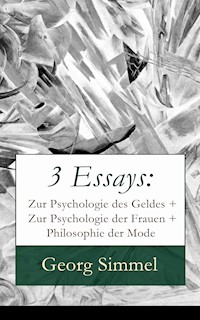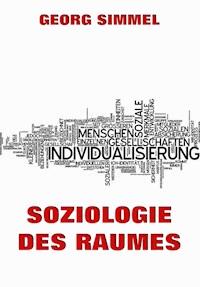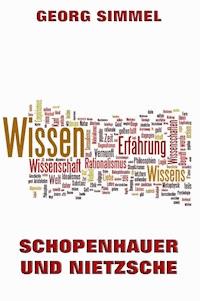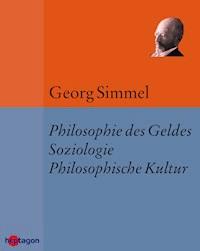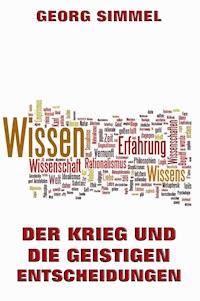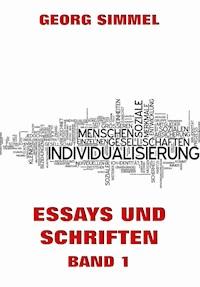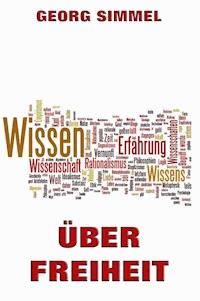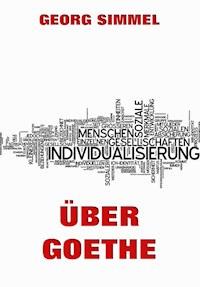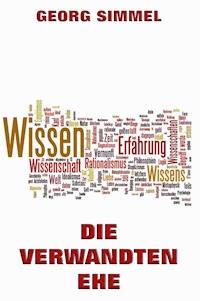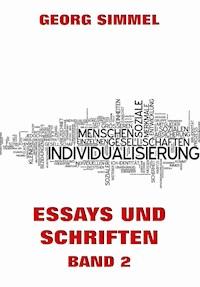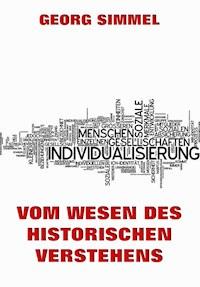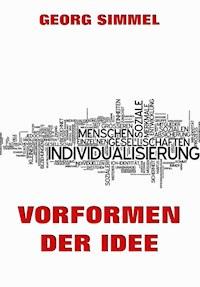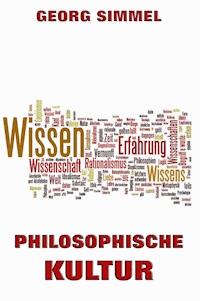
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Band beinhaltet die folgenden Essays: Einleitung Das Abenteuer Die Mode Das Relative und das Absolute im Geschlechter-Problem Die Koketterie Der Henkel Die Ruine Die Alpen Michelangelo Rodin - mit einer Vorbemerkung über Meunier Die Persönlichkeit Gottes Das Problem der religiösen Lage Der Begriff und die Tragödie der Kultur Weibliche Kultur
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philosophische Kultur
Georg Simmel
Inhalt:
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Philosophische Kultur
Einleitung
Das Abenteuer
Die Mode
Das Relative und das Absolute im Geschlechter-Problem
Die Koketterie
Der Henkel
Die Ruine
Die Alpen
Michelangelo
Rodin - mit einer Vorbemerkung über Meunier
Die Persönlichkeit Gottes
Das Problem der religiösen Lage
Der Begriff und die Tragödie der Kultur
Weibliche Kultur
Philosophische Kultur, Georg Simmel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849617103
www.jazzybee-verlag.de
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Geb. 1. März 1858 in Berlin, gest. 26. September 1918 in Straßburg.
S. verbindet die psychologisch-genetische, evolutionistische mit einer logisch-idealistischen, an Kant und Hegel orientierten, vielfach »dialektischen« Betrachtungs- und Denkweise. Das Erkennen enthält apriorische Faktoren, die aber (als Kategorien) eine Entwicklung durchmachen, nicht unverändert bleiben. Alle Formen und Methoden des Erkennens haben sich im Verlaufe der menschlichen Geistesgeschichte entwickelt und entwickeln sich weiter, so aber, daß das Erkennen eine formende, gesetzgebende Aktivität des Geistes bleibt, welche aus dem Chaos der Erlebnisse erst einen sinnvollen, verständlichen, einheitlichen Zusammenhang gestaltet. Die Kategorien usw. stammen aus »der dem Geiste eigenen Fähigkeit, zu verbinden, zu vereinheitlichen«, können aber als historische Gebilde die Totalität der Weltinhalte nie völlig adäquat aufnehmen. Das Ich hat die Funktion der Einheitsetzung, das Streben zur Einheit. Die Wahrheit ist, rein logisch, etwas Zeitloses, Absolutes, vom subjektiven Denken Unabhängiges, sie gehört dem »dritten Reich«, dem »Reich der ideellen Inhalte« an; diese Inhalte sind wahr, gleichviel ob sie gedacht werden oder nicht. Das Geistige bildet inhaltlich einen geschlossenen Zusammenhang, den unser individuelles Denken unvollkommen nachzeichnet. Die ideellen Inhalte sind nicht, sie gelten, sie sind nicht mit den psychologischen Vorgängen zu verwechseln. Anderseits hat die Wahrheit auch eine biologisch-evolutionistische Seite. Wahr sind hier jene Vorstellungen, die, als reale Kräfte in uns wirksam, »uns zu nützlichem Verhalten veranlassen« (vgl. James). Durch Selektion haben sich bestimmte Vorstellungen als wahr erhalten, nämlich jene, »die sich als Motive des zweckmäßigen, lebenfördernden Handelns erwiesen haben« (vgl. Nietzsche). »Die Nützlichkeit des Erkennens erzeugt zugleich für uns die Gegenstände des Erkennens.« Es gibt so viele prinzipielle »Wahrheiten«, als es verschiedene Organisationen und Lebensanforderungen gibt. Das Objektive und Wahre bedeutet die »gattungsmäßige Vorstellung«.
Auch in der Ethik verbindet S. die genetisch-relativistische Betrachtungsweise betreffs der empirischen Einzeltatsachen mit einem gewissen Apriorismus und Idealismus. So ist das Sollen etwas Ursprüngliches und Objektives, als eine Forderung, die mit der Sache selbst gegeben ist, als ein »in dem Verhältnis von Seele und Welt präformiertes Sollen, das einer besonderen, aber nicht weniger übersubjektiven Logik unterliegt, wie das Sein«. Unser Bewußtsein empfindet Forderungen an sich, die es durch den Willen realisieren kann. Das Sollen schlechthin ist eine »Urtatsache«, eine »ursprüngliche Kategorie«, mag auch der Inhalt des Sollens noch so wechseln und sozial-historisch bedingt sein. Tatsächlich sind es immer »historische Zustände der Gattung, die in dem Einzelnen zu triebhaftem Sollen werden«. Der »Wille der Gattung« kommt in uns zum Ausdruck, kündigt sich imperativisch an. Ein ungeheurer Teil der an uns gestellten Ansprüche ist sozialen Inhalts, ohne daß dadurch die Unbedingtheit des idealen Sollens überhaupt, die »innere Logik ideeller Ansprüche« beeinträchtigt wird. Das sittlich Gute besteht nicht im Anstreben des Glücks u. dgl. (gegen den Eudämonismus), sondern es ist eine »unmittelbare Qualität und Lebensform des Willensprozesses«. Etwas ist gut, weil und wofern es Inhalt eines an sich guten Willens ist. Die moralischen Imperative sind »Ausmündungen, Ausformungen, Substantialisierungen des guten Willens«. Die Sittlichkeit liegt nicht im Material des Willens, sondern in diesem selbst, in dessen Funktion. Das Ideal des sittlichen Verhaltens liegt im Unendlichen. Das Sollen kann sich an den verschiedensten Inhalten verwirklichen; die Einheit des Zieles ist nicht notwendig, es genügt die Einheit der psychologisch-ethischen Funktion, die den Zweck trägt. Ursprünglich ist das sozial Erforderte die Norm des Verhaltens der Einzelnen. Den »kategorischen Imperativ« Kants kritisiert S. nach der Richtung der Versöhnung des Individualismus mit der Allgemeinheit des Handelns. Das Gewissen ist nach S. gleichsam ein »rückwärts gewandter Instinkt«; es ist die.Lust oder Unlust der Gattung über die Tat, die in uns zum Ausdruck kommt. Der Altruismus ist ebenso primär wie der Egoismus, er ist »Gruppenegoismus«, ein vererbter Instinkt. Sehr oft. »machen die Motivierungen unserer Handlungen... an Punkten Halt, die völlig und definitiv außerhalb unser selbst liegen«. Auch enthält das Ich noch eine Fülle von Motiven außer dem »Glück«. – Die Freiheit des Willens bedeutet, daß sich der Charakter des Ich ungehindert im Wollen ausprägen kann, das Vermögen, das für uns wertvolle Wollen realisieren zu können. Freiheit ist »Selbstbestimmung«, sie ist zugleich, weil das Ich nur so sein kann, wie es ist, Notwendigkeit. Die Verantwortlichkeit ist nicht aus der Willensfreiheit abzuleiten, sondern umgekehrt: »Derjenige ist frei, den man mit Erfolg verantwortlich machen kann.« Zurechnungsfähig ist jemand, wenn die strafende Reaktion auf seine Tat bei ihm den Zweck: der Strafe erreicht.
Die Grundfrage der Geschichtsphilosophie ist die: wie ist Geschichte möglich? Geschichte ist nur durch Kategorien, apriorische Verbindungsformen möglich, sie ist kategorial verbreitete Wirklichkeit und daher hat die Geschichtsphilosophie die »Aprioritäten festzustellen und zu erörtern, durch welche aus dem Erleben... Geschichte als Wissenschaft wird«. Die Kompliziertheit des historischen Geschehens gestattet nicht die Aufstellung eigener historischer Gesetze, wenn auch das Historische auf (biologisch-psychologischen) Gesetzmäßigkeiten beruht. Das ganze Spiel der Geschichte ist die Folge, Erscheinung oder Synthese dieser primären Gesetzmäßigkeiten, geht aber nicht aus einem besonderen Gesetz hervor.
Die Soziologie ist die »Wissenschaft vom Gesellschaftlichen als solchen, von den Formen der Vergesellschaftung, von den Beziehungsformen der Menschen zueinander«. Die Soziologie ist keine Universalwissenschaft vom Menschen u. dgl., sondern eine besondere Methode; sie abstrahiert vom Inhalt des Gesellschaftlichen, achtet nur auf dieses, wie der Mathematiker etwa nur auf die geometrische Form, nicht auf das Material der Körper achtet. Die Soziologie, hat die »Kräfte, Beziehungen und Formen zum Gegenstand, durch die die Menschen sich vergesellschaften«, sie ist die »Lehre von dem Gesellschaft-Sein der Menschheit«. »Gesellschaft im weitesten Sinne ist offenbar da vorhanden, wo mehrere Individuen in Wechselwirkung treten. Die besonderen Ursachen und Zwecke, ohne die natürlich nie eine Vergesellschaftung erfolgt, bilden gewissermaßen den Körper, das Material des sozialen Prozesses; daß der Erfolg dieser Ursachen, die Förderung dieser Zwecke gerade eine Wechselwirkung, eine Vergesellschaftung unter den Trägern hervorruft, das ist die Form, in die jene Inhalte sich kleiden.« Solche Formen sind Über- und Unterordnung, Konkurrenz, Arbeitsteilung usw.; wichtig sind besonders auch die kleinen, flüchtigen Wechselwirkungen von Person zu Person. Die sozialen Verbindungen erwachsen aus bestimmten Trieben oder Willenstendenzen (Zielen), sind etwas Psychisches, aber nichts Psychologisches, denn die Soziologie hat es nicht mit psychologischen Vorgängen, sondern mit Inhalten solcher zu tun, mit Kombinationen soziologischer Kategorien, mit etwas Sachlichem. Es gibt keinen Gesamtgeist, wohl aber eine seelische Beeinflussung der Individuen durch ihre Vergesellschaftung. In der Gesellschaft herrscht Arbeitsteilung und Differenzierung, verbunden mit Integrierung, indem jede Befreiung zu einer neuen Bindung führt. Die Religion wurzelt in den Gesamttendenzen der Persönlichkeit und ihrer Beziehung zum All.
SCHRIFTEN: Das Wesen der Materie nach Kants physischer Monadologie, 1881. – Über soziale Differenzierung, 1890; 3. A. 1906, – Einleit. in die Moralwissenschaft, 1892-93; 2. A. 1901. – Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 1892; 2. A. 1905; 3. A. 1907. – Philosophie des Geldes, 1900; 2. A. 1907. – Vorlesungen über Kant, 1904; 2. A. 1905. – Die Religion, 1906. – Schopenhauer u. Nietzsche, 1906. – Soziologie, 1908. – Hauptprobleme der Philosophie, 1910. – Das Problem der Soziologie, Schmollers Jahrbücher, Bd. 18, 1894. – Skizze einer Willenstheorie, Zeitschr, f. Psychol. d. Sinnesorgane, Bd. 9, – Beitrag zur Erkenntnistheorie der Religion, Zeitschr. f. Philos., Bd. 118. – Über eine Beziehung der Selektionslehre zur Erkenntnis, Archiv f. systemat, Philos., 1895. – Über die Grundfrage des Pessimismus, Zeitschr. f. Philos., Bd. 90. – Zur Psychologie der Frau, Zeitschr. f. Völkerpsychol, 1890, u. a.
Philosophische Kultur
Einleitung
Wenn Versuche zusammengefasst dargeboten werden, die wie die folgenden, ihrem Stoffe nach keinerlei Einheit besitzen, so kann das innere Recht dazu nur in einer Gesamtabsicht liegen, welche alle inhaltliche Mannigfaltigkeit übergreift.
Hier nun geht eine solche von dem Begriff der Philosophie aus: dass ihr Wesentliches nicht oder nicht nur der Inhalt ist, der jeweils gewusst, konstruiert, geglaubt wird, sondern eine bestimmte geistige Attitüde zu Welt und Leben, eine funktionelle Form und Art, die Dinge aufzunehmen und innerlich mit ihnen zu verfahren.
Indem die philosophischen Behauptungen unvereinbar weit auseinander liegen und nicht eine von ihnen unbestrittene Geltung besitzt; indem dennoch etwas Gemeinsames in ihnen gespürt wird, dessen Wert alle Anfechtung der einzelnen überlebt und den philosophischen Prozess weiter und weiter trägt, kann jenes Gemeinsame nicht in irgendeinem Inhalt, sondern nur in diesem Prozess selbst liegen.
Das mag freilich als Grund, den Namen der Philosophie allen Entgegengesetztheiten ihrer Dogmen zu belassen, selbstverständlich sein.
Aber nicht ebenso selbstverständlich ist es, dass auf diesem Funktionellen, auf dieser gleichsam formalen Bewegtheit des philosophierenden Geistes das Wesentliche und Bedeutsame der Philosophie ruhen soll, mindestens neben den dogmatisch ausgedrückten Inhalten und Resultaten, ohne die freilich der philosophische Prozess als solcher und abgelöster nicht verlaufen kann.
Solche Trennung zwischen der Funktion und dem Inhalt, dem lebendigen Vorgang und seinem begrifflichen Ergebnis bedeutet eine ganz allgemeine Richtung des modernen Geistes.
Wenn die Erkenntnistheorie, oft zum allein verbleibenden Gegenstand der Philosophie erklärt, den reinen Prozess des Erkennens von all seinen Objekten löst und analysiert; wenn die kantische Ethik das Wesen aller Moral in die Form des reinen oder guten Willens verlegt, dessen Wert selbstgenugsam und frei von aller Bestimmung durch Zweckinhalte bestünde; wenn für Nietzsche und Bergson das Leben als solches die eigentliche Wirklichkeit und den letzten Wert bedeutet, nicht durch irgendwelche, gleichsam substanziellen Inhalte bestimmt, sondern diese erst seinerseits schaffend und ordnend - so ist mit alledem jene Lösung zwischen Prozess und Inhalt und die selbständige Akzentuierung des ersteren vollzogen.
So nun kann man den metaphysischen Trieb, den Prozess oder die Geisteshaltung, die ihm entfließen, als einen Charakter oder einen Wert erfassen, der durch alle Widersprüche und Unhaltbarkeiten seiner Inhalte oder Ergebnisse nicht betroffen wird.
Und, prinzipiell von der starren Verbindung mit diesen gelöst, gewinnt er eine Biegsamkeit und Erstreckungschance, eine Unpräjudiziertheit gegenüber allen möglichen Inhalten, wie sie undenkbar waren, als man noch das Wesen von Philosophie oder Metaphysik aus ihren gegenständlichen Problemen bestimmen wollte. Begreift man das Funktionelle, die Einstellung, Tiefenrichtung und Rhythmik des Denkprozesses als das, was diesen zum philosophischen macht, so sind seine Gegenstände von vornherein unbegrenzt und gewinnen an jener Gemeinsamkeit der Denkart oder Denkform eine Einheit für die inhaltlich heterogensten Untersuchungen, diejenige Einheit, die die hier vorgelegten für sich in Anspruch nehmen.
Die geschichtliche Erfahrung zeigt, dass jedes Festlegen der metaphysischen Gerichtetheit auf einen systematischen Inhalt ungeheure kosmische und seelische Gebiete jenseits der philosophischen Deutung und Vertiefung belassen hat; und dies nicht nur als Folge der immer nur relativen Leistungsfähigkeit jedes absoluten Prinzips, sondern vor allem seiner Starrheit und Unplastizität, die das Einbeziehen der unscheinbaren Segmente des Daseinskreises in die metaphysische Tiefe ausschließt.
Dieser Bewegung sollte sich doch keine auch der flüchtigsten und isoliertesten Oberflächenerscheinungen des Lebens entziehen dürfen; aber zu keinem einzelnen metaphysischen Grundbegriff scheint eine Richtlinie von jedem derartigen Phänomen herabzuführen.
Soll der philosophische Prozess wirklich von der universellen Breite des Daseins ausgehen, so scheint er vielmehr in unbegrenzt vielen Richtungen laufen zu müssen.
Manche Erscheinungen, manche Stimmungen, manche Verknüpfungen des Denkens weisen die philosophische Reflexion in eine Direktive, die, bis ins Absolute verfolgt, ein Pantheismus wäre, manche umgekehrt in die Richtung des Individualismus; manchmal scheint diese Reflexion in einem idealistischen, manchmal in einem realistischen, hier in einem rationalen, dort in einem voluntaristischen Definitivum enden zu müssen.
Es besteht also ersichtlich eine innerlichste Beziehung zwischen der ganzen Fülle des gegebenen Daseins, das der philosophischen Tiefenschicht zugeführt zu werden verlangt, und der ganzen Fülle möglicher metaphysischer Absolutheiten.
Das flexible Gelenk zwischen beiden, die mögliche Verbindung, um von jedem Punkte des einen zu jedem des andern zu gelangen, wird von jener, auf keine Absolutheit festgelegten Bewegtheit des Geistes dargeboten, die in sich selbst metaphysisch ist.
Nichts hindert sie, die angedeuteten und viele andern Wege abwechselnd zu begehen, in solcher Hingebung an die metaphysische Funktion nun gerade den Symptomen der Dinge selbst treuer und schmiegsamer, als die Eifersucht einer materialen Ausschließlichkeit gestattete.
Die Forderung des metaphysischen Triebes wird nicht erst am Ende dieser Wege eingelöst, ja der ganze Begriff von Weg und Ziel, der die Illusion eines notwendig einheitlichen Schlusspunktes mit sich bringt, ist hier unzutreffend und nur ein Missbrauch räumlicher Analogien; nur damit sozusagen die Qualitäten jener Bewegtheiten einen Namen hätten, mögen ihnen die absoluten Prinzipien als ideelle Zielpunkte vorstehen.
Ein Widerspruch besteht zwischen ihnen nur in der dogmatischen Kristallisierung, nicht aber innerhalb der Bewegtheit des philosophischen Lebens selbst, dessen individueller Weg ein einheitlicher und personal charakterisierter sein kann, durch wie viele solcher Biegungen und Krümmungen er auch führe.
Von Eklektizismus und Kompromissweisheit ist dieser Standpunkt im allertiefsten geschieden.
Denn beide sind nicht weniger an den festgewordenen Resultaten des Denkens verankert, als irgendeine einseitig exklusive Philosophie; nur dass sie die gleiche Form, statt durch einen prinzipiellen Gedanken, durch ein Mosaik von Stücken solcher ausfüllen oder deren Gegensätze graduell bis zur Verträglichkeit herabsetzen.
Hier aber handelt es sich um die ganz prinzipielle Wendung von der Metaphysik als Dogma sozusagen zu der Metaphysik als Leben oder als Funktion, nicht um die Art des Inhalts der Philosophie, sondern um die Art ihrer Form, nicht um die Verschiedenheiten zwischen den Dogmen, sondern um die Einheit der Denkbewegung, die all diesen Verschiedenheiten so lange gemeinsam ist, bis sie eben an einem Dogma erstarren und sich damit die Rückkehr zu den Schnittpunkten aller philosophischen Wege und also zu dem Reichtum aller Bewegungs- und Umfassungsmöglichkeiten abschneiden.
Nun ist kein Zweifel, dass von den genialen Schöpfern innerhalb der Geschichte der Philosophie wohl keiner diese Akzentverlegung von dem terminus ad quem der philosophischen Bestrebung auf ihren terminus a quo zugeben würde.
Bei ihnen ist die geistige Individualität so stark, dass sie sich nur in ein dem Inhalt nach völlig und einseitig bestimmtes Weltbild projizieren kann, und dass der Radikalismus der formalen philosophischen Lebensattitüde mit diesem Inhalt unlösbar und intolerant in eins schmilzt; so bedeutet zwar die Religiosität aller wirklich religiösen Menschen ein immer gleiches Sein und inneres Verhalten, das aber im Individuum, und zwar insbesondere in dem religiös schöpferischen, mit einem bestimmten, eben diese Individualität ausprägenden Glaubensinhalt zu so organischer Einheit wird, dass für diesen Menschen eben nur dieses Dogma Religion sein kann.
Wird sich also die individuelle Wesensart des produktiven Philosophen als solchen auch immer in einer absoluten, anderes ausschließenden Weltkonzeption niederschlagen - was übrigens neben dem prinzipiellen Anerkenntnis jener Akzentverlegung der Metaphysik geschehen könnte - so erscheint mir die letztere jedenfalls als die Bedingung einer "philosophischen Kultur" in einem weiteren und modernen Sinne. Denn diese besteht doch nicht in der Kenntnis metaphysischer Systeme oder dem Bekenntnis zu einzelnen Theorien, sondern in einem durchgehenden geistigen Verhalten zu allem Dasein, in einer intellektuellen Bewegtheit auf die Schicht hin, in der, in mannigfaltigsten Tiefengraden und angeknüpft an die mannigfaltigsten Gegebenheiten, alle überhaupt möglichen Linien der Philosophie laufen - wie eine religiöse Kultur nicht in der Anerkennung eines Dogmas, sondern in der Auffassung und Gestaltung des Lebens mit dem steten Hinblick auf das ewige Schicksal der Seele besteht, künstlerische Kultur nicht in der Summe einzelner Kunstwerke, sondern darin, dass die Inhalte des Daseins überhaupt nach den Normen künstlerischer Werte empfunden und geformt werden.
Verbleibe die Philosophie in ihrem inneren Gange auch in der Diskontinuität dogmatischer Parteiung, so liegen doch, wie diesseits und jenseits dieser, zwei Einheitlichkeiten: die funktionelle, von der ich zuerst sprach, und diese teleologische, für die die Philosophie ein Träger, ein Element oder eine Form der Kultur überhaupt ist.
Beide Einheitlichkeiten sind gleichsam unterirdisch verbunden; die philosophische Kultur jedenfalls muss sich labil erhalten, muss von jeder singulären Theorie auf die funktionellen Gemeinsamkeiten aller zurücksehen und zurückgehen können. Die Ergebnisse der Bemühung mögen fragmentarisch sein, die Bemühung ist es nicht.
Von dem Interesse an dieser philosophischen Haltung überhaupt ist die Bearbeitung und Zusammenfassung der Probleme dieses Bandes ausgegangen.
Nachzuweisen, wie gerade ihre Vereinzeltheit und Heterogenität diesen Grundbegriff der philosophischen Kultur trägt oder von ihm getragen wird, ist nicht mehr Sache des Programms, sondern der Arbeit selbst. je nach dem genommenen Blickpunkt ruht sie auf der Voraussetzung oder führt den Beweis: es sei ein Vorurteil, dass die Vertiefung von der Oberfläche des Lebens her, das Aufgraben der je nächsten Ideenschicht unter jeder seiner Erscheinungen, das, was man deren Sinngebung nennen könnte - notwendig auf einen letzten Punkt führen müsse und haltlos in der Luft schwebe, wenn es nicht von einem solchen her seine Richtung bekäme.
In einer Fabel sagt ein Bauer im Sterben seinen Kindern, in seinem Acker läge ein Schatz vergraben. Sie graben daraufhin den Acker überall ganz tief auf und um, ohne den Schatz zu finden.
Im nächsten Jahre aber trägt das so bearbeitete Land dreifache Frucht. Dies symbolisiert die hier gewiesene Linie der Metaphysik.
Den Schatz werden wir nicht finden, aber die Welt, die wir nach ihm durchgraben haben, wird dem Geist dreifache Frucht bringen - selbst wenn es sich in Wirklichkeit etwa überhaupt nicht um den Schatz gehandelt hätte, sondern darum, dass dieses Graben die Notwendigkeit und innere Bestimmtheit unseres Geistes ist.
Das Abenteuer
Jedes Stück unseres Tuns oder Erfahrens trägt eine doppelte Bedeutung: es dreht sich um den eigenen Mittelpunkt, es hat so viel an Weite und Tiefe, an Lust und Leid, wie sein unmittelbares Erlebtwerden ihm gibt; und es ist zugleich der Teil eines Lebensverlaufes, nicht nur ein umgrenztes Ganzes, sondern auch Glied eines Gesamtorganismus.
Beide Werte bestimmen jeden Lebensinhalt in mannigfacher Konfiguration.
Ereignisse, die in ihrer eigenen, nur sich selbst darbietenden Bedeutung einander sehr ähnlich sein mögen, sind gemäß ihren Verhältnissen zum Ganzen des Lebens äußerst divergent; oder, in jener ersteren Hinsicht vielleicht unvergleichbar, können ihre Rollen als Elemente unserer Gesamtexistenz zum Verwechseln gleich sein.
Wenn von zwei Erlebnissen, deren angebbare Inhalte gar nicht weit unterschieden sind, das eine als "Abenteuer" empfunden wird, das andere nicht - so ist es jene Verschiedenheit des Verhältnisses zum Ganzen unseres Lebens, durch die dem einen diese Bedeutung zufällt, die sich dem andern versagt.
Und zwar ist nun die Form des Abenteuers, im allerallgemeinsten: dass es aus dem Zusammenhange des Lebens herausfällt.
Mit jener Ganzheit eines Lebens meinen wir doch, dass in seinen einzelnen Inhalten, so krass und unversöhnlich sie sich voneinander abheben mögen, ein einheitlicher Lebensprozess kreist.
Dem Ineinandergreifen der Lebensringe, dem Gefühl, dass sich mit all diesen Gegenläufen, diesen Biegungen, diesen Verknotungen doch schließlich ein kontinuierlicher Faden spinnt, steht dasjenige, was wir ein Abenteuer nennen, gegenüber, ein Teil unserer Existenz freilich, dem sich vorwärts und rückwärts andere unmittelbar anschließen - und zugleich, in seinem tieferen Sinne, außerhalb der sonstigen Kontinuität dieses Lebens verlaufend.
Und dennoch ist es unterschieden von all dem einfach Zufälligen, Fremden, nur die Epidermis des Lebens Streifenden.
Indem es aus dem Zusammenhange des Lebens herausfällt, fällt es - dies wird sich allmählich erklären - gleichsam mit eben dieser Bewegung wieder in ihn hinein, ein Fremdkörper in unserer Existenz, der dennoch mit dem Zentrum irgendwie verbunden ist.
Das Außerhalb ist, wenn auch auf einem großen und ungewohnten Umweg, eine Form des Innerhalb.
Durch diese seelische Position bekommt das Abenteuer für die Erinnerung leicht die Färbung des Traumes. jeder weiß, wie schnell wir Träume vergessen, weil auch sie sich außerhalb des sinnvollen Zusammenhanges des Lebensganzen stellen.
Was wir als "traumhaft" bezeichnen, ist nichts anderes als eine Erinnerung, die sich mit weniger Fäden als sonstige Erlebnisse dem einheitlichen und durchgehenden Lebensprozesse verknüpft.
Wir lokalisieren unsere Unfähigkeit, ein Erlebtes eben diesem einzuordnen, gewissermaßen durch die Vorstellung des Traumes, in dem dies Erlebte stattgefunden hätte.
Je "abenteuerlicher" ein Abenteuer ist, je reiner es also seinen Begriff erfüllt, desto "traumhafter". wird es für unsere Erinnerung. Und so weit rückt es oft von dem zentralen Punkte des Ich und dem von ihm zusammengehaltenen Verlaufe des Lebensganzen ab, dass wir an das Abenteuer leicht so denken, als ob ein anderer es erlebt hätte; wie weit es jenseits dieses Ganzen schwebt, wie fremd es ihm geworden ist, drückt sich eben darin aus, dass es sozusagen mit unserem Gefühl vereinbar wäre, ihm ein anderes Subjekt als jenem zu geben.
In einem viel schärferen Sinne, als wir es von den anderen Formen unserer Lebensinhalte zu sagen pflegen, hat das Abenteuer Anfang und Ende.
Dies ist seine Gelöstheit aus den Verschlingungen und Verkettungen jener Inhalte, seine Zentrierung in einem für sich bestehenden Sinn.
Von den Ereignissen des Tages und Jahres empfinden wir sonst, das eine sei zu Ende, indem oder weil das andere einsetzt, sie bestimmten sich gegenseitig ihre Grenzen, und damit gestaltet oder spricht die Einheit des Lebenszusammenhanges sich aus.
Das Abenteuer aber ist, seinem Sinne als Abenteuer nach, von dem Vorher und Nachher unabhängig, ohne Rücksicht auf diese bestimmt es sich seine Grenzen.
Eben da, wo die Kontinuität mit dem Leben so prinzipiell abgelehnt wird oder eigentlich nicht erst abgelehnt zu werden braucht, weil von vornherein eine Fremdheit, Unberührsamkeit, ein Außer-der-Reihe-Sein vorliegt - da sprechen wir von Abenteuer.
Ihm fehlt jene gegenseitige Durchdringung mit den benachbarten Teilen des Lebens, durch die dieses ein Ganzes wird.
Es ist wie eine Insel im Leben, die sich ihren Anfang und ihr Ende nach ihren eigenen Bildungskräften und nicht, wie das Stück eines Kontinentes, zugleich nach denen ihres Diesseits und Jenseits bestimmt.
Diese entschiedene Begrenztheit, mit der das Abenteuer sich aus dem Gesamtverlauf eines Schicksals heraushebt, ist keine mechanische, sondern eine organische: wie der Organismus sich seine Raumform nicht einfach dadurch, dass ihm von rechts und links eine Hemmung kommt, bestimmt, sondern aus der Triebkraft eines von innen formenden Lebens - so ist das Abenteuer nicht zu Ende, weil etwas anderes anfängt, sondern seine Zeitform, sein radikales Zu-Ende-sein, ist die genaue Ausformung seines inneren Sinnes.
Zunächst hierin liegt die tiefe Beziehung des Abenteurers zum Künstler, vielleicht auch die Neigung des Künstlers zum Abenteuer begründet.
Denn es ist doch das Wesen des Kunstwerkes, dass es aus den endlos kontinuierlichen Reihen der Anschaulichkeit oder des Erlebens ein Stück herausschneidet, es aus den Zusammenhängen mit allem Diesseits und Jenseits löst und ihm eine selbstgenugsame, wie von einem inneren Zentrum her bestimmte und zusammengehaltene Form gibt.
Dass ein Teil des Daseins, das in dessen Ununterbrochenheit verflochten ist, dennoch als ein Ganzes, als eine geschlossene Einheit empfunden wird - das ist die Form, die dem Kunstwerk und dem Abenteuer gemeinsam ist.
Und wegen ihrer werden beide, in aller Einseitigkeit und Zufälligkeit ihrer Inhalte, so empfunden, als ob sich in jedem irgendwie das ganze Leben zusammenfasste und erschöpfte.
Und nicht schlechter, sondern vollkommener scheint dies darum zu geschehen, weil das Kunstwerk überhaupt jenseits des Lebens als einer Realität steht, das Abenteuer überhaupt jenseits des Lebens als eines ununterbrochenen, jedes Element mit seinen Nachbarn verständlich verflechtenden Verlaufes.
Gerade weil das Kunstwerk und das Abenteuer dem Leben gegenüberstehen (wenn auch in sehr verschiedener Bedeutung des Gegenüber), ist das eine und das andere analog der Ganzheit eines Lebens selbst, wie es sich in dem kurzen Abriss und der Zusammengedrängtheit des Traumerlebnisses darstellt.
Darum ist der Abenteurer auch das stärkste Beispiel des unhistorischen Menschen, des Gegenwartswesens.
Er ist einerseits durch keine Vergangenheit bestimmt (was seinen nachher zu behandelnden Gegensatz zum Alter trägt), andererseits besteht die Zukunft für ihn nicht.
Ein extrem charakteristischer Beleg dafür ist, dass Casanova, wie aus seinen Memoiren zu ersehen ist, so und so oft im Lauf seines erotisch-abenteuerlichen Lebens ernsthaft beabsichtigte, eine Frau, die er gerade liebte, zu heiraten.
Bei dem Naturell und der Lebensführung Casanovas war etwas Widerspruchsvolleres, innerlich und äußerlich Unmöglicheres nicht ausdenkbar.
Casanova war nicht nur ein vortrefflicher Menschenkenner, sondern ersichtlich auch ein seltener Kenner seiner selbst; und obgleich er sich sagen musste, das er eine Ehe nicht vierzehn Tage ausgehalten hätte, und dass die allerjammervollsten Konsequenzen dieses Schrittes völlig unvermeidlich waren - so verschlang der Rausch des Augenblicks (wobei ich den Akzent mehr auf Augenblick als auf Rausch legen möchte)' die Zukunftsperspektive gleichsam mit Haut und Haaren.
Weil ihn das Gegenwartsgefühl unbedingt beherrschte, wollte er ein Verhältnis für die Zukunft eingehen, das gerade durch sein Gegenwartsnaturell unmöglich war.
Dass ein Isoliertes und Zufälliges eine Notwendigkeit und einen Sinn enthalten könne - das bestimmt den Begriff des Abenteuers in seinem Gegensatz zu allen Stücken des Lebens, die die bloße Fügung der Geschicke in dessen Peripherie einstellt.
Zum Abenteuer wird ein solches erst durch jene doppelte Sinngebung: dass es in sich eine durch Anfang und Ende festgelegte Gestaltung eines irgendwie bedeutungsvollen Sinnes ist, und dass es, in all seiner Zufälligkeit, all seiner Exterritorialität gegenüber dem Lebenskontinuum, doch mit dem Wesen und der Bestimmung seines Trägers in einem weitesten, die ra-tionaleren Lebensreihen übergreifenden Sinne und in einer geheimnisvollen Notwendigkeit zusammenhängt.
Hier klingt die Beziehung des Abenteurers zum Spieler an.
Der Spieler ist zwar der Sinnlosigkeit des Zufalls preisgegeben; allein indem er auf dessen Gunst rechnet, indem er ein durch diesen Zufall bedingtes Leben für möglich hält und verwirklicht, stellt sich ihm der Zufall doch in einen Zusammenhang des Sinnes ein.
Die typische Abergläubischkeit des Spielers ist nichts anderes als die greifbare und vereinzelte, deshalb aber auch kindische Form dieses tiefen und umfassenden Schemas seines Lebens: dass in dem Zufall ein Sinn, irgendeine notwendige - wenn auch nicht nach der rationalen Logik notwendige - Bedeutung wohne.
Durch den Aberglauben, mit dem der Spieler den Zufall durch Vorzeichen und magische Hilfsmittel in sein Zwecksystem hineinziehen will, enthebt er ihn seiner unzugänglichen Isoliertheit, sucht in ihm eine zwar nach phantastischen Gesetzen, aber immerhin doch nach Gesetzen verlaufende Ordnung.
Und so lässt auch der Abenteurer den außerhalb der einheitlichen, von einem Sinn gelenkten Lebensreihe stehenden Zufall dennoch irgendwie von diesem umfasst sein.
Er bringt ein zentrales Lebensgefühl auf, das sich durch die Exzentrizität des Abenteuers hindurchleitet, und gerade in der Weite des Abstandes zwischen seinem zufälligen, von außen gegebenen Inhalt und dem zusammenhaltenden, sinngebenden Zentrum der Existenz eine neue, bedeutungsvolle Notwendigkeit seines Lebens herstellt.
Zwischen Zufall und Notwendigkeit, zwischen dem Fragmentarischen äußerer Gegebenheit und der einheitlichen Bedeutung des von innen her entwickelten Lebens spielt ein ewiger Prozess in uns, und die großen Formen, in denen wir die Inhalte des Lebens gestalten, sind die Synthesen, die Antagonismen oder die Kompromisse jener beiden Grundaspekte.
Das Abenteuer ist eine von ihnen.
Wenn der professionelle Abenteurer aus der Systemlosigkeit seines Lebens ein Lebenssystem macht, wenn er die nackten äußeren Zufälle. sucht, aus seiner inneren Notwendigkeit heraus und jene in diese einbauend - so macht er damit nur gleichsam makroskopisch sichtbar, was die Wesensform jedes "Abenteuers", auch des nicht abenteuerlichen Menschen, ist.
Denn immer meinen wir mit dem Abenteuer ein Drittes, jenseits sowohl des bloßen abrupten Geschehnisses, dessen Sinn uns schlechthin außen bleibt, wie es von außen kam, als auch der einheitlichen Lebensreihe, in der jedes Glied das andere zu einem Gesamtsinne ergänzt.
Das Abenteuer ist nicht ein Gemengsel beider, sondern das unvergleichlich gefärbte Erlebnis, das sich nur als ein besonderes Umfastsein jenes Zufällig-Äußeren durch dieses Innerlich-Notwendige ausdeuten lässt.
Hier und da aber wird dieses ganze Verhältnis noch von einer tieferen inneren Gestaltung umgriffen.
So sehr das Abenteuer auf einer Unterschiedlichkeit innerhalb des Lebens zu beruhen scheint, so kann doch das Leben als ganzes wie ein Abenteuer empfunden werden.
Es ist dazu weder nötig, ein Abenteurer zu sein, noch viele einzelne Abenteuer durchzumachen.
Wer diese einzigartige Attitüde zum Leben hat, muss über dessen Ganzem eine höhere Einheit, gleichsam ein Über-Leben fühlen, das sich zu jenem verhält wie die unmittelbare Lebenstotalität selbst zu den einzelnen Erlebnissen, die uns die empirischen Abenteuer sind.
Vielleicht gehören wir einer metaphysischen Ordnung an, vielleicht lebt unsere Seele ein transzendentes Dasein, derart, dass unser irdisch bewusstes Leben nur ein isoliertes Stück gegenüber einem unnennbaren Zusammenhange einer über ihm sich vollziehenden Existenz ist.
Der Seelenwanderungsmythus mag ein stammelnder Versuch sein, diesen Segmentcharakter jedes gegebenen Lebens auszudrücken.
Wer durch alles reale Leben hindurch eine geheime, zeitlose Existenz der Seele spürt, die mit diesen Realitäten nur wie von der Ferne her verbunden ist - der wird das Leben in seiner gegebenen und begrenzten Ganzheit jenem transzendenten und in sich einheitlichen Schicksal gegenüber als ein Abenteuer empfinden.
Gewisse religiöse Stimmungen scheinen dies zu bewirken.
Wo unsere irdische Laufbahn als ein bloßes Vorstadium der Erfüllung ewiger Geschicke gilt, wo wir auf der Erde nur einen flüchtigen Gastaufenthalt, aber keine Heimat haben, da liegt offenbar nur eine besondere Färbung des allgemeinen Gefühls vor, dass das Leben als ganzes ein Abenteuer ist; womit eben nur ausgedrückt ist, dass die Symptome des Abenteuers in ihm zusammenrinnen: dass es außerhalb des eigentlichen Sinnes und stetigen Ablaufes der Existenz steht und dieser doch durch ein Schicksal und eine geheime Symbolik verbunden ist, dass es ein fragmentarischer Zufall ist und doch nach Anfang und Ende wie ein Kunstwerk geschlossen, dass es wie ein Traum alle Leidenschaften in sich sammelt und doch wie dieser zum Vergessenwerden bestimmt ist, dass es wie das Spiel sich gegen den Ernst abhebt und doch wie das Va banque des Spielers auf die Alternative eines höchsten Gewinns oder der Vernichtung geht.
Die Synthese der großen Lebenskategorien, als deren eine besondere Formung sich das Abenteuer verwirklicht, vollzieht sich weiterhin zwischen der Aktivität und der Passivität, zwischen dem, was wir erobern, und dem, was uns gegeben wird.
Freilich macht die Synthese des Abenteuers den Gegensatz dieser Elemente extrem fühlbar.
Wir reißen einerseits mit ihm die Welt gewaltsam in uns hinein.
Der Unterschied gegen die Art, wie wir ihr in der Arbeit ihre Gaben abgewinnen, macht das deutlich.
Die Arbeit hat sozusagen ein organisches Verhältnis zur Welt, sie entwickelt deren Stoffe und Kräfte kontinuierlich zu ihrer Zuspitzung im menschlichen Zwecke hin, während wir im Abenteuer ein unorganisches Verhältnis zu ihr haben; es bringt die Geste des Eroberers mit sich, das rasche Ergreifen der Chance, gleichviel ob wir damit ein zu uns, zu der Welt oder zum Verhältnis beider harmonisches oder unharmonisches Stück für uns heraustrennen.
Andererseits aber sind wir ihr im Abenteuer doch schutzloser, reserveloser preisgegeben als in allen Verhältnissen, die mit der Gesamtheit unseres Weltlebens durch mehr Brücken verbunden sind und uns deshalb gegen Chocs und Gefahren besser durch vorbereitete Ausbiegungen und Anpassungen verteidigen.
Die Verflechtung von Handeln und Leiden, in der unser Leben verläuft, spannt hier ihre Elemente zu einer Gleichzeitigkeit von Eroberertum, das alles nur der eigenen Kraft und Geistesgegenwart verdankt, und völligem Sich-Überlassen an - die Gewalten und Chancen der Welt, die uns beglücken, aber in demselben Atem auch zerstören können; dass die Einheit, zu der wir in jedem Augenblick unsere Aktivität und unsere Passivität der Welt gegenüber zusammenleben, ja, die in einem gewissen Sinne das Leben ist, ihre Elemente zu so äußerster Zuspitzung treibt und sich eben damit - als wären diese nur die beiden Aspekte eines und desselben, geheimnisvoll ungetrennten Lebens - um so tiefer fühlbar macht: das ist wohl einer der wunderbarsten Reize, mit denen uns das Abenteuer verlockt.
Es ist noch mehr als die Einstellung des gleichen Grundverhältnisses unter einen anderen Gesichtswinkel, wenn uns das Abenteuer weiterhin als eine Kreuzung des Sicherheits- mit dem Unsicherheitsmoment des Lebens erscheint.
Die Sicherheit, mit der wir - berechtigt oder irrend - um einen Erfolg wissen, gibt dem Tun eine qualitativ besondere Färbung; wenn wir umgekehrt unsicher sind, ob wir dahin gelangen werden, wohin wir aufgebrochen sind, wenn wir das Nicht-Wissen um den Erfolg wissen, so ist das nicht nur eine quantitativ herabgesetzte Sicherheit, sondern bedeutet eine innerlich und äußerlich einzigartige Führung unserer Praxis.
Der Abenteurer nun, um es mit einem Worte zu sagen, behandelt das Unberechenbare des Lebens so, wie wir uns sonst nur dem sicher Berechenbaren gegenüber verhalten.
(Darum ist der Philosoph der Abenteurer des Geistes. Er macht den aussichtslosen, aber darum noch nicht sinnlosen Versuch, ein Lebensverhalten der Seele, ihre Stimmung gegen sich, die Welt, Gott, in begriffsmäßige Erkenntnis zu formen. Er behandelt dies Unlösbare, als wäre es lösbar.)
Wo die Verwebung mit unerkennbaren Schicksalselementen den Erfolg unseres Tuns zweifelhaft macht, pflegen wir doch unseren Kräfteeinsatz zu begrenzen, uns Rückzugslinien offen zu halten, den einzelnen Schritt nur wie probeweise zu tun. Im Abenteuer verfahren wir direkt entgegengesetzt: gerade auf die schwebende Chance, auf das Schicksal und das Ungefähr hin setzen wir alles ein, brechen die Brücken hinter uns ab, treten in den Nebel, als müsste der Weg uns unter allen Umständen tragen.
Dies ist der typische "Fatalismus" des Abenteurers.
Gewiss sind auch ihm die Dunkelheiten des Schicksals nicht durchsichtiger als anderen, aber er verfährt so, als ob sie es wären.
Die eigentümliche Gewagtheit, mit der er sich immerzu aus den Festigkeiten des Lebens herausbegibt, baut sich gewissermaßen zu ihrer eigenen Rechtfertigung ein Gefühl von Sicherheit und Gelingenmüssen unter, das sonst nur der Durchsichtigkeit berechenbarer Ereignisse zukommt.
Von der fatalistischen Überzeugung, dass unser Schicksal, das wir nicht kennen, uns unentrinnbar sicher ist, ist dies nur die subjektive Wendung: dass der Abenteurer dieses Unerkennbaren dennoch für sich sicher zu sein glaubt; darum erscheint dem nüchternen Menschen das abenteuerliche Tun oft als Wahnsinn, weil es, um einen Sinn zu haben, vorauszusetzen scheint, dass das Unwißbare gewusst werde.
Von Casanova sagte der Prinz von Ligne: "Er glaubt an nichts, ausgenommen an das, was am wenigsten glaubwürdig ist."
Ersichtlich liegt dem jenes perverse oder wenigstens "abenteuerliche" Verhältnis zwischen dem Gewissen und dein Ungewissen zugrunde.
Der Skeptizismus des Abenteurers - dass er "an nichts glaubt" - ist ersichtlich das Korrelat dazu: wem das Unwahrscheinliche wahrscheinlich ist, dem wird leicht das Wahrscheinliche unwahrscheinlich.
Der Abenteurer verlässt sich zwar in irgendeinem Maße auf die eigene Kraft, vor allem aber auf das eigene Glück, eigentlich auf eine sonderbar undifferenzierte Einheit beider.
Die Kraft, deren er sicher ist, und das Glück, dessen er unsicher ist, gehen subjektiv doch zu einem Sicherheitsgefühl in ihm zusammen.
Wenn es das Wesen des Genies ist, eine unmittelbare Beziehung zu den geheimen Einheiten zu besitzen, die in der Erfahrung und durch die Zerlegungen des Verstandes in ganz gesonderte Erscheinungen auseinandergehen - so lebt der geniale Abenteurer, wie mit einem mystischen Instinkt" an dem Punkt,. wo der Weltlauf und das individuelle Schicksal sich sozusagen noch nicht voneinander differenziert haben; darum hat überhaupt der Abenteurer leicht einen "genialischen" Zug.
Aus dieser besonderen Konstellation, in der er das Unsicherste, Unberechenbare seinem Handeln zu derselben Voraussetzung macht, wie ein anderer nur das Berechenbare, wird die "nachtwandlerische Sicherheit" begreiflich, mit der der Abenteurer sein Leben führt und die durch ihre Unerschütterlichkeit gegenüber jedem Dementi durch die Tatsachen beweist, wie tief jene Konstellation in der Lebensvoraussetzung solcher Naturen wurzelt.
Ist das Abenteuer eine Lebensform, die sich an einer unpräjudizierten Fülle von Lebensinhalten verwirklichen kann, so machen diese Bestimmungen dennoch begreiflich, dass ein Inhalt vor allen anderen sich in diese Form zu kleiden neigt: der erotische - so dass unser Sprachgebrauch das Abenteuer schlechthin kaum anders denn als ein erotisches verstehen lässt.
Zwar ist auch das zeitlich kurz begrenzte Liebeserlebnis keineswegs immer ein Abenteuer, sondern die besonderen seelischen Qualitäten, in deren Treffpunkt das Abenteuer liegt, müssen sich mit diesem quantitativen Moment vereinigen.
Ihre Tendenz zu diesem Hinzutreten wird sich Schritt für Schritt offenbaren.
Das Liebesverhältnis enthält in sich das deutliche Zusammen der beiden Elemente, die auch die Form des Abenteuers vereinigt: die erobernde Kraft und die unerzwingbare Gewährung, den Gewinn aus dem eigenen Können und das Angewiesensein auf das Glück; mit dem ein Unberechenbares außerhalb unser uns begnadet.
Eine gewisse Äquivalenz dieser Richtungen innerhalb des Erlebnisses, gewonnen auf der Basis ihrer scharfen Differenzierung, ist vielleicht nur auf seiten des Mannes zu finden; vielleicht hat es darum eine beweisende Bedeutung, daß das Liebesverhältnis in der Regel nur für den Mann als "Abenteuer" gilt, für die Frau aber ebendasselbe unter andere Kategorien zu fallen pflegt.
Die Aktivität der Frau im Liebesroman ist typischerweise schon von der Passivität durchwachsen, die entweder die Natur oder die Geschichte ihrem Wesen zugeteilt hat; andererseits, ihr Empfangen und Beglücktwerden ist doch unmittelbar ein Gewähren und Beschenken.
Die beiden, in sehr mannigfaltigen Färbungen ausdrückbaren Pole der Eroberung und der Gnade stehen für die Frau enger zusammen, sie spannen sich für den Mann entschiedener auseinander, und darum gibt ihr Zusanimenschlag im erotischen Erlebnis diesem viel unzweideutiger für den Mann das Cachet des "Abenteuers".
Daß der Mann der werbende, der angreifende, oft der stürmisch ansichreißende Teil ist, läßt leicht das Schicksalsmoment in jedem - wie immer gearteten - erotischen Erlebnis übersehen, die Abhängigkeit von einem nicht Vorzubestimmenden, das sich jeder Nötigung entzieht.
Damit ist nicht nur die Abhängigkeit von der Gewährung seitens des Anderen gemeint, sondern ein Tieferes.
Gewiß ist auch jede Gegenliebe ein Geschenk, das nicht "verdient" werden kann, selbst durch kein Maß von Liebe, weil sich die Liebe jeder Forderung und Begleichung entzieht und prinzipiell unter einer ganz anderen Kategorie als der einer gegenseitigen Aufrechnung steht; ein Punkt, an dem sich eine ihrer Analogien mit dem tieferen religiösen Verhältnis ergibt.
Allein über das hinaus, was wir vom Andern als eine immer freie Gabe empfangen, liegt in jedem Liebesglück - wie ein tiefer, unpersönlicher Träger jenes Persönlichen - noch eine Gunst des Schicksals, wir empfangen es nicht nur vom Anderen, sondern daß wir es von ihm empfangen, ist eine Gnade der unberechenbaren Mächte.
In dem stolzesten, selbstgewissesten Ereignis dieses Gebietes liegt etwas, was wir in Demut hinzunehmen haben.
Indem sich aber nun die Kraft, die ihren Erfolg sich selbst verdankt und die allem Gewinn von Liebe irgendeinen Ton von Sieg und Triumph gibt, mit jenem anderen der Schicksalsgunst vermählt, ist die Konstellation des Abenteuers gewissermaßen präformiert.
In tieferen Gründen wurzelt die Beziehung, die sich von dem erotischen Inhalt zu der allgemeineren Lebensform des Abenteuers spinnt.
Das Abenteuer ist die Exklave des Lebenszusammenhanges, das Abgerissene, dessen Beginn und Ende keinen Anschluß an die irgendwie einheitliche Strömung der Existenz haben - während es dennoch, wie über diese Strömung hinweg und ihrer Vermittlung unbedürftig, mit den geheimsten Instinkten und mit einer letzten Absicht des Lebens überhaupt zusammenhängt und sich dadurch von der bloß zufälligen Episode, dem, was uns bloß äußerlich "passiert", unterscheidet.
Wo nun das Liebeserlebnis sich zeitlich kurz begrenzt, lebt es in ebendieser Verwebung eines bloß tangentialen und eines dennoch zentralen Charakters.
Es mag unserem Leben einen bloß momentanen Glanz geben, wie ein Strahl, den ein außen vorüberhuschendes Licht in einen Innenraum wirft; dennoch wird damit ein Bedürfnis erfüllt, oder es ist überhaupt nur durch ein Bedürfnis möglich, das - mag man es als physisches oder als seelisches oder als metaphysisches ansprechen - in dem Fundamente oder Zentrum unseres Wesens gleichsam zeitlos besteht und- mit dem flüchtigen Erlebnis so verbunden ist wie jene zufällige und gleich verschwindende Helligkeit mit unserer Sehn-sucht nach Licht überhaupt.
Daß die Möglichkeit dieses Doppelverhältnisses in der Erotik angelegt ist, spiegelt sich in ihrem zeitlichen Doppelaspekt; die beiden Zeitmaße, die sie zeigt: den momentan aufgegipfelten, steil abfallenden Rausch und die Unvergänglichkeit, in deren Idee sich das mystische Bestimmtsein zweier Seelen füreinander und zu einer höheren Einheit einen zeitlichen Ausdruck schafft - diese könnte man mit der Doppelexistenz geistiger Inhalte vergleichen, die zwar nur in der Flüchtigkeit des seelischen Prozesses, dem immer weiter eilenden Brennpunkt des Bewußtseins auftauchen, deren logischer Sinn aber eine zeitlose Gültigkeit besitzt, eine ideelle Bedeutung, völlig unabhängig von jenem Bewußtseinsaugenblick, in dem sie freilich für uns wirklich wird.
Das Phänomen des Abenteuers, mit seiner abrupten Pointiertheit, die das Ende in die Sehweite des Anfangs rückt, und seiner gleichzeitigen Beziehung auf ein Lebenszentrum, die es von jedem bloß zufälligen Begegnis trennt und ohne die die "Lebensgefahr" nicht sozusagen im Stil des Abenteuers liegen könnte - ist insofern eine Form, die durch ihre zeitliche Symbolik wie für die Aufnahme des erotischen Inhalts vorbestimmt erscheint.
Diese Analogien und gemeinsamen Formungen der Liebe und des Abenteuers legen es schon von sich aus nahe, daß das Abenteuer nicht in den Lebensstil des Alters hineingehört.
Das Entscheidende für diese Tatsache überhaupt ist, daß das Abenteuer seinen spezifischen Wesen und Reize nach eine Form des Erlebens ist.
Der Inhalt, der vor sich geht, macht das Abenteuer noch nicht: daß eine Lebensgefahr bestanden oder eine Frau zu kurzem Glück erobert wird, daß unbekannte Faktoren, mit denen man das Spiel gewagt hat, überraschenden Gewinn oder Verlust gebracht haben, daß man in einer physischen oder seelischen Verkleidung sich in Lebenssphären begibt, aus denen man wie aus einer fremden Welt wieder in die heimische zurückkehrt - das alles braucht noch nicht Abenteuer zu sein, sondern wird es erst durch eine gewisse Gespanntheit des Lebensgefühls, mit dem solche Inhalte sich verwirklichen; erst wenn ein Strom, zwischen dem Alleräußerlichsten des Lebens und seiner zentralen Kraftquelle hin und her gehend, jene in sich hineinreißt, und wenn diese besondere Färbung, Temperatur und Rhythmik des Lebensprozesses das eigentlich Entscheidende, den Inhalt eines solchen gewissermaßen Übertönende ist, wird das Ereignis aus einem Erlebnis schlechthin zu einem Abenteuer.
Dieses Prinzip der Akzentuierung aber liegt dem Alter fern.
Nur die Jugend kennt im allgemeinen solches Übergewicht des Lebensprozesses über die Lebensinhalte, während es dem Alter, dem jener zu verlangsamen und zu erstarren beginnt, auf die Inhalte ankommt, die in einer gewissen zeitlosen, gegen das Tempo und die Leidenschaft ihres Erlebtwerdens indifferenteren Art vorgehen oder beharren.
Das Alter pflegt entweder ganz zentralisiert zu leben,die peripherischen Interessen sind abgefallen und haben keine Verbindungmehr mit dem wesentlichen Leben und seiner inneren Notwendigkeit; oderdas Zentrum wird atrophisch, die Existenz geht nur noch in isolierten Kleinlichkeiten und den Wichtigkeitsbetonungen des bloß Äußerlichen und Zufälligen dahin.
In keinem von beiden Fällen ist das Verhältnis zwischen dem äußeren Geschick und den inneren Lebensquellen möglich, in dem das Abenteuer besteht, in keinem von beiden kann es ersichtlich zu der Kontrastempfindung des Abenteuers kommen: daß ein Tun ganz aus dem Gesamtzusammenhange des Lebens herausgerissen ist und dennoch die ganze Kraft und Intensität des Lebens in sich einströmen läßt.
Diesen Gegensatz zwischen Jugend und Alter, durch den das Abenteuer die Prärogative der ersteren wird und der dort den Akzent auf den Lebensprozeß, sein Metrum und seine Antinomien fallen läßt, hier auf die Inhalte, für die das Erleben immer mehr als eine relativ zufällige Form erscheint - diesen Gegensatz mag man als den zwischen dem romantischen und dem historischen Geist des Lebens ausdrücken.
Der romantischen Gesinnung kommt es auf das Leben in seiner Unmittelbarkeit, also auch in der Individualität seiner jeweiligenForm, seines Hier und jetzt, an; sie spürt die volle Stromstärkedes Lebens gerade am meisten an der Punktualität eines dem normalen Lauf der Dinge entrissenen Erlebnisses, bis zu dem nun dennoch vom Herzen des Lebens her ein Nerv sich spannt.
All dieses Sich-aus-sich-Herauswerfen des Lebens, diese Gegensatzweite der von ihm durchdrungenen Elemente kann sich nur aus einem Überschuß und Übermut des Lebens speisen, wie er im Abenteuer, in der Romantik und in der Jugend besteht.
Dem Alter aber, wenn es als solches eine charakteristische, wertvolle, gesammelte Haltung hat, eignet die historische Stimmung.
Mag diese sich zu einer Weltanschauung erweitern, mag ihr Interesse sich auf die unmittelbar eigene Vergangenheit beschränken, in jedem Falle gilt sie in ihrer Objektivität und retrospektiven Nachdenklichkeit dem Bilde der Lebensinhalte, aus dem die Unmittelbarkeit des Lebens selbst verschwunden ist.
Alle Geschichte als Bild im engeren, wissenschaftlichen Sinne entsteht durch solches Überleben von Inhalten über den unsagbaren, nur erlebbaren Prozeß ihrer Gegenwart.
Die Verbindung, die dieser Prozeß zwischen ihnen herstellte, ist zerfallen und muß nun im Rückblick und zu ideeller Bildhaftigkeit durch ganz andere Fäden wiederhergestellt werden.
Mit dieser Verschiebung des Akzentes entfällt die ganze dynamische Voraussetzung des Abenteuers.
Seine Atmosphäre ist, wie ich schon andeutete, unbedingte Gegenwärtigkeit, das Aufschnellen des Lebensprozesses zu einem Punkt, der weder Vergangenheit noch Zukunft hat und deshalb das Leben mit einer Intensität in sich sammelt, der gegenüber der Stoff des Vorganges oft relativ gleichgültig wird.
Wie für die eigentliche Spielernatur gar nicht der Gewinn von soundsoviel Geld das entscheidende Motiv ist, sondern das Spiel als solches, die Gewaltsamkeit des von Glück zu Verzweiflung und wieder zurück gerissenen Gefühles, die gleichsam tastbare Nähe der dämonischen Mächte, die zwischen beiden entscheiden - so ist der Reiz des Abenteuers unzählige Male gar nicht der Inhalt, den es uns bietet und den man, in anderer Form geboten, vielleicht wenig beachten würde, sondern die abenteuerliche Form seines Erlebens, die Intensität und die Gespanntheit, mit der er uns gerade in diesem Falle das Leben fühlen läßt.
Dies eben verbindet die Jugend dem Abenteuer. Was man die Subjektivität der Jugend nennt, ist nur dies, daß das Material des Lebens in seiner objektiven Bedeutung ihr nicht so wichtig ist wie der Prozeß, der es trägt, wie das Leben selbst.
Daß das Alter "objektiv" ist, daß es aus den Inhalten, die das entglittene Leben in einer besonderen Art von Zeitlosigkeit übrig- gelassen hat, ein neues Gebilde formt. der Beschaulichkeit, der sachlichen Abwägungen, der Freiheit von der Unruhe, mit der das Leben Gegenwart ist - das eben ist es, was dem Alter das Abenteuer entfremdet, was den alten Abenteurer zu einer Widrigen oder, stillosen Erscheinung macht; es wäre nicht schwer, das ganze Wesen des Abenteuers daraus zu entwickeln, daß es die dem Alter schlechthin nicht gemäße Lebensform ist.
All solche Bestimmungen und Lagen des Lebens, die seiner Abenteuerform fremd, ja feindlich sind, verhindern nicht, daß für einen allerallgemeinsten Aspekt das Abenteuer allem menschlich-praktischenDasein beigemischt erscheint, ein überall vorhandenes Element, das nur vielfach in der feinsten Verteilung, gleichsam makroskopischnicht sichtbar und von anderen in der Erscheinung überdeckt,auftritt.
Unabhängig von jener, in die Metaphysik des Lebenshinabreichenden Vorstellung, daß unser Dasein auf Erden als ganzesund als Einheit ein Abenteuer ist, vielmehr rein auf das Konkrete und Psychologische angesehen, enthält jedes einzelne Erlebnis irgendein Quantum der Bestimmungen, die es bei einem gewissen Maße die "Schwelle" des Abenteuers erreichen lassen.
Die wesentlichste und tiefste dieser Bestimmungen ist hier die Aussonderung des Ereignisses aus dem Gesamtzusammenhange des Lebens.
Tatsächlich erschöpft die Zugehörigkeit zu diesem die Bedeutung keines einzigen seiner Teile. Sondern auchwo ein solcher am engsten mit dem Ganzen verflochten ist, auch wo er wirklich ganz in das weiterflutende Leben aufgelöst scheint, wie ein für sich unbetontes Wort in den Verlauf eines Satzes - auch da läßt ein feineres Hinhören einen Eigenwert dieses Existenzstückes erkennen, mit einer in ihm selbst zentrierenden Bedeutung stellt es sich jener Totalentwicklung gegenüber, der es doch, von anderer Seite her angesehen, unablösbar zugehört.
Reichtum wie Ratlosigkeit des Lebens fließen unzählige Male aus dieser Wertzweiheit seiner Inhalte.
Von dem Zentrum der Persönlichkeit aus gesehen, ist ein jedes Urlebnis sowohl ein Notwendiges, aus der Einheit der Ich-Geschichte Entwickeltes, wie ein Zufälliges, zu dieser fremd, unüberwindlich abgegrenzt und von einer ganz tiefgelegenen Unbegreiflichkeit gefärbt, als stünde es irgendwo im Leeren und gravitierte nirgends hin.
So liegt ein Schatten von dem, was in seiner Verdichtung und Deutlichkeit das Abenteuer macht, eigentlich über jedem Erlebnis, ein jedes läßt seiner Eingliederung in die Lebenskette ein gewisses Gefühl von Eingeschlossenheit in Anfang und Ende zur Seite gehen, von einer sozusagen rücksichtslosen Pointiertheit des Einzelerlebnisses als solchen.
Dieses Gefühl mag zur Unmerklichkeit herabsinken, aber es liegt latent in jedem Erlebnis und steigt, oft zu unserem eigenen Erstaunen, daraus auf.
Man wüßte gar kein so geringes Maß solchen Abstandes von der Lebensstetigkeit zu nennen, bei dem nicht schon das Gefühl der Abenteuerlichkeit auftauchen könnte, freilich auch kein so großes, bei dem es für jedermann auftauchen müßte; es könnte nicht alles zum Abenteuer werden, wenn dessen Elemente nicht in irgendeinem Maße in allem ruhten, wenn sie nicht zu den vitalen Faktoren gehörten, wegen welcher ein Ereignis überhaupt als menschliches Erlebnis bezeichnet ist.
Ebenso steht es mit der Relation des Zufälligen und des Sinnvollen.
In jedem Vorkommnis, das uns begegnet, steckt so viel bloß Gegebenes, Äußerliches, Gelegentliches, daß es sozusagen nur eine Quantitätsfrage ist, ob das Ganze als etwas Vernünftiges, einem Sinne gemäß Begreifliches gelten kann, ,oder ob seine Unauflösbarkeit nach der Vergangenheit hin, seine Unberechenbarkeit nach der Zukunft hin die Färbung des Ganzen bestimmen soll.
Von der gesichertsten bürgerlichen Unternehmung führt bis zu dem irrationellsten Abenteuer eine kontinuierliche Reihe von Lebenserscheinungen, in denen das Begreifliche und das Unbegreifliche, das Erzwingbare und die Gnade das Auszurechnende und das Zufällige sich in einer Unendlichkeit von Graden mischen.
Indem das Abenteuer das eine Extrem in dieser Reihe bezeichnet, hat eben deshalb auch das andere an seinem Charakter teil.
Das Hingleiten unserer Existenz auf einer Skala, auf der jeder Teilstrich durch eine Wirkung unserer Kraft und eine Preisgegebenheit an undurchdringliche Dinge und Mächte gleichzeitig bestimmt ist, diese Problematik unserer Weltstellung, die sich in der unlösbaren Frage nach der. Freiheit des Menschen und: der göttlichen Bestimmung religiös wendet - läßt uns alle zu Abenteurern werden.
Innerhalb der Proportion, in die uns unser Lebensbezirk und die Aufgaben in Ziele und unsere Mittel stellen, könnten wir alle nicht einen Tag leben, wenn wir nicht das eigentlich Unberechenbare so behandelten, als wäre es berechenbar, wenn wir unserer Kraft nicht zutrauten, was doch nicht sie allein, sondern nur ihre rätselhafte Zusammenwirksamkeit mit den Schicksalsgewalten herbeiführen kann.
Die Inhalte unseres Lebens werden dauernd von durcheinanderwebenden Formen erfaßt, die so dessen einheitliches Ganzes zustande bringen: allenthalben lebt künstlerische Formung, lebt religiöse Auffassung, lebt die Färbung sittlichen Wertens, lebt das Wechselspiel von Subjekt und Objekt.
Vielleicht gibt es keine Strombreite dieser ganzen Flutung, in der nicht jede dieser und vieler anderer Gestaltungsarten wenigstens einen Tropfen ihrer.Wellen formten.
Aber erst wo sie aus dem fragmentarischen und vermischten Maß und Zustande, in dem das durchschnittliche Leben sie auf- und untertauchen läßt, zu einer Herrschaft über den Stoff des Lebens gelangen, werden sie zu den reinen Gebilden, mit denen die Sprache sie benennt.
Sobald die religiöse Gestimmtheit rein aus sich heraus ihr Gebilde, den Gott, geschaffen hat, ist sie "Religion", sobald die ästhetische Form ihren Inhalt zu einem erst sekundär wichtigen gemacht hat, an dem sie ihr nur auf sich selbst hörendes Leben lebt, wirdsie zur "Kunst", erst wenn die sittliche Pflicht nur weil sie Pflicht ist, erfüllt wird, gleichviel mit wie wechselnden Inhalten, die vorher ihrerseits den Willen bestimmten, sie sich erfüllt, wird sie "Sittlichkeit".
Mit dem Abenteuer ist es nicht anders.
Die Mode
Die Art, wie es uns gegeben ist, die Erscheinungen des Lebens aufzufassen, lässt uns an jedem Punkte des Daseins eine Mehrheit von Kräften fühlen; und zwar so, dass eine jede von diesen eigentlich über die wirkliche Erscheinung hinausstrebt, ihre Unendlichkeit an der andern bricht und in bloße Spannkraft und Sehnsucht umsetzt.
In jedem Tun, auch dem erschöpfendsten und fruchtbarsten, fühlen wir irgend etwas, was noch nicht ganz zum Ausdruck gekommen ist.
Indem dies durch die gegenseitige Einschränkung der aneinander stoßenden Elemente geschieht, wird an ihrem Dualismus gerade die Einheit des Gesamtlebens offenbar.
Und erst insofern jede innere Energie über das Mass ihrer sichtbaren Äußerung hinausdrängt, gewinnt das Leben jenen Reichtum unausgeschöpfter Möglichkeiten, der seine fragmentarische Wirklichkeit ergänzt, erst damit lassen seine Erscheinungen tiefere Kräfte, ungelöstere Spannungen, Kampf und Frieden umfänglicherer Art ahnen, als ihre unmittelbare Gegebenheit verrät. Dieser Dualismus kann nicht unmittelbar beschrieben, sondern nur an den einzelnen Gegensätzen, die für unser Dasein typisch sind, als ihre letzte, gestaltende Form gefühlt werden.
Den ersten Fingerzeig gibt die physiologische Grundlage unseres Wesens: dieses bedarf der Bewegung wie der Ruhe, der Produktivität wie der Rezeptivität.
Dies in das Leben des Geistes fortsetzend, werden wir einerseits von der Bestrebung nach dem Allgemeinen gelenkt, wie von dem Bedürfnis, das Einzelne zu erfassen; jenes gewährt unserm Geist Ruhe, die Besonderung lässt ihn von Fall zu Fall sich bewegen.
Und nicht anders im Gefühlsleben; wir suchen nicht weniger die ruhige Hingabe an Menschen und Dinge, wie die energische Selbstbehauptung beiden gegenüber.
Die ganze Geschichte der Gesellschaft lässt sich an dem Kampf, dem Kompromiss, den langsam gewonnenen und schnell verlorenen Versöhnungen abrollen, die zwischen der Verschmelzung mit unserer sozialen Gruppe und der individuellen Heraushebung aus ihr auftreten.
Mag sich die Schwingung unserer Seele zwischen diesen Polen philosophisch verkörpern im Gegensatz der Allgemeinheits-Lehre und dem Dogma von der Unvergleichlichkeit, dem Für-sich-sein jedes Weltelementes, mögen sie sich praktisch bekämpfen als die Parteigegensätze des Sozialismus und des Individualismus, immer ist es eine und dieselbe Grundform der Zweiheit, die sich schließlich im biologischen Bilde als der Gegensatz von Vererbung und Variabilität offenbart - die erste der Träger des Allgemeinen, der Einheit, der beruhigten Gleichheit von Formen und Inhalten des Lebens, die andere die Bewegtheit, die Mannigfaltigkeit gesonderter Elemente, die unruhige Entwicklung eines individuellen Lebensinhaltes zu einem anderen erzeugend.
Jede wesentliche Lebensform in der Geschichte unserer Gattung stellt auf ihrem Gebiete eine besondere Art dar, das Interesse an der Dauer, der Einheit, der Gleichheit mit dem an der Veränderung, dem Besonderen, dem Einzigartigen zu vereinen.
Innerhalb der sozialen Verkörperung dieser Gegensätze wird die eine Seite derselben meistens von der psychologischen Tendenz zur Nachahmung getragen.
Die Nachahmung könnte man als eine psychologische Vererbung bezeichnen, als den Übergang des Gruppenlebens in das individuelle Leben.
Ihr Reiz ist zunächst der, dass sie uns ein zweckmäßiges und sinnvolles Tun auch da ermöglicht, wo nichts Persönliches und Schöpferisches auf den Plan tritt. Man möchte sie das Kind des Gedankens mit der Gedankenlosigkeit nennen. Sie gibt dem Individuum die Sicherheit, bei seinem Handeln nicht allein zu stehen, sondern erhebt sich über den bisherigen Ausübungen derselben Tätigkeit wie auf einem festen Unterbau, der die jetzige von der Schwierigkeit, sich selbst zu tragen, entlastet.
Sie gibt im Praktischen die eigenartige Beruhigung, die es uns im Theoretischen gewährt, wenn wir eine Einzelerscheinung einem Allgemeinbegriff eingeordnet haben.
Wo wir nachahmen, schieben wir nicht nur die Forderung produktiver Energie von uns auf den andern, sondern zugleich auch die Verantwortung für dieses Tun; so befreit sie das Individuum von der Qual der Wahl und lässt es schlechthin als ein Geschöpf der Gruppe, als ein Gefäß sozialer Inhalte erscheinen.
Der Nachahmungstrieb als Prinzip charakterisiert eine Entwicklungsstufe, auf der der Wunsch nach zweckmäßiger persönlicher Tätigkeit lebendig, aber die Fähigkeit, individuelle Inhalte für sie oder aus ihr zu gewinnen, nicht vorhanden ist.
Der Fortschritt über diese Stufe hinaus ist der, dass außer dem Gegebenen, dem Vergangenen, dem Überlieferten die Zukunft das Denken, Handeln und Fühlen bestimmt - der teleologische Mensch ist der Gegenpol des Nachahmenden.
So entspricht die Nachahmung in all den Erscheinungen, für die sie ein bildender Faktor ist, einer der Grundrichtungen unseres Wesens, derjenigen, die sich an der Einschmelzung des Einzelnen in die Allgemeinheit befriedigt, die das Bleibende im Wechsel betont.
Wo aber umgekehrt der Wechsel im Bleibenden gesucht wird, die individuelle Differenzierung, das Sich-abheben von der Allgemeinheit, da ist die Nachahmung das negierende und hemmende Prinzip.
Und gerade weil die Sehnsucht, bei dem Gegebenen zu verharren und, das gleiche zu tun und zu sein wie die anderen, der unversöhnliche Feind jener ist, die zu neuen und eigenen Lebensformen vorschreiten will und weil jedes von beiden Prinzipien für sich ins Unendliche geht, darum wird das gesellschaftliche Leben als der Kampfplatz erscheinen, auf dem jeder Fußbreit von beiden umstritten wird, die gesellschaftlichen Institutionen als die - niemals dauernden - Versöhnungen, in. denen der weiterwirkende Antagonismus beider die äußere Form einer Kooperation angenommen hat.
Die Lebensbedingungen der Mode als einer durchgängigen Erscheinung in der Geschichte unserer Gattung sind hiermit umschrieben.
Sie ist Nachahmung eines gegebenen Musters und genügt damit dem Bedürfnis nach sozialer Anlehnung, sie führt den Einzelnen auf die Bahn, die Alle geben, sie gibt ein Allgemeines, das das Verhalten jedes Einzelnen zu einem bloßen Beispiel macht.
Nicht weniger aber befriedigt sie das Unterschiedsbedürfnis, die Tendenz auf Differenzierung, Abwechslung, Sich-abheben.
Und dies letztere gelingt ihr einerseits durch den Wechsel der Inhalte, der die Mode von heute individuell prägt gegenüber der von gestern und von morgen, es gelingt ihr noch energischer dadurch, dass Moden immer Klassenmoden sind, dass die Moden der höheren Schicht sich von der der tieferen unterscheiden und in dem Augenblick verlassen werden, in dem diese letztere sie sich anzueignen beginnt.
So ist die Mode nichts anderes als eine besondere unter den vielen Lebensformen, durch die man die Tendenz nach sozialer Egalisierung mit der nach individueller Unterschiedenheit und Abwechslung in einem einheitlichen Tun zusammenführt.
Fragt man die Geschichte der Moden, die bisher nur auf die Entwicklung ihrer Inhalte untersucht worden ist, nach ihrer Bedeutung für die Form des gesellschaftlichen Prozesses, so ist sie die Geschichte der Versuche, die Befriedigung dieser beiden Gegentendenzen immer vollkommener dem Stande der jeweiligen individuellen und gesellschaftlichen Kultur anzupassen.