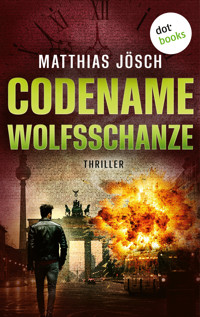
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie lauerten unter uns – nun ist ihr Moment gekommen … In Feuer, Schutt und Asche ist das Dritte Reich untergegangen – doch noch immer träumen Fanatiker davon, es in blutigem Glanz auferstehen zu lassen. Als BND-Kriminologe Adrian von Zollern eine harmlos wirkende Kiste antiquarischer Schallplatten ersteht, konnte er nicht ahnen, dass diese ihn in einen internationalen Wettlauf gegen die Zeit ziehen würden: An der Seite einer jungen Mossad-Agentin folgt er Hinweisen auf eine Organisation, die ihr Netz über die ganze Welt spannt. Dabei ist der Tod ihm stets auf den Fersen – denn ein Mann, der sich nur »der Sammler« nennt, glaubt, er sei im Besitz eines verborgenen Schlüssels zum Ende der Welt … Ein atemloser Verschwörungs-Thriller für alle Fans von Dan Brown.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
In Feuer, Schutt und Asche ist das dritte Reich untergegangen – doch noch immer träumen Fanatiker davon, es in blutigem Glanz auferstehen zu lassen. Eine junge Mossad-Agentin findet Hinweise auf eine schier unglaubliche Verschwörung und beginnt zu ermitteln. Von all dem ahnt der Mathematikdozent und BND-Mitarbeiter Adrian von Zollern nichts, als er in einem holländischen Antiquariat eine harmlos aussehende Kiste mit alten deutschen Schallplatten entdeckt. Doch schon kurze Zeit später muss er um sein Leben kämpfen – und gegen eine mächtige Organisation, die vor nichts zurückschreckt, um die Welt zu unterwerfen.
Originalausgabe Dezember 2014, August 2025
Copyright © 2014, 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/kasha_malasha, AVS-Images und AdobeStock/Mrs_DoubleF, ana, Noraryn
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ma)
ISBN 978-3-95520-678-9
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Matthias Jösch
Codename Wolfsschanze
Thriller
Prolog
Die Welt brennt.
Gerade hat er das sichere Gefängnis unter der Erde verlassen, denn da, wo sie ihn nicht finden und ihm nichts anhaben können, hat er es nicht mehr ausgehalten. Und nur ein paar Meter von dem dicken Schutzwall entfernt nehmen sie auch schon die Verfolgung auf, hetzen ihn und kommen immer näher.
Sein Atem geht schneller, als er hinter sich blickt. Sind sie das, dort im Schatten der toten Häuser?
Er weiß es nicht. Trotzdem verlangt er seinem Körper das Äußerste ab, um den Abstand zwischen sich und dem Bösen zu vergrößern.
Sie nähern sich schnell, das Prasseln ihrer Schritte auf dem gerissenen Asphalt dröhnt in seinen Ohren. Er hetzt weiter.
Sein Fuß, der ihm seit der Jugend große Probleme bereitet, wird nun zum Hindernis, aber er kennt seine Stadt und verschwindet in einer versteckten Gasse. Er durchquert die verkohlten Reste eines Säulengangs, hinter dem ihn die einsame breite Allee erwartet.
Er nimmt sich einen Augenblick Zeit, um zu verschnaufen, hebt zum ersten Mal die Augen und schaut auf seine Stadt.
Was für eine Veränderung!
Wo sind sie, die Millionen? Warum jubeln sie nicht wie früher aus den Fenstern und den zerbrochenen Mauern? Ist es zu viel verlangt, dass sie ihm den gebührenden Respekt zollen? Er weiß es nicht.
Nur eines ist sicher: Wenn es ihm in dieser Nacht wieder nicht gelingt, einen Ausweg zu finden, dann werden sie ihm ihre Liebe entziehen. Und was soll werden, wenn er ihre Liebe verliert?
Er hört das dumpfe Stampfen schwerer Stiefel aus dem Dunkel ganz in der Nähe und rennt weiter.
Der rote Stern geht auf.
Wieder keucht er. In dieser Nacht muss es gelingen.
Die rettende Idee. Der Ausweg. Wer außer ihm selbst wäre dazu in der Lage?
Der rote Stern gibt ihm und seinen Kameraden die Schuld, natürlich. Aber das ist eine Lüge, er weiß es. Denn der rote Stern selbst ist die Bedrohung, nicht das auserwählte Volk. Sie hatten es ihm gezeigt, mit der gewaltigsten Armee, die jemals die Weichsel nach Osten überquerte, doch er wollte es nicht verstehen. Nun versucht er, das ihm bestimmte Schicksal den Auserwählten aufzuzwingen. Aber sie hatten ihn längst durchschaut …
Jetzt hört er Stimmen. Seine verkümmerten Muskeln schmerzen, der Atem brennt, doch er muss weiter. Weiter, immer weiter, bis er einen Ort findet, den der rote Stern noch nicht heimgesucht hat. Wo er sich ausruhen und neue Kraft für ein Zeichen wider das Böse sammeln kann. Aber wo gibt es einen solchen Ort?
Er schaut nach oben. Jetzt hört er es.
Armageddon.
Es muss aufhören, dieses Höllenfeuer, mit dem der rote Stern die Auserwählten heimsucht und ihre Mission zu zerstören trachtet. Er hat es weit damit getrieben, doch umso tiefer wird er fallen.
Wenn er in dieser Nacht stark bleibt, dann wird der rote Bann gebrochen!
Wieder läuft er, aber drei Straßen weiter ist er mit der Kraft am Ende. Am Gendarmenmarkt setzt er sich auf die Stufen und betrachtet die Reste dessen, was einst der Deutsche Dom war. Von Osten rauscht in diesem Moment eine Feuersbrunst heran. Er zittert vor Kälte.
Dann hört er sie aus den Trümmern nach ihm rufen. Den Takt schlagen die Bomben, ihre Lieder singt der Feuersturm. Sie kriechen auf ihn zu.
Schon riecht er ihren stinkenden Atem, spürt die schauerliche Entschlossenheit, mit der der rote Herrscher im Osten sie in seine Richtung peitscht.
Sie sind da. Ihre gierigen Klauen packen ihn …
***
Es ist Magda, seine Frau, die ihn weckt. Sie trocknet ihm die nasse Stirn und redet leise auf ihn ein.
Der Reichspropagandaminister verspürt keine Erleichterung, als er merkt, dass alles nur ein Alptraum war. Gibt es überhaupt noch einen Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit?
Er hat Angst, denn er weiß, wie die Feinde über ihn, über seinen Glauben und über seine Ideale richten werden. Er weiß, dass man die Visionen des Führers nicht verstehen wird und dass alles, wofür er gelebt hat, mit Abscheu betrachtet werden wird. Und dass es untergehen wird.
Er weiß, dass es kein Licht in der Zukunft gibt, wenn er nicht dafür Sorge trägt, dass die Hoffnung dieses Armageddon überlebt.
Der gedämpfte Schein der Bunkerlampe zuckt im Rhythmus der Bombenexplosionen. Seine Augen sind tränenfeucht, während der unruhige Blick über die Wände aus kaltem Beton wandert. Als ob dort etwas zu lesen stünde, das er der schicksalhaften Ausweglosigkeit entgegenschleudern könnte, um ihr ein Ende zu machen.
Aber da ist nichts.
Fünf Meter tief in der Erde bebt der Stahlbeton im unaufhörlichen Artilleriefeuer des Feindes. Er versucht seine Gedanken zu sortieren, aber sein Geist ist müde, seine Kraft am Ende.
Wie nahe sie schon sind!
Darf der große Geist des Führers, der ein paar Räume weiter seine Hoffnung in eingebildete Armeeverbände und Großoffensiven setzt, mit uns sterben?
Der Traum ... der Traum! Ihm fallen Worte ein, die er geträumt hat: die rettende Idee.
Das weist ihm den Weg. Den Weg zu etwas, das beinahe vergessen ist und nur noch in den Köpfen einiger Erwählter schlummert.
Nibelunc!
Ein Ruck geht durch den Reichspropagandaminister, als ihm das Wort plötzlich aus den Tiefen der angeschlagenen Seele ins Bewusstsein dringt.
Vor einiger Zeit, als der Feind noch weit von den Reichsgrenzen entfernt stand, doch mit unverhohlener Aggression alles daransetzte, den Untergang des Reichs zu erzwingen, wurde eine Idee geboren. Eine Idee, die das Unvorstellbare in den Mittelpunkt stellte. Sein Plan war es gewesen …
Nibelunc!
Er denkt zurück an die erste Reaktion des Führers. Er war seinem Plan mit arger Skepsis begegnet und hatte ihn für das bloße Erwähnen einer möglichen Niederlage sogar des Hochverrats geziehen.
Wenige Monate später, als sich die ganze Welt gegen das Reich verschworen hatte und es von allen Seiten in die Zange nahm, hatte er seine Idee noch einmal vorgebracht.
Nibelunc!
Und nun fand er Gehör. In den folgenden Wochen entwickelten sie einen Plan, versammelten die Treuesten der Treuen und schworen sie auf ein Ziel ein, bereiteten alles für sie vor, damit sie eine goldene Zukunft ...
Plötzlich sitzt er kerzengerade. Magda erschrickt über sein aschfahles Gesicht. Jetzt ist ihm klar, was er zu tun hat.
Sie warten auf meinen Befehl! Ich muss handeln! Wenn ich es nicht tue, dann ...
Er setzt sich mit Magda an den Tisch. Schon wieder schüttelt sich der gewaltige Bunker tief in der Erde unter dem Stahlgewitter des Feindes, als ob es selbst dem Betonverlies davor graust, was sie hier gerade zu besprechen haben.
Sie reden lange und schauen sich dabei in die Augen. Sie beschließen, dass sich alles der gleißenden Hoffnung jener fernen Zukunft unterordnen muss, die der Plan verspricht. Einer Zukunft, die in weiter Ferne liegt, erfüllt von den Idealen, an die sie glauben. Einer Zukunft, die sie nicht mehr erleben werden.
Es ist beschlossen! Er wird den Befehl geben.
Anschließend werden sie ihre Kinder töten. Und sie werden sich selbst töten – und mit dem Wissen sterben, dass eines fernen Tages die Treuen die lodernde Glut des reinen Glaubens wieder entfachen werden.
Kapitel 1 Österreich und Amsterdam, Gegenwart
»Sie ist aufgetaucht! Seine Kiste. Die Schellackplatte. Es ist die erste Spur seit fünfzig Jahren ... Das Zeichen der Nibelunc!« Hs Stimme zitterte am Telefon, als er die Worte herauspresste.
»Hm. Gut.« Das Gesicht des Mannes, den die wenigen, die ihn kannten, den Sammler nannten, verfärbte sich dunkelrot. Um seinen Mund bildeten sich schaumige Blasen.
»Ich schicke Ihnen die Adresse.«
»Gut.«
»Besorgen Sie die Kiste und bringen Sie sie zu mir!«, befahl H und legte auf.
***
»Wo hast du dich wieder so lange rumgetrieben?«, keifte Helga, das herrische Weib des Sammlers.
Nach dem Telefonat mit H hatte er sich in seinen Transporter gesetzt und war von Wien aus zu seinem Haus gefahren, das in einem Waldgebiet vor den Toren der österreichischen Hauptstadt lag. Und jetzt stand er vor seiner Frau und nickte schuldbewusst wie ein unartiges Kind.
»Und du hattest es nicht nötig, dich zu melden?«, schrie sie ihn an. »Habe ich dir nicht befohlen, dass du dich melden musst?« Die bösartige Stimme überschlug sich beinahe, und er hoffte, dass es bald vorbei sein würde.
Er stellte sich oft vor, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er dieses Weib nicht geheiratet hätte – und dass es ihm nichts ausmachen würde, sie zu töten. Aber sie genoss Hs Vertrauen. Wenn er seiner Mordlust freien Lauf lassen würde, wäre das sein eigenes Ende.
Also hatte er sich in sein Schicksal ergeben und war im Lauf der Jahrzehnte zum devoten Hörigen seiner Gattin degeneriert. Gerade wollte er zu einer Erklärung ansetzen, da schlug sie ihm ins Gesicht. Die Tochter eines KZ-Leiters besaß viele Eigenschaften ihres Vaters, eines Mannes, den seine Opfer den Schlächter genannt hatten.
»Sofort in deinen Stall!«, befahl sie und lachte verächtlich.
Der Sammler verließ gehorsam das Haus. Im Gartenhäuschen betätigte er einen Hebel, worauf sich eine versteckte Luke öffnete, die den Blick freigab auf die Treppe, die in sein Reich hinabführte. Unten angekommen, setzte er sich in den abgenutzten braunen Ledersessel und hing seinen Gedanken nach, wie er das hier immer tat.
H, dessen richtiger Name Wilhelm Hartkorn lautete, hatte damals auf die Heirat gedrängt, und der Sammler kannte bis zum heutigen Tag den Grund dafür nicht. Wahrscheinlich lag es daran, dass H genau wusste, dass er bereit war, alles zu ertragen, um seine Leidenschaft zu befriedigen.
Nach einer Weile erhob er sich und ließ seine schweißigen Finger über einige Exponate gleiten, die in den Schränken und Vitrinen standen. An fast alle war er durch die Hilfe der Organisation gekommen. Mit den dürftigen Erträgen seines Bestattungsunternehmens hätte er das nicht bezahlen können, ganz abgesehen von der Tatsache, dass keins der Exponate zum Verkauf gestanden hatte. Er hatte sie den Eigentümern mit Gewalt entreißen müssen. Für jedes Teil seiner Sammlung hatte er einen Menschen erpresst oder ermordet.
Eine Hand wäscht die andere. Ich führe die Befehle der Organisation aus und bekomme dafür die Beute. Ein ewiger Bund.
Liebevoll betrachtete er seine Schätze. Aber ihr seid es wert!
Seine Miene verfinsterte sich, als er wieder an Helga dachte. Sie war bedingungslos den alten Idealen ergeben und befolgte jeden Befehl der Organisation. Er wusste genau, dass sie ihn töten würde, wenn man das von ihr verlangte. Neben der Beute war das ein weiterer Grund dafür, dass er tat, was sie von ihm forderten. Liefere H keinen Grund für diesen Befehl!
Der Sammler liebkoste seine Schätze mit Blicken und fragte sich, wie lange er noch bereit sein würde, die Erniedrigungen und die Schmach als Preis für seine Leidenschaft zu zahlen. Doch er wusste, dass diese Frage sinnlos war, denn es würde niemals enden. Nur der Tod konnte ihn erlösen.
Dann schloss er eine Zeitlang die Augen und konzentrierte sich auf die bevorstehende Aufgabe.
Eine Stunde später fuhr er zum Flughafen Schwechat und kaufte ein Ticket. Nach einer halben Stunde startete das Boarding seines Flugs nach Amsterdam. Währenddessen rief er sich das Wichtigste noch mal in Erinnerung: Wenn Hs Informationen richtig waren –und das waren sie immer –, dann erwartete ihn nach der Erledigung dieser Angelegenheit eine unglaubliche Belohnung, die Krönung seiner Sammlung! Sollte er hingegen versagen, dann erwartete ihn der Tod.
***
Cornelis, der Betreiber eines kleinen Antiquariats vis-à-vis der Norderkerk, einer beliebten Gegend an der Amsterdamer Prinsengracht, hatte sich auf den Verkauf alter Schallplatten, Bücher und allerlei Krimskrams spezialisiert. Betrat ein Kunde seinen winzigen Laden, schallte ihm sofort »Nieuwe Collectie« entgegen,die immer gleiche Begrüßung des Inhabers. Damit pries Cornelis seiner Kundschaft seit über fünfzig Jahren die Exponate an, die die uralten Holzregale seines Geschäfts füllten. Die Kunden schätzten den netten alten Herrn, der so aussah, wie Kinder sich den Weihnachtsmann vorstellten – obwohl sie genau wussten, dass er ihnen mit diesen beiden Worten meist nur die Ladenhüter unterjubeln wollte.
Mitten in der Nacht wurde Antiquar Cornelis von einem Geräusch geweckt, öffnete die Augen und blinzelte ins gleißende Licht einer Taschenlampe. Instinktiv schloss er die Augen, als sich jemand langsam über ihn beugte.
»Wo ist es?«, zischte eine Stimme.
Cornelis starb beinahe vor Angst.
»Wo ist es?«, wiederholte der Eindringling.
»Was?« Cornelis blickte nun direkt ins Gesicht des Mannes. Er hatte einen puterroten Kopf, und an seinem Mund waren feucht glänzende Bläschen.
»Wo ist der Schlüssel?«
»Sleutel?«, wiederholte Cornelis zitternd auf Niederländisch.
»Seine Kiste ... Schlüssel ... Schellack!«
Im fahlen Mondlicht, das durch die undichten Rollos hereindrang, sah Cornelis, wie der Mann nach dem Holzstuhl neben dem Bett griff und ihn mit einem Schlag gegen die Wand zertrümmerte. Mit einem Stuhlbein in der Hand kam er zum Bett zurück.
»Schlüssel ... Seine Kiste?«, fauchte er. Sein Gesicht war feuerrot und glänzte.
Cornelis schwieg.
Der Mann zog die Bettdecke weg und rammte ihm das Stuhlbein in den Bauch. Cornelis stöhnte vor Schmerzen.
»Kiste ... Schlüssel ... Schellack!«
»I-ich ... weiß nichts ...«
Ein kräftiger Hieb traf seinen Kopf.
Die Schmerzen verzerrten die Wahrnehmung des alten Mannes. Er verstand kaum noch, was gerade passierte. In den dichten Schleiern der aufziehenden Ohnmacht tauchten immer wieder zwei Worte auf.
Kiste. Schellack.
Die einzige Kiste mit Schellackplatten in letzter Zeit hatte er an einen langjährigen Stammkunden aus Deutschland verkauft.
»Verkauft«, flüsterte er mit schwacher Stimme. Er gab dem Eindringling ein Zeichen, dass er aufstehen und etwas holen wollte. Als er seinen Schreibtisch erreichte und die oberste Schublade öffnete, merkte Cornelis, dass Blut an seinem Kopf herunterlief. Er nahm den Plastikkasten mit der Kundenkartei und arbeitete sich mit zitternden Händen durch die Karteikarten bis zum Buchstaben Z. Er gab dem Einbrecher eines der Kärtchen mit dem Namen und der Anschrift des Stammkunden aus Berlin.
Der Fremde starrte die Karteikarte an. »Kiste ... Schlüssel?«, fragte er.
Cornelis nickte verzweifelt.
Dann schlug der Einbrecher in Rage auf Cornelis’ Kopf ein. Der letzte Schlag geriet so heftig, dass der Holzschaft des Stuhlbeins im zermalmten Schädel des Alten steckenblieb.
Cornelis zuckte noch einmal, dann starb er.
Kapitel 2 Berlin, Gegenwart
»Du hast es tatsächlich getan?«, fragte Sebastian Krix. Er war an diesem Morgen aus einem zweiwöchigen Urlaub nach Berlin zurückgekehrt.
»Ja«, antwortete Adrian von Zollern.
»Und?«
»Nichts und! Der Dekan hat es akzeptiert.«
»Er wollte dich nicht umstimmen?«
»Doch.«
»Aber?« Adrian antwortete nicht, und Sebastian merkte wohl, dass er nicht über die Kündigung sprechen wollte, die er vor einer Woche im Fachbereich eingereicht hatte. »Und, wie geht es dir jetzt?«
»Gut. Ich war erst mal drei Tage in Amsterdam, und seitdem spanne ich zu Hause aus.«
»Du hast bestimmt die Antiquariate gestürmt.« Sebastian lachte.
»Genau. Und du? Wie war es mit Violetta in Barcelona?«
»Schön. Sie ist mit mir nach Berlin gekommen. Und sie hat – leider – nach dir gefragt.«
»Ich würde euch beide gerne sehen. Morgen?«
»Violetta trifft einen Geschäftspartner. Aber ich komme heute Abend gerne vorbei«, antwortete Sebastian und legte auf.
Adrian von Zollern lehnte sich zurück und genoss die Ruhe. Nach einer langen Bedenkzeit hatte er vergangene Woche endlich den Entschluss zur Kündigung seiner Dozentenstelle für angewandte Mathematik an der Humboldt-Universität umgesetzt. Die zunehmende Bürokratisierung des Universitätslebens hatte ihn genervt und ihm die Freude an seinem Lehrauftrag genommen.
Nun lagen noch ein paar freie Tage vor ihm, bevor er sich in der kommenden Woche mit Karl-Werner Ponisega treffen wollte, um über neue Aufgaben zu sprechen. Zwischen dem Hauptabteilungsleiter des BND und ihm hatte bereits eine Verbindung bestanden, als Ponisega noch einen Lehrstuhl für Kriminalistik innehatte und sein Doktorvater wurde. Als der Professor aus dem akademischen Betrieb ausgeschieden war, waren sie in Kontakt geblieben. Gelegentlich arbeitete der ehemalige Doktorand seitdem an Fällen für ihn. Anfangs hatte es sich um theoretische Modelle oder statistische Analysen gehandelt, aber im vergangenen Jahr hatten sich seine Aufgaben verändert, und es wurde ein Vertrag geschlossen, der auch Außeneinsätze beinhaltete. In seinem ersten Fall wäre Adrian beinahe von einem Wahnsinnigen getötet worden, deshalb hatte er auf Befehl Ponisegas eine Grundausbildung für Agenten absolvieren müssen: Waffentraining, Schusswechselübungen, Angriffstechniken und Spionagetechnik.
Hm, Violetta, dachte er.
Sebastians Schwester war im vergangenen Jahr, kurz nach dem Abschluss des mysteriösen Ostrogón-Falls, von Barcelona nach Deutschland zurückgekehrt. Nach erfolgreicher Bewährung beim spanischen Ableger von Krix Industries stand sie nun an der Spitze der deutschen Holding des Familienunternehmens. Ihr Bruder hatte ihr während seines Urlaubs geholfen, die letzten persönlichen Dinge, die noch in der Firmenvilla in Barcelona verblieben waren, zu sortieren und nach Deutschland zu bringen.
Adrians Gedanken kreisten noch um sie, als sein Handy klingelte und das Display ihren Namen anzeigte.
»Puh, die Heimat hat mich wieder. Du glaubst gar nicht, wie sehr Sebastian mir beim Organisieren des Umzugs auf die Nerven gegangen ist. Würde ich meinen Bruder nicht so lieben, dann ...« Violetta lachte.
Adrian freute sich, ihre Stimme zu hören, und berichtete ihr von seiner Kündigung.
»Sebastian hat’s mir schon erzählt. Das ist die richtige Entscheidung. Es hat dir keinen Spaß mehr gemacht. Vielleicht wäre es etwas anderes, wenn du auf den Job angewiesen wärst, aber ...«
»Okay, das sind wir beide nicht. Trotzdem hatte es auch seine positiven Seiten.«
»Strich drunter!«, fasste Violetta zusammen und wechselte in einen sanfteren Tonfall. »Ich bin nachher mit einem Kunden verabredet. Was hältst du davon, wenn wir uns morgen treffen?« Ihre Stimme klang süß und verführerisch.
»Hm«, sagte Adrian, »da wird mir Sebastian bestimmt an die Gurgel gehen.«
»Ach ja, mein liebes Bruderherz. Immer der Beschützer«, antwortete Violetta mit bedauerndem Unterton.
Nach einigen Minuten Plauderei verabschiedeten sie sich. Adrian ging zum Plattenschrank, zog eine Platte heraus und legte sie auf. Dabei fiel sein Blick auf die alte Kiste mit den vielen Schellackplatten, die er aus Holland mitgebracht hatte. Weil ihm noch nicht der Sinn danach gestanden hatte, die Neuerwerbungen ins Regal einzusortieren, hatte er die Kiste vorerst zur Seite geschoben.
Während im Hintergrund Bruckners Vierte spielte, dachte er wieder an Violetta. Seit sie dauerhaft von Barcelona nach Mülheim an der Ruhr zurückgekehrt war, hatten sie sich ein paarmal getroffen. Sebastian war dagegen, weil er Adrians Eskapaden kannte und seine Schwester vor einer Enttäuschung bewahren wollte. Violetta war zehn Jahre jünger als Adrian und schon als Teenager in ihn verliebt gewesen.
***
Kurz nach neunzehn Uhr betrat er das Café Central. In seiner Lieblingskneipe gab es das beste Chili der Stadt und ein Getränk namens Café crème, das er liebte. Er winkte nach hinten, wo Sebastian bereits auf ihn wartete.
»Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis«, rief der ihm kommentarlos zu.
Adrian betrachtete ihn. Sie kannten sich seit Kindertagen, als sie gemeinsame Schuljahre auf einer Privatschule in Argentinien verbracht hatten. Sebastians Vater hatte damals die Ausweitung des familieneigenen Konzerns in Südamerika vorangetrieben, der jetzt von Violetta geleitet wurde. Ernst von Zollern, Adrians Vater, hatte den Vorsitzenden von Krix Industries unterstützt, in seiner Funktion als Leiter des Wirtschaftsressorts der Deutschen Botschaft in Buenos Aires. Die von Zollerns blickten ebenfalls auf eine lange unternehmerische Tradition zurück, hatten ihre Industriepapierwerke jedoch nach einem endlosen Familienzwist verkauft. Seitdem war Adrian finanziell unabhängig. Trotz ihrer langen Freundschaft überraschte Sebastian, der blonde Brillenträger mit dem überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten, ihn immer wieder mit Scherzen, die normalerweise jedes Humors entbehrten, oder mit einem lexikonartigen Wissen, dessen Anwendung nicht selten die Grenze zur Besserwisserei überschritt.
»Was?«, gab Adrian zurück. Die Gäste an den Nachbartischen schauten amüsiert zu ihnen herüber.
»Es ist das längste Wort in der englischen Sprache. Bedeutet so viel wie Quarzstaublunge. Wusstest du das nicht?«
»Aha«, meinte Adrian und schüttelte den Kopf.
Ein Mann am Tisch vor ihnen rief lachend herüber: »Klasse, der Typ!«
Schon lange hatte Adrian aufgegeben, die manchmal eigenartigen Gedankengänge seines Freundes nachzuvollziehen. »Sicher, Sebastian, das ist ungefähr so interessant wie die Tatsache, dass auf Hawaii ein Gesetz existiert, demzufolge es verboten ist, sich eine Münze in die Ohren zu stecken. Muss man das wissen?«
Sebastian gluckste. Das machte er immer, wenn ihm etwas nicht passte oder wenn er nervös war.
»Okay. Auf jeden Fall freue ich mich, dich zu sehen.«
Danach erzählten sie sich alles, was sich seit ihrem letzten Treffen zugetragen hatte.
Irgendwann sagte Sebastian: »Ich werde nie verstehen, warum du dich nicht einfach auf deinem Erbe ausruhst. Okay, klar, irgendwas musst du tun. Aber ausgerechnet eine aktive Tätigkeit beim BND? Ich meine, deine Professur für angewandte Mathematik hast du hingeworfen, aber eigentlich war das genau das Richtige für dich.«
Adrian warf ihm einen genervten Blick zu. »Das ist Geschichte. Ende. Es hat mich zu Tode gelangweilt. Und was hast du eigentlich dagegen, dass mein ehemaliger Doktorvater wieder mit mir arbeiten will?«
»Klar, Ponisega setzt sich als Hauptabteilungsleiter ja auch keiner persönlichen Gefahr aus. Dafür hat er schließlich Leute wie dich. Oder hast du schon verdrängt, was im vergangenen Jahr passiert ist?«
Adrian lächelte. »Du hast mir doch dabei geholfen. Und Violetta ebenfalls.«
»Was es nicht besser macht.«
Einige Sekunden lang tauchten die Ereignisse wieder vor Adrians geistigem Auge auf. Kurz nach der Unterschrift des Vertrags mit dem BND waren er und Sebastian zufällig Zeugen eines Mordes im Opernhaus geworden. Die Nachforschungen hatten sie um den gesamten Globus geführt, bis sie schließlich auf eine ungeheuerliche Verschwörung gestoßen waren. Sebastian und Violetta hatten Adrian unterstützt – und er hatte die beiden in Gefahr gebracht. Durch seine Schuld war Violetta schwer verletzt worden. Bei dieser engen Zusammenarbeit war die alte Leidenschaft zwischen ihr und ihm wieder aufgeflackert, was Sebastian unbedingt hatte verhindern wollen. Bei jeder Gelegenheit brachte er das zur Sprache. So wie jetzt.
»Okay, Adrian. Wir kennen uns seit ...«, er rechnete kurz nach, »… mehr als dreißig Jahren. Ich habe nicht mitgezählt, wie viele Frauen du unglücklich –«
»Stopp!«, unterbrach Adrian. »Du bist immer schnell dabei, von Unglück zu reden. Nenn mir nur eine Frau, die ich wirklich unglücklich gemacht habe oder der ich etwas vorgespielt hätte.«
»Violetta«, antwortete Sebastian scharf.
»Nein. Zwischen ihr und mir ist alles geklärt.«
»Du weißt ganz genau, dass sie aus irgendeinem Grund nicht von dir lassen kann. Ich bitte dich als dein Freund: Lass sie in Ruhe!«
Ein wenig ärgerlich trank Adrian den Rest des Café crème aus, dann stand er auf und umarmte seinen Freund. »Hast ja recht ...«
In diesem Augenblick zwinkerte die attraktive Begleiterin des Mannes, der sich vorhin über Sebastian amüsiert hatte, ihm zu. Er lächelte galant zurück.
***
Kurz nach dreiundzwanzig Uhr ging er zu Bett und schlief sofort ein. Gegen vier Uhr morgens schreckte ihn ein Geräusch aus dem Schlaf. Müde rieb er sich die Augen.
Mummtaz?
Der Graupapagei war ein lebendes Beweisstück des gefährlichen Abenteuers, das er im letzten Jahr bestanden hatte. Mummtaz hatte ursprünglich einem IT-Experten in New York gehört, der ermordet worden war. Jeder mochte das kleine Kerlchen, obwohl es stets lautstark auf sich aufmerksam machte, wenn man sich nicht um ihn kümmerte.
Plötzlich spürte Adrian, wie sich eine Gänsehaut auf seinem Körper bildete.
Irgendwas stimmt hier nicht.
Als er den langen Flur vom Schlafzimmer bis zur Küche zurückgelegt hatte, verstärkte sich sein Unbehagen. Berlin war niemals dunkel, nicht einmal in der tiefsten Nacht. Durch den diffusen Lichtschimmer konnte er Mummtaz sehen, der auf seiner Stange unruhig von einem Bein aufs andere wechselte. Von seinem Platz neben der Terrasse hatte der neugierige kleine Kerl einen guten Überblick über den Wohnbereich. Als er Adrian bemerkte, wurde er ruhiger.
Ihm stockte der Atem. Auf der anderen Seite des Wohnzimmers stand jemand, ein Mann. Er rührte sich nicht, so, als wäre er versteinert. Die unscharfen Umrisse seines riesigen Schattens, der sich über den hellen Teppichboden bis zur Wand ausbreitete, ließen Adrian erschauern.
Hat er mich gesehen?
Im selben Moment ging der Eindringling in die Hocke und zog etwas unter dem Plattenregal hervor.
Da ist nichts Wertvolles.
Aber der Einbrecher schnaufte aufgeregt. Offenbar machte er sich gerade an der Kiste zu schaffen, die Adrian in Amsterdam bei Cornelis erstanden hatte.
Adrian merkte jetzt, dass ihn der Schatten des Einbrechers getäuscht hatte. Der Kerl war höchstens eins siebzig groß. Soll ich ihn schnappen und ...?
Dann fiel ihm ein, was der BND für solche Fälle riet, und schlich zurück ins Schlafzimmer.
***
Der Blick des Sammlers schweifte von der alten Kiste zu dem niedrigen Tisch, der in Reichweite stand, und ihn überwältigte ein seltsames Gefühl. Gefühle spielten in seinem Leben eigentlich keine Rolle, umso mehr überraschte ihn die eigenartige Regung, die ihn bei diesem Anblick erfasste. Die Fotos auf dem Tisch weckten etwas in ihm. Es konnte daran liegen, dass er selbst niemals die Geborgenheit einer Familie gehabt hatte. Seine Mutter hatte ihn weggegeben, und er war bei Menschen aufgewachsen, die ihn nicht liebten und die er hasste. Mehrfach war er davongelaufen, doch sie hatten ihn immer wieder eingefangen.
Eines der beiden Fotos auf dem Tisch zeigte einen jungen Mann, den eine schöne Frau in mütterlicher Pose umschlungen hielt. Hinter ihnen lehnte ein älterer Herr mit ernstem Gesichtsausdruck an einem Stuhl und schaute mit liebevollem Blick auf die beiden herunter. Seine Erscheinung strahlte eine gewisse Noblesse aus, weswegen der Sammler vermutete, dass der Mann in seinem Leben wichtige Positionen bekleidet hatte.
Auf dem zweiten Foto, das viele Jahrzehnte alt sein musste, stand ein anderer Mann in Uniform neben einem Baum. Es war ein frühes Farbfoto mit verblasster Kolorierung, dennoch konnte der Sammler erkennen, dass der Mann in eine graue Uniform gekleidet war. Darüber trug er einen dicken, dunkelgrünen Mantel, dessen modischer Schnitt nicht zu dem zeitlos-militärischen Habitus seiner Dienstkleidung passen wollte. Er hatte eine soldatische Haltung angenommen, das Gesicht nach rechts gewandt, als würde er einen Punkt außerhalb des Fotos fixieren. Der Sammler folgte diesem Blick, der scheinbar hinüber zu den Menschen auf dem anderen Foto ging. Es kam ihm so vor, als fiele der gütige, wissende Blick einer längst vergangenen Epoche auf die nächste und die übernächste Generation. Ihm stach sofort die große Ähnlichkeit der drei Männer ins Auge.
Großvater, Vater und Enkel.
Den einzelnen Mann auf dem Foto schätzte er auf etwa fünfzig Jahre. Er nahm es aus dem Rahmen und betrachtete die Rückseite. April 1945.
Er selbst war 1943 geboren worden, in derselben Epoche, aus der das Foto stammte. Ja, siebzig Jahre war er schon alt.
Jetzt fiel sein Blick auf den unteren Rand der Foto-Rückseite.
Großvater, lieber Großvater, wo bist du? Mama sagt, du bist aus Kummer über Omas Tod verschwunden. Seit 1945! Ich würde so gern mit dir reden.
Die Zeilen waren von ungelenker Kinderhand geschrieben worden. Ihm selbst hatte man erzählt, dass seine Mutter gestorben war, als er noch ein Baby gewesen war.Er hatte sie nie gesehen.
Noch einmal betrachtete er die Kinderschrift, dann steckte er das Foto in seine Manteltasche. Anschließend wandte er sich wieder der Kiste zu.
Plötzlich hörte er ein schlurfendes Geräusch, das ganz gewiss nicht von dem unruhigen Papagei kam. Er schaute zur anderen Seite des Raums, wo das Wohnzimmer in die offene Küche überging, und nahm gerade noch einen menschlichen Schatten wahr, der in Richtung des Flurs verschwand. Er zog sein Messer und folgte ihm.
Kapitel 3 Tel Aviv, am Tag davor
Shari, eine der erfolgreichsten Agentinnen und zugleich die schönste Frau, die der israelische Geheimdienst in seinen Reihen hatte, saß am Abend noch spät an ihrem Schreibtisch und wusste nicht recht, was sie mit dieser Nachricht anfangen sollte.
Zur Abteilung 6 des Mossad, deren wichtigste Aufgabe es war, anti-jüdische Umtriebe in der ganzen Welt aufzuspüren und zu verfolgen, war sie auf ungewöhnliche Weise gestoßen, genauso ungewöhnlich wie die Tatsache, dass sie überhaupt in Israel lebte – denn ihr Aufgabengebiet war das Ausland.
Zunächst hatte Sharis Vater das Verhältnis zu ihrer Mutter, das sich auf wenige schwüle Karibiknächte beschränkt hatte, als schöne Urlaubserinnerung abgehakt. Dann aber war die Nachricht über Jadas Schwangerschaft in Israel eingetroffen. Ihr Vater, ein hochrangiger israelischer Justizbeamter, bekannte sich zu seiner Verantwortung und lud Jada nach Israel ein. Dort kamen sich die beiden näher, verliebten sich und heirateten kurze Zeit später. Sie führten eine harmonische und glückliche Ehe. Wenige Wochen nach Sharis zwölftem Geburtstag waren sie einem Sprengstoffanschlag palästinensischer Terroristen zum Opfer gefallen.
Bei der Beerdigung hatte Shari geschworen, ihr Leben dem Kampf gegen den Terrorismus in Israel zu widmen. Nach dem Abitur hatte sie daher politische Wissenschaften studiert und eine Agententätigkeit beim Schin Bet angetreten, dem Inlandsgeheimdienst des Staates Israel. Aber bald war in ihr die Überzeugung gereift, dass die eigentliche Bedrohung ihrer Heimat sich auf internationaler Ebene abspielte. Also hatte sie sich beim Auslandsnachrichtendienst Mossad beworben und war eingestellt worden.
»Das hier ist etwas für uns«, sagte sie zu Yona, der ihre Leidenschaft für ausgedehnte Büroabende teilte – solange sie anwesend war.
Yona stand auf und kam zu ihr herüber. »Hm«, brummte er und legte seine Hände auf ihre Schultern. Seit er vor drei Jahren in den Dienst des Mossad getreten war, versuchte er immer wieder, sie zu verführen, aber sie wies ihn jedes Mal zurück. Trotzdem starrte er sie immer mit eindeutigen Blicken an und suchte Körperkontakt.
»Nimm die Hände da weg!«, forderte sie in strengem Ton und zeigte ihm, was sie beschäftigte.
Yona überflog den Sachverhalt auf dem Bildschirm.
Seit der Gründung des Mossad im Dezember 1949 spülte das feingliedrige Netz der Agenten unablässig Informationen in den Stammsitz nach Tel Aviv, wo sie analysiert und, wenn erforderlich, Gegenmaßnahmen eingeleitet wurden. Dazu gehörten Hinweise auf Terroranschläge, die Bedrohung der Landessicherheit oder Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Judenverfolgung im Dritten Reich.
Der Mossad verfügte über mehr als vierhundert Überwachungscomputer, die weltweit die Telekommunikation auf bestimmte Schlüsselbegriffe hin abklopften. Eines dieser Geräte hatte gestern ein Gespräch aus Südamerika aufgezeichnet und anschließend eine interne Überprüfung ausgelöst. Zuerst war der leitende Kommunikationsoffizier in Tel Aviv der Frage nachgegangen, warum das Gespräch überhaupt aufgezeichnet worden war. Er bewertete das, was er auf dem Band hörte, als einen seltsamen, wirren Dialog zwischen einem Anrufer aus Argentinien und einem Mann in Wien. Dann war das Handysignal des Österreichers nach dem Anruf plötzlich nicht mehr zu orten gewesen. Der Argentinier hatte über eine Internetverbindung telefoniert, der Server stand in Buenos Aires. Von Israel aus war es unmöglich, den Anrufer zu ermitteln.
Argentinien. Nicht zurückverfolgbare Verbindung, hatte der Offizier notiert und, weil er sonst nichts Verdächtiges fand, die Priorität als mittel eingestuft und schließlich einen Hinweis über den Vorgang an Shari geschickt, damit sie die möglichen Hintergründe der Telefonaufzeichnung abklopfte.
Yona räusperte sich. »Hast du schon die Arch–«
»Klar. Ich habe jedes Wort als Suchbegriff durch die digitalen Archive geschickt. Aber Kiste, Schellackplatte oder Zeichen ergeben weder einzeln noch als Gesamtheit einen Sinn. Aber achte mal auf das Wort nach Zeichen.« Shari spielte ihm die MP3-Datei vor, die der Kommunikationsoffizier von dem Telefonat angefertigt hatte.
»Hab ich nicht verstanden«, kommentierte Yona.
»Noch mal. Hör genau hin!«
»Nibelunc...?«
»Exakt.«
»Und?«
»Ich bin bei meinen Recherchen über einen deutschen Funkspruch gestolpert, den der britische Geheimdienst abgefangen und entschlüsselt hat und den wir bei uns archiviert haben. Da ging es auch um dieses Nibelunc.«
»Stammt der auch von gestern?«, fragte Yona.
»Nein, ganz und gar nicht.«
»Sondern?«
»Aus dem Jahr 1945.«
Yona schwieg. »Und jetzt?«, fragte er nach einer Weile.
»Irgendwas stimmt da nicht. Ich will wissen, was dahintersteckt.« Shari schenkte ihm ihr unwiderstehliches Lächeln. »Und ich will, dass wir die Sache gemeinsam untersuchen.«
Kapitel 4 Aus den Aufzeichnungen des S
15. April 1940
Bei Sonnenaufgang brachte man uns zur Wewelsburg. Bereits der erste Anblick des alten Bauwerks beeindruckt mich tief. Natürlich bin ich aufgrund meines Studiums der Kunstgeschichte vertraut mit dem Schönen in unserer Welt, und die vielen Dienstjahre im diplomatischen Dienst, besonders in den alten Städten Osteuropas, haben mich mit der Schönheit zahlloser repräsentativer Bauten vertraut gemacht. Dennoch bildet diese klassische Burg einen erhabenen Glanzpunkt, der unter all dem bisher Vertrauten nicht seinesgleichen kennt. So muss eine deutsche Burg aussehen! Von hier strahlt die Kraft in die Welt hinaus, die vom neuen deutschen Wesen ausgeht.
Der überwältigende Eindruck setzt sich im Inneren fort. Eine moderne und dennoch dem Urmythos des Menschen verpflichtete Kraft und Schönheit geht von diesem Ort aus. Es greift mir ans Herz!
Noch immer sind alle wie elektrisiert.
Wir hofften mit Spannung darauf, den Grund zu erfahren, weshalb man uns von unseren Aufgaben wegbefohlen und mit einem Sonderbefehl des Reichsführers SS hierher beordert hat. Sechsunddreißig Männer, mich eingeschlossen, sind aus dem gesamten Reich nach Büren gebracht worden.
Am Vormittag führte man uns in den Nordturm, wo sich der Obergruppenführersaal befindet. Von Ehrfurcht erfüllt, nahmen wir Aufstellung entlang der zwölf Marmorsäulen, die das mächtige Gewölbe stützen.
Dann trat er ein.
Der Reichsführer SS schritt in die Mitte des Saals, in den Kreismittelpunkt, den wir, seine Untergebenen, um die Schwarze Sonne bildeten. Als er exakt im Zentrum der Sonne stand, entbot er den Hitlergruß. Wir antworteten mit bebenden Stimmen, so sehr berührte uns, was wir fühlten. Die Magie der Schwarzen Sonne erfasste uns. Was für ein mächtiges Symbol!
Sie ist zusammengesetzt aus der symmetrischen Anordnung des Zeichens, das uns alle vereint: der Siegesrune! Zwölf schwarze Runen treffen in der Mitte des grauen Marmors zusammen und bilden ein perfektes Rund.
Dann begann der Reichsführer SS zu reden.
Er sprach über die Erfolge einer Arbeitsgruppe, die er Ahnenkult nannte. Auf sein Zeichen tauchte der Leiter dieses Programms neben ihm auf. Ich vermute, dass im Boden ein Mechanismus versteckt ist, wie man es von Theaterbühnen kennt. Der brachte den Mann wie von Zauberhand aus der Gruft, die sich unter dem Saal befindet, in unsere Mitte – ein schöner dramaturgischer Effekt. Diesem Mann mit dem SS-Namen Weisthor übertrug er die Aufgabe, uns über die erheblichen Anstrengungen ins Bild zu setzen, die diese Gruppe unternommen hat, um die geschichtliche Bedeutung des Germanentums zu erforschen.
Weisthor erhielt für seine Ausführungen zur wissenschaftlichen Hexen- und Germanenforschung, aber auch für seine rassekundlichen Beiträge unseren Applaus.
Dann spürten wir, dass der Moment gekommen war, da wir die Gründe für unsere Anwesenheit an diesem Ort erfahren sollten. Der Reichsführer SS stand inmitten der Schwarzen Sonne und sprach von der »Geheimen Reichssache Burgund«. Weder ich noch meine fünfunddreißig Kameraden hatten zuvor etwas davon gehört.
Unter Karl Maria Willigus’ Leitung, so der bürgerliche Name Weisthors, hatten vierundzwanzig Wissenschaftler in mehrjähriger Arbeit die mittelalterliche Geschichte erforscht, dabei zahlreiche Bibliotheken, aber auch mystische Orte und private Sammlungen besucht und durchforstet, auf der Suche nach Spuren von etwas, dessen Fund den Reichsführer SS auf »ewig in den Rang einer der bedeutendsten Historiker hebt«, wie er es formulierte.
»Jeder von Ihnen hat sich aufopferungsvoll in den Dienst meiner Organisation gestellt und sich somit im Deutschen Reich bewährt. Sie sind auserwählt worden, beim letzten Abschnitt von ‚Burgund’ dabei zu sein. Sehr bald wird es so weit sein!«, rief er uns zu.
Er beließ es bei Andeutungen über Burgund, blickte uns nacheinander fest in die Augen und fuhr fort: »Unsere Grabungen beginnen morgen früh. Mit dem, was wir finden werden, schmücken wir den Altar unserer Religion. Unsere Macht wird unendlich sein.«
Was für erhabene Worte der Reichsführer an uns gerichtet hat!
Ich weiß nun, dass Großes auf uns wartet.
Kapitel 5 Berlin, Gegenwart
Vor etwa sechzehn Stunden waren Shari und Yona in Berlin gelandet, nachdem das Ortungssignal des Österreichers auf einmal in der deutschen Hauptstadt aufgetaucht war. Noam, ein Botschaftsangestellter, hatte sie am Flughafen erwartet und zur israelischen Botschaft in die Auguste-Viktoria-Straße gebracht, wo die zuständigen Mitarbeiter bereits einen Abhörwagen mit der entsprechenden Ausrüstung vorbereitet hatten. Shari hatte die Schiebetür an der Seite des Vans geöffnet und alles überprüft. Mikrofone, Wanzen, zwei Pistolen, eine Halbautomatik sowie ein paar andere nützliche Dinge lagen im doppelten Boden, den man mit einem versteckten Griff unter dem Feuerlöscher öffnen konnte.
Am späten Nachmittag hatte Shari unwirsch den Kopf geschüttelt. »So was habe ich auch noch nicht erlebt. Vorgestern, beim Abhören des Telefonats, hat der Überwachungscomputer die Position des Mannes noch in Wien angegeben. Aus irgendeinem Grund hat das Mistding dann einen ganzen Tag lang seine Ortung verloren ... Nicht zu fassen!«
»Und dann taucht er plötzlich in Berlin auf.«
»Genau.«
Sie hatten den unauffälligen VW-Transporter auf dem Parkstreifen gegenüber einem großen Wohnhaus in der Torstraße abgestellt, an dem der Kerl offenbar herumgeschnüffelt hatte. Yona und Shari hatten ihn dabei beobachtet, wie er die Klingeltafel am Eingang studierte. Er interessierte sich für einen Bewohner des Hauses.
Sie fotografierten daraufhin jeden, der dieses Haus betrat oder verließ, und schickten die Bilddateien ins Hauptquartier nach Tel Aviv. Dort überprüfte ein Innendienstagent innerhalb weniger Minuten, ob gegen diese Personen etwas vorlag. Keine der bisher überprüften vierundzwanzig Personen galt beim Mossad als verdächtig. Auch der kleine Mann aus Österreich nicht.
Gegen zwanzig Uhr hatte er sich auf eine Bank gesetzt und sie nicht mehr verlassen. Es sah aus, als ob er das Haus beobachtete. Für die beiden Mossad-Agenten wurde die Zeit danach zur Qual. Kurz nach Mitternacht nutzte Yona die Gelegenheit für eine seiner Avancen.
»Lass das!«, sagte Shari, funkelte ihn böse aus ihren pechschwarzen Augen an und schob seine Hand von ihrem Oberschenkel. Yona grunzte unwillig, obwohl er sehr wohl wusste, wie sie auf Annäherungsversuche reagierte. »Shari, wie hast du das gemeint?«
»Genauso wie heute und bis in alle Ewigkeit: dass du deine Finger bei dir behalten sollst!«
»Nein. Ich meine die Sache mit dem alten Funkspruch und Nibelunc.«
»Ach das. Nun ja, 1945, drei Jahre vor Gründung des Staates Israel, hat der britische Geheimdienst MI6 in Bletchley Park, dem Hauptquartier während des Zweiten Weltkriegs, einen seltsamen Funkspruch aus Deutschland abgefangen und entschlüsselt.«
»Und wie sind wir in den Besitz dieser Nachricht gelangt?«
Sie blickte ihn verwundert an. »Natürlich auf demselben Weg, wie wir immer an die Nachrichten fremder Staaten kommen.«
»Und was stand darin?«
Sie zitierte: »Nibelunc, sehet die dunkle Seite von Babel.«
Yona zog eine Grimasse. »Hä?«
Beim Anblick seines ratlosen Gesichts musste Shari lachen. »Du bist nicht der Erste, der bei diesem Satz so dreinschaut. Generationen von Agenten haben erfolglos versucht, hinter den Sinn zu kommen.«
»Aber wieso stufst du es dann als so wichtig ein?«
»Einmal wegen des Absenders«, antwortete sie und hob auffordernd die Augenbrauen.
»Nun sag schon.«
»Der Funkspruch kam direkt aus dem Führerhauptquartier.«
»Oh.«
»Zweitens wegen der Verschlüsselungsmaschine.«
»Die Enigma?«
»Nein. Die Lorenz-Maschine. Die meisten Leute denken, dass die Enigma damals die am weitesten entwickelte Verschlüsselungsmaschine war, aber das stimmt nicht. Für den obersten Führungskreis der Nazis hatten die besten deutschen Ingenieure etwas ganz Besonderes entwickelt, viel geheimnisvoller und viel seltener als die Enigma: die Lorenz-Maschine. Davon wurden nur fünfundzwanzig Stück gebaut und –« Ihr Blick fiel auf den Österreicher, der sich nach mehr als acht Stunden auf der Bank gerade erhob. Sie gab Yona ein Zeichen. »Er geht ins Haus.«
***
Adrian hastete zurück ins Schlafzimmer. Hinter sich hörte er die eiligen Schritte des Fremden. Der Bereich seines Gehirns, der vom ausströmenden Adrenalin und der drohenden Panik verschont blieb, befahl ihm: Bleib ruhig. Folge der BND-Anweisung!
Im Schlafzimmer schaute er über die Schulter zurück. Der Einbrecher war keine drei Meter mehr von ihm entfernt, in seiner Hand glänzte etwas.
Ein Messer!
Mit zitternden Händen tastete Adrian am unteren Ende des Bettkastens entlang. Direkt hinter ihm schnaufte der Mann.
Wo ist es, um Himmels ...?
Plötzlich spürte er den feuchten Griff einer kräftigen Hand auf seinem Arm.
Verdammt, wo ...?
Er drehte den Oberkörper und schlug dem Angreifer die Faust ins Gesicht.
Nur noch ein paar Sekunden ...
Doch der andere rappelte sich sofort wieder auf. Im selben Moment spürte Adrian unter seinen Fingern das Plastikkästchen mit dem Knopf und drückte darauf.
Gott sei Dank!
Der Moment der Erleichterung währte nur kurz, denn eine Sekunde später packte der Einbrecher ihn von hinten mit einem stählernen Griff, der ihm beinahe den Brustkorb zuschnürte. Gleichzeitig drückte er ihm mit der anderen Hand die Schneide des Messers an den Hals.
»Wo ist es?«, schnarrte er.
Obwohl Adrian das Gesicht nicht sehen konnte, wusste er, dass der Mann sehr erregt war. Die Stimme zitterte, doch der Griff blieb unnachgiebig. Er spürte den Schweiß des anderen am Hals.
»Was?«, fragte er.
»Das Zeichen ... sein Schlüssel!«
Obwohl sich die Worte wie das Gefasel eines Übergeschnappten anhörten, jagten sie Adrian eine Gänsehaut über den Rücken. »Was für ein Zeichen? Welcher Schlüssel?«
Der Mann zischte etwas Unverständliches, und im selben Moment spürte Adrian Feuchtigkeit auf dem Gesicht.
»Keine Lügen. Ich habe seine Kiste gesehen! Dort!« Er nahm das Messer von Adrians Hals und zeigte damit in Richtung Wohnzimmer. »Dort!«
Fieberhaft überlegte Adrian, was der Kerl wohl meinte. Dann erinnerte er sich, dass er im Wohnzimmer die alte Kiste aus Amsterdam durchwühlt hatte. »In der Kiste?«
Jetzt nickte der Einbrecher. »Seine Kiste!« Plötzlich riss er Adrian nach oben, bis er wieder auf den Füßen stand. Dann presste er ihn gegen die Wand, hielt ihm die Klinge an den Hals und brüllte: »Schlüssel, der Schlüssel!« Der Schweiß lief ihm in Strömen übers Gesicht.
Adrian sah in das dunkelrote Gesicht und betrachtete voller Abscheu die aufgerissenen Augen und den Speichel, der dem Einbrecher aus dem Mund spritzte.
»Die Kiste habe ich aus Amsterdam. Darin ist kein Zeichen und auch kein Schlü–«
Der Mann schlug ihn und drückte ihm die Klinge fest gegen den Hals, so dass Adrian unter der kalten Schärfe der Schneide zusammenzuckte. Nach einem kurzen, stechenden Schmerz tropfte warmes Blut auf den Fußboden.
***
Als der Mann ins Haus gegangen war, hatte Shari sich ihr Nachtsichtgerät, das Handy und ein paar andere Dinge geschnappt und zu Yona gesagt: »Du bleibst im Wagen und behältst die Gegend im Auge. Ich gehe nach vorne und überwache den Eingang.«
Eigentlich hatte sie dem Fremden gleich ins Haus folgen wollen, doch dann war sie auf der Straße stehen geblieben und hatte sich die eiserne Grundregel des Mossad in Erinnerung gerufen: Kein unnötiges Eingreifen auf fremdem Staatsgebiet.
Seitdem waren etwa zehn Minuten vergangen. Da näherten sich urplötzlich zwei Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit. In letzter Sekunde gelang es Shari, sich hinter einem Spindelstrauch zu verstecken, dessen rötliche Blätter im fahlen Licht der Straßenlampe merkwürdig grau wirkten. Aus einem Mannschaftswagen der Polizei sprangen sechs Bewaffnete mit Kampfanzügen und Masken, die ins Treppenhaus stürmten. Offenbar machten sie drinnen keinen Lärm, denn im Haus blieb alles dunkel. Aus dem PKW stieg ein ausgesprochen dicker Mann mit einem auffälligen Bart, zündete sich eine Zigarette an und folgte den anderen mit gemächlichen Schritten ins Haus.
Auf einmal hörte Shari einen gedämpften Knall aus dem obersten Stock.
Sie haben eine Tür aufgebrochen oder gesprengt.
Ein paar Sekunden später wurde es hell in einer Wohnung, deren Fensterfront zur Torstraße zeigte. Durch den Spalt eines angelehnten Fensters drangen Geräusche bis zur Straße. Im selben Augenblick bemerkte sie, wie Yona aus dem Transporter stieg und in ihre Richtung gerannt kam.
Wieder zerriss ein Geräusch die Stille der Nacht. Diesmal war es lauter und näher.
»Da!«, sagte Yona und zeigte nach oben. Schemenhaft war eine zersplitterte Glasscheibe zu erkennen.
Shari starrte hinauf und entdeckte in der spärlichen Straßenbeleuchtung eine Gestalt, die auf der Feuerleiter nach unten kletterte. Sie schaltete das Nachtsichtgerät ein und hielt es in Richtung der zerstörten Scheibe. Offenbar war der Flüchtende durch das Glas gesprungen. Nun tauchten in dem leeren Rahmen zwei Gestalten auf und machten sich an die Verfolgung.
»Das ist der Kerl! Auf der Treppe!«, flüsterte sie Yona zu.
***
»Kleinert, Machinski, hinterher!«, schrie Kriminalhauptkommissar Clemens Ordna. Gerade hatten seine Männer die Tür zu Adrian von Zollerns Wohnung aufgebrochen und sie mit einem lauten Knall gegen die Flurwand prallen lassen. Dann war drinnen ein Mann aufgesprungen, und bevor Ordna verstand, was der Kerl vorhatte, splitterte Glas und der Bursche verschwand nach draußen.
»Es dauert nicht lange, Zollern, dann haben wir ihn«, versprach er.
»Danke, Herr Ordna«, antwortete Adrian von Zollern erleichtert und tastete an seinem Hals nach der Wunde. »Puh ... Sie sind wirklich im richtigen Moment aufgetaucht. Ein paar Sekunden später und er hätte mir wahrscheinlich den Hals aufgeschlitzt.«
»Machen Sie mal halblang«, sagte der Kriminalhauptkommissar lakonisch und rollte mit den Augen. »Typisch für einen Bleistiftschwenker wie Sie. Macht sich sofort in die Hose.«
Ohne auf das boshafte Verhalten des Polizeibeamten einzugehen, schaute Adrian ihn an. Die beiden Männer kannten sich seit langem, und seit ihrer ersten Begegnung herrschte ein unterkühltes Verhältnis zwischen ihnen. Aus Adrians Sicht beruhte das hauptsächlich darauf, dass Clemens Ordna ein intriganter und hinterhältiger Mistkerl war.
»Zum Glück hat Ponisega mich vom Einbau des Stillen Alarms überzeugt. Nach den heftigen Übergriffen in der Ostrogón-Affäre im letzten Jahr hat er mir keine Wahl gelassen. Wenn ich den vorhin nicht ausgelöst hätte ...«, erklärte er dem Kommissar, der gerade einen tiefen Zug aus seiner Zigarette nahm.
»Zollern, in Zukunft verschwenden Sie meine Zeit nicht mehr mit einer Lappalie wie einem Einbruch, klar?«
Schon oft hatte Adrian den Tag verwünscht, an dem sich sein Weg mit dem des gebürtigen Leipzigers gekreuzt hatte. Seit er mit Ponisega zusammenarbeitete, war der Kriminalhauptkommissar sein Ansprechpartner in polizeilichen Angelegenheiten, und er ließ den Kommissar spüren, dass er wenig von seiner dunklen Vergangenheit in Diensten der DDR hielt. Man munkelte, dass Clemens Ordna eng mit der Stasi zusammengearbeitet hatte.
»Sie ...«, Ordna schaute den Beamten an, der mitten im Zimmer stand, und wedelte mit einer Hand in Richtung Adrian, »... bleiben hier und passen auf den da auf.« Dann drehte er sich um und verließ die Wohnung.
***
Der Flüchtende war auf der Höhe des ersten Stockwerks plötzlich stehen geblieben. Shari beobachtete, wie er in die Tasche seines Mantels griff und eine Pistole mit Schalldämpfer herauszog. Bevor sie etwas unternehmen konnte, zuckte der rechte Zeigefinger des Mannes zweimal. Weiter oben auf der Feuertreppe gingen im selben Moment die beiden Verfolger zu Boden. Offenbar hatte der Fremde sie in die Unterschenkel geschossen. Sie schnitten schmerzhafte Grimassen und schienen Schwierigkeiten beim Aufstehen zu haben.
Dann drehte der Mann sich in ihre Richtung. Durch das Nachtsichtgerät schaute sie ihm direkt ins Gesicht und erschrak. Es glänzte feucht, und sein Kopf war so rot, dass er kurz vor der Explosion zu stehen schien.
Jetzt kam er direkt auf sie zu. Als er fast an dem Spindelstrauch vorbeigerannt war, sprang sie ihm in den Weg.
Im Bruchteil einer Sekunde wich der Flüchtende ihr aus und drehte sich um. Shari sah noch die winzige Stichflamme aus dem Schalldämpfer, dann fiel sie auf den Fußweg.
***
Der Puls des Sammlers raste, als er sich umdrehte und weiterrannte. Er schwitzte stark. Der Mann, der jetzt neben der Frau kniete, die er niedergeschossen hatte, machte keine Anstalten, ihn zu verfolgen. Nach ein paar Metern bog er in eine Seitenstraße ab. Ich habe versagt! Helga und H werden mich ...
Er wusste, dass die Belohnung, die Krönung seiner Sammlung, jetzt in weite Ferne gerückt war.
Er hetzte weiter die Seitenstraße entlang und schaute sich um. Sein Blick glitt über die geparkten Autos am Straßenrand. Fünfzig Meter weiter stand ein Cabriolet mit einem Oldtimerkennzeichen. Dort blieb er stehen und schlug mit dem Ellbogen das Fenster auf der Fahrerseite ein.
***
Adrian hatte sich gerade ein Pflaster aus dem Medizinschrank geholt und auf die Schnittwunde am Hals geklebt, als sein Handy klingelte.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Karl-Werner Ponisega sofort. Sein Chef klang abgespannt und irgendwie merkwürdig.
»Ja. Das Einsatzkommando ist zur rechten Zeit eingetroffen.«
»Wirklich? Hm, eigentlich wollten wir uns ja erst in der kommenden Woche über einen weiteren Einsatz unterhalten ...« Der Hauptabteilungsleiter wartete einen Moment, bevor er mit ernster Stimme fortfuhr: »Ist das ein neuer Fall?«
»Kann ich mir nicht vorstellen«, antwortete Adrian, obwohl er sich nicht sicher war. »Wahrscheinlich nur ein durchgeknallter Einbrecher, der irgendwas stehlen wollte.«
»Wenn so weit alles okay ist, dann kommen Sie doch morgen in mein Büro. Wir gehen die Angelegenheit durch.«
Er hört sich ausgebrannt und schlapp an, dachte Adrian, nachdem sie sich verabschiedet hatten.
Durch das zerstörte Fenster drang kühle Luft in die Wohnung. Adrian schaute auf die Straße hinunter. Von der Feuertreppe drang das Stöhnen der Männer herauf, die den Einbrecher hatten verfolgen sollen. Unten, neben dem prächtigen Spindelstrauch, den die Eigentümergemeinschaft vor ein paar Jahren gepflanzt hatte, lag jemand am Boden. Eine zweite Person kniete daneben und redete offenbar auf den Verletzten ein.
***
»Yona, verfolge ihn mit dem Transporter! Ich ruhe mich einen Moment lang auf der Bank aus, auf der dieser Kerl gesessen hat.« Shari erhob sich stöhnend und nestelte an ihrer schusssicheren Weste herum.
Ein paar Sekunden später raste Yona los und stoppte erst an der Ecke zur Gartenstraße, in die der Mann verschwunden war. Dann sah er ihn auch schon und bremste vorsichtig.
Der Verdächtige lehnte an einem Oldtimer, sein Arm steckte im Seitenfenster, das er offenbar eingeschlagen hatte. Schließlich sprang die Fahrertür auf, und er stieg ein. Die Bremslichter des Oldtimers leuchteten auf, und der Wagen gewann so schnell an Tempo, dass er aus dem Sichtbereich zu verschwinden drohte.
Mit einer kurzen Verzögerung folgte Yona dem Wagen und den kleiner werdenden Rücklichtern.
Der Österreicher raste mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Gartenstraße, die in einen Kreisverkehr mündete. Von da aus hielt er sich zunächst in südwestlicher Richtung und bog nach einem Zickzackkurs schließlich in die Müllerstraße ein. Nach etwa eineinhalb Kilometern wechselte er wieder die Richtung, indem er der Neunzig-Grad-Abbiegespur auf die Seestraße folgte.
Yona achtete auf einen Sicherheitsabstand, ohne zu riskieren, dass er den anderen aus den Augen verlor. Nach einem weiteren Kilometer, bevor es rechts in den Saatwinkler Damm ging, sah er die Hinweisschilder. Jetzt verstand er, wohin der Mann wollte.
Ein paar Minuten später erreichten sie den Abflugbereich des Flughafens Berlin-Tegel. Der Fremde stellte das gestohlene Fahrzeug in der Halteverbotszone vor dem Eingang ab und ließ die Fahrertür offen.
Offensichtlich hatte er Yona nicht bemerkt, denn er schaute sich nicht ein einziges Mal um.
In der Abflughalle stellte sich der kleine Mann in die Schlange vor einem Ticketschalter. Yona tat dasselbe.
Anschließend tippte er eine Nachricht an Shari. Abflug 7:30 Uhr. Ziel: Wien. Ich fliege mit.
Kapitel 6 Aus den Aufzeichnungen des S
16. April 1940
Ich füge meinen Aufzeichnungen nachfolgend ein Dokument mit Weisthors Ausführungen über die Hintergründe der bevorstehenden Grabungen bei. Der Adjutant des Reichsführers SS hat es uns nach dem Morgenappell überreicht. Außerdem übermittelte er uns den Befehl, dass wir uns von nun an in drei Staffeln mit jeweils zwölf Männern zu organisieren haben. Diese Staffeln werden von mir und zwei weiteren Obersturmbannführern angeführt.
»Kameraden,
sowohl die Geschichtsforschung als auch die Archäologie haben sich mit dem Mythos der Nibelungen und deren unvergleichlichem Hort bis zum heutigen Tag ohne verwertbare Resultate beschäftigt. Wenn die alten Mythen im Kern die Wahrheit enthalten – und wir haben Belege, dies anzunehmen –, dann wird es das Deutsche Volk sein, das sie den Nebeln der Geschichte entreißt! Genauso wird es unser Volk sein, das ihre segensreiche Wirkung im Geiste des Führers einsetzt.
Das Nibelungenlied macht eine Angabe zu dem Ort, wo der Hort in den Rhein versenkt wurde: »da zem Lôche«. Im heutigen Sprachgebrauch bedeutet das »bei dem Loche«, also ein Ort in der Nähe einer Höhle oder einer Untiefe des Rheins. Dorthin zog Hagen die vollbeladenen Wagen: unvorstellbare Mengen an Gold, Edelsteinen und Juwelen. Einige Quellen sprechen sogar davon, dass er auch Siegfrieds Schwert und seine Tarnkappe mit dem Hort im Rhein versenkte.
Nach der Auswertung aller Quellen haben wir fünf mögliche Orte gefunden, die in Frage kommen. Kameraden von Ihnen haben bereits tiefe Gruben in einen Acker bei Rheinbach getrieben und die Höhlensysteme bei Soest untersucht. Doch sie fanden dort nichts.
Nun, da diese Möglichkeiten ausgeschlossen werden können, werden Sie und Ihre Männer die Arbeiten bei Lochheim beaufsichtigen. Dort werden die drei von Ihnen kommandierten Staffeln graben. Dort, wo einst der Rhein eine Biegung machte, die seit Jahrhunderten versandet ist, ruht mit hoher Wahrscheinlichkeit der Schatz.
Sie, verdiente Obersturmbannführer und Auserwählte des Reichsführers SS, werden Zeugen der größten historischen Sensation dieses Jahrhunderts!
Karl Maria Weisthor«
Kapitel 7 Berlin, Gegenwart
Nachdem Shari Yonas Nachricht gelesen hatte, forderte sie unverzüglich einen Ersatz für ihn an.
Zunächst schlug man ihr Noam vor, den jungen Mann, der sie gestern vom Flughafen abgeholt hatte. Das lehnte sie ab, weil seine Einsatzerfahrung zu gering war. Ein paar Minuten später erhielt sie die Mitteilung, dass man Itay aus Frankreich abziehen und er gegen Mittag in Berlin sein würde.
Um sieben Uhr am Morgen betrat eine brünette Schönheit das Haus in der Torstraße. Shari schickte ein Foto von ihr, das sie mit dem Handy gemacht hatte, ins Hauptquartier. Nach ein paar Minuten wusste sie, dass es sich um Violetta Krix handelte, über die es keinen Eintrag beim Mossad gab. Wieder einige Minuten später traf ein Mann mittleren Alters ein, blond und mit einer Hornbrille, die ihm ein intellektuelles Aussehen verlieh. Kurz darauf erhielt sie auch seine Daten: Sebastian Krix, Bruder von Violetta, leitender Beamter im Außenministerium.
Bereits in der vergangenen Nacht hatte Shari eine Anfrage an den Mossad gestellt, in der sie alles über die Bewohner des Hauses in der Torstraße wissen wollte. Es hatte keine Stunde gedauert, bis man ihr aus Tel Aviv eine Liste aufs Handy schickte. Die Bewohner waren durchschnittliche, gutsituierte Bürger. Eine Auffälligkeit gab es nur beim Besitzer des Penthouse: Adrian von Zollern arbeitete für den BND – ihn hatte der Österreicher überfallen.
Shari dachte nach. Einer vom BND, einer vom Außenministerium und eine Frau. In der Wohnung, die offenbar ein Treffpunkt des Trios ist, wird eingebrochen ... von einem Österreicher, der etwas über »Nibelunc« weiß ...
Sie versuchte sich einen Reim darauf zu machen, aber schnell wurde ihr klar, dass sie aus diesen spärlichen Informationen noch kein schlüssiges Bild formen konnte. Nur eines stand jetzt fest: Sie würde dieses Trio beobachten.
***
Adrian umarmte zuerst Violetta und kurz darauf ihren Bruder. Er hatte sie angerufen und ihnen erzählt, was in der Nacht geschehen war. »Ich komme auf jeden Fall vorbei, bevor ich ins Büro fahre«, hatte Sebastian sofort geantwortet. »Und Violetta ebenfalls.«
Nun saßen die drei im Wohnzimmer und diskutierten. Durch die zerbrochene Scheibe wehte ein leichter Wind herein.
»Und der Kerl hat nichts gestohlen?«, fragte Violetta.
»Nein ... doch! Er hat das Foto von Großvater mitgenommen.«
»Was?«, sagte Sebastian.
Adrian zuckte mit den Schultern. »Und er faselte etwas von Zeichen und Schlüssel. Ich habe ihn beim Durchsuchen dieser Kiste hier erwischt.« Er ging zum Plattenregal und wies auf die Holzkiste, die darunterstand. »Ich habe sie bei Cornelis in Amsterdam gekauft.«
»Was ist drin?«, wollte Violetta wissen.
»Na was wohl?« Adrian lächelte, wie immer, wenn er auf seinen Sammlertick angesprochen wurde. »Alte Schellacks und so.«
Violetta stand auf. »Wir schauen sie uns jetzt mal an.«
»Wartet einen Moment. Cornelis ist Frühaufsteher und immer in seinem Laden. Ich rufe ihn an und frage ihn, ob er irgendwas Besonderes darüber weiß.« Er tippte auf Cornelis’ Nummer im Adressbuch. Das Freizeichen ertönte, doch niemand nahm ab. »Komisch. Ich rufe ihn schon seit Jahren immer so früh an, bevor ich zu ihm fahre. Bisher ist er immer rangegangen.«
»Du glaubst doch nicht –«
»Natürlich nicht. Aber wozu habe ich denn meine Verbindungen zum BND?« Nun wählte er die Nummer von Peter Kant, dem Stellvertreter seines Chefs.
»Gut, dass Sie anrufen!«, sagte Kant sofort. »Ponisega hat mich bereits informiert. Sie bekommen Personenschutz. Heute Mittag bezieht Tony Kleinhans vor Ihrer Tür Stellung. Er wird sich mit anderen Kollegen abwechseln.«
»Deshalb rufe ich nicht an«, antwortete Adrian und erklärte Kant die Sache mit Cornelis in Amsterdam.
»Okay, Sie wollen also, dass ich nachhorche. Alles klar.«
»Gut, dann lass uns jetzt die Kiste untersuchen«, schlug Violetta vor, als Adrian das Gespräch beendet hatte. Sie kniete vor dem Plattenregal und war dabei, die Kiste hervorzuziehen.
»Ich hab sie schon kurz unter die Lupe genommen. Fast nur wertloser Plunder«, sagte Adrian. »Habe mich von Cornelis bequatschen lassen«, fügte er hinzu und lachte.
»Plunder ... quatschen«, krähte es plötzlich. Mummtaz saß mit schräg gestelltem Kopf auf dem Schallplattenregal und fixierte die drei Menschen. Violetta ging zu ihm und streichelte ihn.
Es versetzte Adrian einen Stich, als er die beiden Finger mit den abgetrennten Kuppen sah. Er hatte sie vergangenes Jahr in Spanien in Gefahr gebracht, und es war seine Schuld gewesen, dass man ihr die Fingerglieder abgequetscht hatte.
»Weißt du, wo ich das letzte Mal ein Grammophon gesehen habe?«, fragte Sebastian beim Anblick des alten Kastens mit dem großen Blechtrichter, der auf einem Tisch neben der Stereoanlage stand.
»Keine Ahnung.«
Violetta lachte. »Ihr wolltet mich nicht dabeihaben, aber ich habe trotzdem mitgemacht. Argentinien! Ich war beinahe noch ein Baby, und ihr beiden habt Tangoplatten abgespielt. Und dabei so getan, als wärt ihr südamerikanische Machos.« Sie lächelte bei dem Gedanken an diese längst vergangene Zeit. »Besonders bei dir, Sebastian Brillen-Blondschopf, wirkte das ... nun ...«
Sebastian zog seiner Schwester eine Schnute. Er dachte ebenfalls gerne an die Jahre zurück, als sein Vater die südamerikanische Expansion des Familienunternehmens von Buenos Aires aus vorangetrieben hatte und von Adrians Vater, der das Wirtschaftsressort der Deutschen Botschaft leitete, unterstützt worden war. Die Eltern und die Kinder hatten sich schnell angefreundet.
»Ich will jetzt was hören, etwas Heiteres.« Violetta wühlte in der Kiste herum. »Das hier!«
Adrian schaute sich das Label der verkratzten Schellackplatte an. »Zarah Leander?«
»... wird einmal ein Wunderrrrrrr gescheh’n«, sang Violetta.
Sebastian drehte die Kurbel des Grammophons und legte die Platte auf.
Es rauschte und knackte fürchterlich, dann ertönten Blechbläser.
»Könnte Les Préludes von Liszt sein«, meinte Adrian.
»Auf einer Zarah-Leander-Platte?«
»Das ist allerdings seltsam«, stellte Sebastian fest.
»Jungs, jetzt seid doch mal still!«
Die Musik hatte plötzlich aufgehört, und nach einer kurzen Pause schnarrte eine Stimme aus dem Horntrichter, die zwischen all den Störgeräuschen beinahe unterging.
»Nibe ... omman ... ehl ... Führ ... rwähl ...«
»Das ... das ist doch ...«, stammelte Sebastian.
»… der Reichspropagandaminister der Nazis«, ergänzte Adrian.
Für einen Moment herrschte Stille im Wohnzimmer. Dann nahm er die Nadel von der Platte und schaute die Geschwister an. »Was haltet ihr davon?«
»Spiel es noch mal ab«, schlug Violetta vor. »Vielleicht verstehen wir es dann besser.«
»Schschschsch ... krchz, krchz«, krächzte es aus dem Hintergrund.
»Danke für die Unterstützung, Mummtaz«, sagte Adrian.
Sie hörten sich die abgehackten Redefetzen noch dreimal an, aber Violettas Hoffnung erfüllte sich nicht. Offensichtlich war der Tonträger stark beschädigt.
Sebastian nahm die Schellackplatte in die Hand und betrachtete sie genauer. Nach einer Weile zeigte er auf den Plattenschrank und gluckste. »Wie viele Schallplatten sind das?«
»Ungefähr sechstausend«, antwortete Adrian.
»Besitzt du ein Exemplar mit überklebtem Label?«
Adrian trat zu seinem Freund, der am Label der Schellackplatte herumfummelte. »Was?«





























