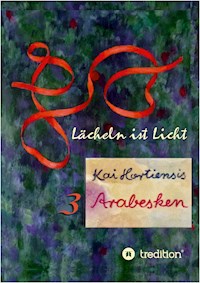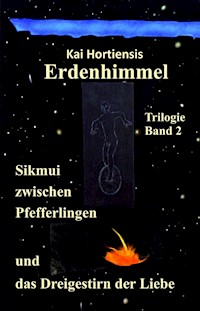2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Erdenhimmel
- Sprache: Deutsch
Im dreifachen Spiegel verschiedener Zeiten erscheint die Hauptfigur "Sieben Pöpl" zwischen Traum und Wirklichkeit, todbringender Demütigung und selbstheilender Auferstehung. Es ist eine turbulente und dabei tragikomische Liebes-geschichte, in der die Untiefen der Sexualität mit den Kulturkräften ehelicher Treue und behütender Zartheit konvulsivisch zusammenprallen und dunklen Verrat und unendliche Peinlichkeit ins Tageslicht vordringen lassen. Leserinnen und Leser können lachen, weinen, trauern, wütend werden, verachten, loben, verzweifeln, aber auch ahnen, was wahre Liebe sein könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kai Hortiensis
Erdenhimmel
Trilogie - Band 1
Pipis und Sieben
ein Buch in zwei Versionen
Weiblich / Männlich
Impressum
© 2021 Autor: Kai Hortiensis
Herausgeber: Kai Hortiensis
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN:
978-3-347-34743-4 (Paperback)
978-3-347-34744-1 (Hardcover)
978-3-347-34745-8 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen
Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorderseite: Gemälde von Henning Loeschcke
(2019, Öl/Leinwand, 155 x 120 cm, ohne Titel)
Die Geschichte ist frei erfunden.Falls es Ähnlichkeiten mit lebenden Personen geben sollte, sind diese rein zufällig.
Sieben
Männliche Version
Inhalt
Der Wanderer
Das Traumbuch
Die Ankunft des Schweins
Die Heirat
Husky und Fixe-O
Frau Argarilla und die Veterinärinnen
Besuch beim Inder
Der Fall in den Mist
Das Schwein im Homo sapiens sapiens
Tohaks Predigt
Alle Vögel sind schon da - oder drunk and stoned
Und ich damals ?
Cindy
Herzog Blaubarts Burg
Traumschaum
Was war das?
Blutsbrüder
Die Nacktpredigt
Seelenrisse
Lieder von Liebe und Schwein
Schweinsbisse
Abschied 1
Der Zettel oder Abschied 2
Bei Christella
An der Saale hellem Strande
Erwachen
Sabrina
Ein neuer Versuch
London oder die ewige Arbeit
Nachlese
Ausblick
Marie
Pipis
Weibliche Version
Die Waldläuferin
Das Traumbuch
Die Ankunft des Schweins
Die Heirat
Husky und Fixe-O
Frau Argarilla und die Veterinärinnen
Besuch beim Inder
Der Fall in den Mist
Das Schwein im Homo sapiens sapiens
Tohaks Predigt
Alle Vögel sind schon da - oder drunk and stoned
Und ich damals ?
Xander
Herzog Blaubarts Burg
Traumschaum
Was war das?
Blutsschwestern
Die Nacktpredigt
Erwachen
Sven
Ein neuer Versuch
London oder die ewige Arbeit
Nachlese
Priscilla
Besuch in der Oase
Sieben
Männliche Version
Der Wanderer
In einer kleinen Stadt in Niederbayern lebte im vergangenen Jahrhundert ein Mann, den man den Wanderer nannte. Ältere Leute nannten ihn auch den Dazugezogenen und wollten wissen, dass er vor einem halben Jahrhundert aus Norddeutschland hierherkam. Die ihn etwas näher kannten, wussten, dass er Sieben hieß, und eine ganz alte Frau glaubte sogar seinen Nachnamen zu wissen: „Pöpl“. Ganz sicher allerdings war man sich da nicht, denn der Name stammte von einem Zettel, den ein Kind vor langer Zeit versehentlich oder absichtlich aus seiner kleinen Dachkammer, in der er wohnte, mitgehen ließ. Der Zettel war eigentlich einer Seite aus einem Manuskript, und war, wie das Wort sagt, handgeschrieben. Scheinbar entstammte der Text einer Liebesgeschichte, in der eine gewisse Sabine ihren Freund und Liebhaber so nannte. Damit neckten ihn die Leute gerne, solange er sich darüber ärgerte, aber schließlich war das für den Wanderer kein Grund zur Übellaunigkeit mehr, und so hieß er nun Sieben Pöpl, obwohl sein Name „Siegbert Böbel“ war. Irgendwann hatte er das wohl selbst schon vergessen.
Eines Tages hatte den Wanderer niemand gesehen und auch den nächsten und übernächsten Tag nicht. Das war ungewöhnlich, denn wenn er auf seine Wanderschaften ging, sahen ihn immer wenigstens einige der sehr frühen Frühaufsteher mit seinem großen Hut und dem dazugehörenden Knotenstock durch das Städtchen gehen und im Wald verschwinden. Erst als ein paar Wochen seit seinem Verschwinden vergangen waren, fing man an, sich Gedanken zu machen. Das galt vor allem für seine Zimmerwirtin, eine immer schwarz gekleidete hochbetagte Frau, die zwar daran gewöhnt war, dass Sieben gelegentlich ein paar Tage weg blieb, aber doch nicht Wochen.
Sie fragte alle Nachbarn, ob sie Herrn Pöpl gesehen hätten, sogar auch den Bauern, der seinen nahe gelegenen Schweinezuchthof noch immer in der Stadt betreiben durfte. Das wohl vor allem nicht aus Gründen der Gnade, sondern aus touristischen, denn die Stadt war ein kleiner Kurort, in dessen Mitte ein berühmtes Denkmal stand, das man „Die Schweinemagd“ nannte.
Es war ein hübsches Werk zu Ehren einer jungen Frau, die, als es noch Mägde und Knechte auf den Höfen der Bauern gab, als Kleinmagd hier an dieser Stelle mit Schweinen verschiedener Rassen gehandelt hatte. Sie trug ein niedliches schwarz befelltes Ferkel auf dem Arm, das sie offensichtlich liebkoste.
Alle Nachforschungen der Zimmerwirtin (und viel später auch der Polizei) blieben erfolglos, und schließlich fasste sie Mut, und zusammen mit ihrem auch schon in die Jahre gekommenen Sohn, den sie extra herbeirufen ließ, schloss sie die Tür zu Siebens Dachkammer auf. Gott sei Dank fanden sie ihn dort nicht, und schon gar nicht tot, was beide befürchtet hatten; dafür allerdings eine Unmenge Papier. Auf seinem Tisch stapelte sich das wie bei Gericht die Akten; sie hatten das - damals noch schwarzweiß - im Fernsehen gesehen. Aber auch die Schränke und Regale waren voll davon. Das Papier war allerdings nicht einfach Papier, es war beschriftet, meistens mit der Hand, vieles aber auch mit der Schreibmaschine, einem alten Olympia-Modell, das inmitten der Papierstapel auf dem Schreibtisch stand.
Ehrfurcht erfasste die beiden. Was sollten sie tun? Schließlich liefen sie zum Stadtarchivar und berichteten ihm von dem seltsamen Fund. Der Archivar glaubte indes, Besseres zu tun zu haben als sich um die Papiere eines Zugezogenen zu kümmern und übergab die Sache der Stadtschreiberin Solveig Münther. Die mühte sich selber gerade mit ihrem literarischen Erstling ab, fand sich aber, als sie Näheres erfuhr, wie eine vor Faszination brennende Satellitenarchäologin auf die Spur gesetzt und konnte es nicht erwarten, mit der Nachlass-Sichtung des Herrn Pöpl zu beginnen.
Was sie fand, war wirklich bemerkenswert. Sie sichtete einen Schatz aus intellektuellem aber auch aus literarischem Herzensgold: Ausgedehnte Forschungen zur Heimatkunde, die Herr Pöpl auf seinen bildhaft reich beschriebenen Wanderungen akribisch betrieben hatte, ferner Forschungen zur Musik, und sogar eigene Kompositionen. Das Beste aber, so schien es ihr, waren mehrere Romane. Solveig Münther versank in den Papieren und las und las, bis man sie buchstäblich davon wegzog. Aber das konnte sie nicht von den Büchern trennen. Sie hatte vorgesorgt und bereits nach Hause mitgenommen, was sie mitnehmen konnte. Dort las sie nun alle Romane in einem durch. Dann stand ihr Entschluss fest: Solveig wollte nun auch andere Menschen an diesen Werken teilhaben lassen. Es gelang ihr, einen Verlag für die knapp vierzigtausend Seiten zu gewinnen, der sich dieses Riesenwerkes annahm und tatsächlich Bücher für seine verschiedenen Sparten davon herstellte. Eines davon, ein Roman, hieß „Sieben Pöpl“. Für diese Großtat, der ihr eine Belohnung hätte einbringen müssen, wurde ihr als Stadtschreiberin gekündigt.
Der Wanderer, der in Fürz bis zu seinem Verschwinden „Sieben Pöpl“ genannt wurde, beschreibt in seinem gleichnamigen wahrscheinlich autobiographischen Buch, wie Sieben zu seinem despektierlichen Namen kam - aus ganz anderen Gründen als bei ihm in seinem wahren Leben selbst -, welche Landschaften er durchwanderte und welch unterschiedliches Brauchtum er kennenlernte. In all das hatte der Autor eine Geschichte unerfüllter Liebe zu einer jungen Bäuerin eingeflochten, die mit ihren
Eltern eine Schweinezucht mit verschiedenen Rassen betrieb und auch, dass diese Bäuerin eins von den Tieren, ein schwarzes, besonders liebte. Weniger hingegen liebte sie ihren Mann, der Bücher schrieb, von denen sie nichts wissen wollte, ja verabscheute und als Konkurrenz zu sich erlebte. Das war zweifellos schwierig, hinderte die beiden jedoch nicht daran, sich immer wieder lustvolle Stunden im Bett zu gestatten.
„Unglaublich“ befand Solveig, als sie das las. Nichtsdestoweniger konnte sie nachfühlen, dass Sabine in dieser Beziehung unerfüllt war, und auch als sie las, dass Sabine ihre seelische Lücke dadurch auszufüllen versuchte, dass sie sich heimlich anderen Männern hingab. Das erschien Solveig, die für Sabine Partei ergriff, richtig und gerecht zu sein. Aber als Solveig las, dass Sabine sich endlich von ihrem Mann trennte und mit einem jüngeren und wesentlich hübscheren zusammenkam, jauchzte Solveig geradezu, so sehr hatte sie sich in die Geschichte eingelebt und dabei gefühlt, dass Sabines Lebenswandel kein gutes Ende nehmen würde.
Dieses Buch, das längst nicht mehr verlegt wurde, fand ich, als Namensvetter des Sieben, 50 Jahre später zufällig in einem Antiquariat. Auf der Rückseite stand, wie es zu diesem Buch gekommen war. Wie Solveig vor langer Zeit las ich es in einem Zug durch und fand zwischen meinem Leben mit meiner Freundin Sabrina und dem Leben des vom Wanderer beschriebenen Paares Sabine und Sieben mancherlei Ähnlichkeiten. Sogar die Verballhornung meines und seines Namens Siegbert Böbel hatten sich die beiden Frauen Sabine und Sabrina geleistet. Ich war erstaunt und fasziniert zugleich und dachte: „Hoffentlich, lieber Siegbert, der du sicher schon tot bist und das Elend schon hinter dir hast, ging es dir mit deiner Sabine nicht ganz so schlimm wie mir mit Sabrina.
Nicht lange danach hatte ich einen schweren Autounfall, den ich sehr knapp überlebte. Der unerklärliche Zusammenprall mit einer alten Korkeiche schleuderte mich in ein vielmonatiges tiefes Koma, und ich fiel und fiel und fiel immer tiefer in die Unendlichkeit ungeahnter Traumwelten.
In diesen offenbarte sich etwas für mich sehr Neues. Schon immer hatte ich Musikträume, manchmal sogar waren es ganze Orchesterwerke, die ich im Wachbewusstsein auszuarbeiten bemüht war. Auch kamen mir, während ich schlief, gelegentlich Geschichten - oft im Märchenkleid - in den Sinn. Aber jetzt geschah es, dass ich im Traum mit großer Faszination und endlich ungestört von der Mühsal des alltäglichen Lebens ein ganzes Buch schrieb, an das ich mich nach meiner Genesung fast Wort für Wort erinnern konnte und es dann auch mit mancherlei Ergänzungen zu Papier brachte.
Das Traumbuch
Die Ankunft des Schweins
„Morgen früh um 7 Uhr findet Ihre Enthauptung statt“. Es war egal, wie die Stimme klang, die das sagte. Mein Körper wurde starr, fing dann aber heftig zu zucken an, als sich etwas Kaltes und Nasses klatschend auf meinen Hals legte. Das also war der Tod. Ich erwachte. Ruckartig setzte ich mich auf und griff nach oben. Ein Schauer durchfuhr meinen Körper. Wo war mein Kopf? Es dauerte, bis ich den Mut hatte weiterzudenken. Irgendwann fiel mein Blick auf ein tiefrot gefärbtes nasses Ahornblatt in meiner rechten Hand. Ich war nur noch Schmerz und fiel und fiel, und dieses Fallen wurde immer schneller, geriet in ein nie erlebtes Rasen und schleuderte mich in die schwarzen Tiefen des Weltraums. Der ewige Schlaf umfing mich als etwas Grundvertrautes, bis auch das erlosch.
Es war ein diesiger Morgen im Herbst. Das Fenster stand offen und Nebel wehte herein, beinahe „schelmenzünftig“ wie in Zettels Traum. Gott sei Dank, meine Erleichterung war riesig. Ich schaute nach links. Dort lag halbnackt meine schöne junge Frau und schlief. „Meermuscheln lippten …“, würde Arno Schmidt bei diesem Anblick vielleicht schreiben. Ein Glücksgefühl durchströmte meinen Körper. Plötzlich bemerkte ich, dass ich fror. Noch sitzend drehte ich mich langsam weiter zu ihr hin und wollte sie bedecken. Da öffneten sich ihre Augen, und sie sagte fest und gänzlich klar: „Ich will ein Schwein.“ „Wie, was?“ „Ja, ein Schwein.“ „Erstmal guten Morgen, Diana“, hörte ich mich etwas verwundert sagen. „Lenk nicht ab“, erwiderte meine Freundin, die mir, wie mir nun wieder einmal schien, vom Schicksal gütig zugedacht worden war - auch und gewiss zwecks inneren Wachstums meinerseits, wie ich oft meinte ahnen zu sollen. „Ich will ein Schwein, und das weißt du.“ Nun saß sie ebenfalls aufgerichtet im Bett und bereit, ihr seltsames Begehren durchzusetzen. „Wirklich ein Schwein? Und ich soll das wissen?“ „Ja natürlich!“, hörte ich sie mit Nachdruck sagen. Mir kam ihr Wunsch allerdings keineswegs natürlich vor, ganz und gar nicht, sondern ziemlich verrückt. „Meinst du vielleicht ein Meerschwein?“, fragte ich vorsichtig. Sie verdrehte nur ihre hübschen blauen Augen. In diesem Augenblick schlug die Turmuhr siebenmal. Die Zeit stimmte. Unwillkürlich dachte ich an meine Enthauptung. „Wo soll das Schwein denn wohnen?“ „Natürlich bei uns, in unserer Wohnung.“ Sie erhob sich aus dem Bett. Rilkes Zeilen aus einem ursprünglich seiner angebeteten Lou zugedachten Gedicht durchfuhren mich: „Wie Monde stiegen klar die Knie auf und tauchten in der Schenkel Wolkenränder.“ Kann man es besser sagen? Und weiter rilkisch gesteigert: „Wie ein Bestand von Birken im April warm leer und unverborgen lag die Scham.“ Da gab es nichts als meine Diana, groß und wunderschön, wie die Natur sie geschaffen hatte. Meine Höhenflüge endeten ikarusartig mit ihrem Satz: „Manche haben einen Hund, und wir eben ein Schwein.“ Ich sagte erstmal nichts weiter. Mir kam das Ganze noch weniger natürlich vor als ihr Wunsch, ein Schwein zu besitzen, aber ich wusste zugleich, sie würde mich nicht von ihren Strumpfbändern lassen.
Die Bestätigung dieses Wissens ereilte mich auf der Straße vor unserer Wohnung, auf der sie mir mit ihrem korbbeschwerten Fahrrad entgegenkam. Ich spürte sofort eine seltsame Erregung - und tatsächlich: aus dem Korb blickte mich ein hübsches Ferkel an. Sie lachte ihr blitzendes Lachen, das noch kräftiger wurde, als sie mein verdutztes Gesicht sah.
Aus heutiger Sicht im Wachbewusstsein erscheint mir das bisher Geschilderte völlig normal, jetzt, wo es die seltsamsten Ansichten inmitten pandemischer Zeiten gibt. So erzählte mir neulich eine junge Schülerin allen Ernstes - sie geht regelmäßig zum Reiten -, dass sie beabsichtigt, zusammen mit vielen Reitschüler-Innen und demnächst hoffentlich auch mit Tier- und Naturschutzverbänden für die Befreiung von Pferden zu demonstrieren. „Wie das?“, fragte ich. „Nun, man muss sich klar machen, dass die PS-Kraft in den Motoren von Pferden stammt.“ Sie schaute aus dem Fenster. „Dort auf dem Feld kannst du einen großen Häcksler sehen. Der verfügt über tausend PS. Das bedeutet, dass tausend Pferde dafür sterben mussten. Und nun denk mal an die unendlich vielen Motoren in den unterschiedlichsten Fahrzeugen, z.B. in den Milliarden Autos auf der Welt, dann kannst du das ungeheure Verbrechen ermessen, das allein die Autoindustrie fortwährend verübt. Jeder fühlende Mensch sollte sich uns anschließen und mit uns demonstrieren.“
Was ist dagegen der verrückte Wunsch, ein Schwein in der Wohnung zu halten, oder gar gegen virale Irrsinns-Phantasien heute, die sich fälschlich als Theorien bezeichnen?
Wie dem auch sei: Als mich das Tierchen aus dem Korb anblickte und grunzte, geschah es zu meiner Überraschung, dass ich mich - ich gestehe es frei - in das Ferkel traumtrunken verliebte. Es war im Kopf wie eine Kippfigur, bei der aus einer alten Kanne eine Frau wird. Hier nun wurde aus Abneigung angesichts der Vorstellung, ein echtes Schwein in der Wohnung zu haben, Liebe auf den ersten Blick. Ich konnte nicht anders als das Tier zu streicheln. Es grunzte fröhlich, legte sich auf den Rücken, quiekte und wollte offenkundig nun auch am Bauch liebkost werden. Konnte ich das in Gegenwart meiner Freundin tun, ohne dass sie eifersüchtig werden würde? Die Frage erübrigte sich: Mein Arm streckte sich aus - ganz von selbst, wie er sich nicht lange zuvor ausgestreckt hatte, um nach meinem Kopf zu suchen - und ich fühlte das leicht stachelige Fell des Borstentieres, das sich nun seinerseits meiner Hand entgegenwand. „Na, es geht doch“, sagte Diana, und ihr Lachen wurde hell und tönte durch die Straße. Kräftiger grunzend lachte das Schwein nun auch, und mir entrang sich ebenfalls ein stockendes Lächellachen, und so erreichten wir etwas später unbehelligt das Haus, in dem wir nun fürderhin zusammen mit unserem Schwein wohnten.
Die Heirat
Es dauerte nicht lange, als Diana zu wiederholtem Male, nun aber nachdrücklicher als sonst, den Wunsch äußerte zu heiraten. „Wir haben jetzt ein Schwein, und dann können wir auch heiraten“, meinte sie. Mir kam das irgendwie nicht unplausibel vor, zumal wir seit ein paar Jahren auch einen kleinen Sohn hatten, der sich mit unserem Schwein bestens verstand. „Dann wären wir eine richtige Familie“, sagte sie. Das Wort „richtig“ bewirkte ein seltsames Gefühl in mir. Aber in gewisser Weise war ihre Vorstellung nicht falsch, jedenfalls wenn man den Familienbegriff etwas erweiterte. „Dein Wunsch sei mir Befehl!“ - Dieser Satz aus dem Märchen „Aladins Wunderlampe“ kam mir in den nächsten Wochen angesichts der wachsenden Dringlichkeit ihres Heiratswunsches immer stärker in den Sinn. Offenkundig hatte sich Diana dieser Lampe bemächtigt, die im Märchen jeden Wunsch bis hin zur Heirat Aladins mit einer schönen Sultanstochter erfüllt. Jedenfalls wurde es mir bei Dianas Heiratsidee Woche für Woche wärmer ums Herz, und mein immer gehüteter Vorsatz, nie zu heiraten, schmolz schließlich dahin. Unsere Familie mit Diana, mir, unserem Sohn Anouk und Fixe-O, dem Schwein, fühlte sich zunehmend gut an.
Und dann kam der Tag, an dem ich mich am Ende eines Yogaübungsabends sprechen hörte: „Mir ist heute etwas Seltsames passiert.“ Eine Pause entstand und leise hörte ich die Stimme weitersprechen: „Ich habe heute geheiratet. Wenn ihr wollt, könnt ihr heute Abend zu uns kommen und feiern. Unser Schwein ist auch dabei.“
Die Anwesenden lachten und konnten es - wie auch ich - nicht glauben, aber sie kamen alle, bis die Wohnung platzte und Fixe-O sich genötigt sah, gefolgt von Anouk, über die auf dem Teppich Sitzen- oder halb Liegenden zu springen, wobei jedesmal des Schweines fröhlich schönes Grunzen und des Sohnes nicht weniger schönes Jauchzen hell ertönte. Es war eine herzerwärmende von meiner Frau und ihren Freundinnen spontan bestens roh- und jadegrün teeköstlich bewirtete Feier, die beinahe bis an das Ende der Nacht dauerte.
Husky und Fixe-O
Tempora mutantur et nos cum illis. Dieses aus dem 16. Jahrhundert stammende und auf einen Satz Ovids zurückgehende Sprichwort galt auch für unser Schwein. Jedenfalls wurde es zunehmend größer. Männlich ausgestattet mit kleinen Hauern residierte es auf unserem Balkon in einem igluartigen strohausgelegten Häuschen, war inzwischen stubenrein wie eine Katze und hörte - wenn es Lust hatte - aufs Wort. Ja, Diana war sehr erfolgreich im Umgang mit dem Tier. Aber leider war sie nicht erfolgreich genug, denn eines Tages, als die beiden spazieren gehen wollten, geschah es: Sie passierten eine kleine Brücke und auf dieser fast noch vor unserem Haus einen edel aussehenden dicken Herrn mit einem Husky. Die Begegnung ging nicht friedlich aus.
Der Hund riss sich los und stürzte sich auf Fixe-O, unseren geliebten kleinen Eber. Ein fürchterlicher Kampf entstand. Gefährliche Knurr- und Grunzlaute, grässlich auf- und abschwellend, bei gleichzeitigen tierischen Schmerzensschreien mischten sich mit unserem und des fremden Mannes lautstarkem Gebrüll des Entsetzens und der Beschwörung, schnellstmöglich voneinander abzulassen. Eine ausdrucksstarke Kakophonie entstand. Das zu komponieren wäre interessant, dachte ich trotz allen augenblicklichen Krampfes. Die Kämpfenden interessierte unsere Beschwörung allerdings gar nicht. Also ging man nun hastig dazwischen. Diana zog am Schwein, ich, der aus unserer Wohnung hinzusprang, an Diana und der fremde Mann an seinem Husky. „Eine tolle Filmszene“, dachte ich ziemlich erschrocken.
Schließlich trafen sich alle, die Tiere und ihre Hüter, beim Tierarzt. Hier nahmen die eben noch in die Ohren und ins Gemüt stechenden Ausdruckslaute eine andere Qualität an. Die tierischen wurden zu einem nackten Jaul-Gewimmer, die menschlichen hingegen kamen umhüllt daher. Sie wurden, wie das beim homo sapiens sapiens üblich ist, in Worten versteckt, allerdings ohne, dass sie dabei wesentlich anders klangen als vordem die bestialischen. Die Worte umfassten das vom Huskyhalter hervorgebrüllte Angebot, Diana auf die Schnauze zu hauen, weil sie das Schwein angeblich immer frei herumlaufen ließ, sowie ihre Gegenrede, deren semantischer Kern in der Mutmaßung gipfelte, dass für den dicken Herrn bereits die Psychiatrie alle Türen geöffnet hätte. Mein Beitrag bestand in der an den edlen Herrn gerichteten dringenden Empfehlung, sich bei Diana sofort zu entschuldigen, sonst bekäme er es mit mir zu tun. Anouk, der inzwischen auch noch erschienen war, meinte, es sei doch alles Scheiße, und der Tierarzt beteuerte fortwährend, dass alles nicht so schlimm sei und wir uns endlich beruhigen sollten. Nach und nach taten wir das denn auch und tranken schließlich sogar noch alle zusammen einen Tee bei uns. Das Ende dieser kleinen Begebenheit kann man nicht besser als mit den Worten eines früher zeitweilig ganz in unserer Nähe wohnenden berühmten Dichters und Zeichners ausdrücken: „Drei Tage war das Schwein noch krank. Jetzt frisst es wieder, Gott sei Dank.“
Frau Argarilla und die Veterinärinnen
Nun hatte es sich so ergeben, dass wir Tür an Tür mit einer älteren Nachbarin wohnten. Die Dame hieß Argarilla und hatte 14 Katzen und ein Holzbein. Das war eigentlich eine Art Plastikschale, wie uns hinter vorgehaltener Hand erklärt wurde, aber so wie sich Frau Argarilla mit ihren Krücken bewegte und wie das klang, erinnerte es mich an einen Kriegsverletzten aus dem Jahr 1945 des vergangenen Jahrhunderts.
Wenn Fixe-O und Frau Argarilla sich auf der Treppe begegneten, geschah es leider fast immer, dass diese Dame Fixe-O mit ihrer Krücke wegstieß, worauf Fixe-O ihr jedesmal ins Holzbein biss. Normal waren dann Schreie der Empörung, aber manchmal hörten wir Frau Argarilla auch murmeln: „Jetzt weiß ich wenigstens, wozu diese Prothese nützt.“ Ja tatsächlich: Die war plötzlich zu einem wirksamen Schutz vor Bissverletzungen geworden. Fixe-O allerdings ärgerte dieser Schutz, jedenfalls ließ er ungern davon ab. Er wollte zum Blut-Kern seines Fanges vordringen.
Dass Frau Argarilla, als nichts half und auch unsere Interventionen gegenüber Fixe-O unfruchtbar blieben, das Veterinäramt hilfesuchend anrief, konnten wir verstehen. Ganz ermessen konnten wir diesen Anruf allerdings erst, als eines Morgens zwei nette Damen an unserer Wohnungstür klingelten. „Wir kommen vom Veterinäramt und sind hier um zu fragen, ob sie ein Schwein in Ihrer Wohnung beherbergen?“ „Ja, das tun wir“, sagte Diana, „und zwar ein ganz entzückendes.“ Wie um das zu bestätigen sprang Fixe-O noch ein wenig strohbedeckt aus dem Wohnzimmer hervor und zeigte sich friedlich grunzend den beiden Damen. „Das ist wirklich ein schönes Tier“, lobten die beiden und knieten sich herab, um den kleinen Eber zu streicheln. Der ließ sich das wohlig gefallen, bis hinter der Nachbarstür, wo Frau Argarilla wieder einmal lauschte, ein Geräusch zu hören war. Fixe-O sprang auf und schnaubte. Das störte die Veterinärinnen in ihrem dienstlichen Tun jedoch nicht. Sie standen auf und wollten sich nun Unterkunft und Pflegeeinrichtungen für unser Schwein genauer ansehen. Diana zeigte ihnen das alles bereitwillig, und schließlich waren die beiden Damen mit allem hoch zufrieden. „Aber eine Sache müssen wir noch besprechen“, sagte eine der beiden Frauen fast schon im Weggehen. Fixe-O spitzte - wie auch wir - kräftig die Ohren, denn ein optimales Richtungshören schien jetzt angesagt. „Ein Schwein“, so ließ sich die Veterinärin vernehmen, „ist ein Herdentier. Wir können es ihnen deshalb leider nicht gestatten, hier ihr Tier zu halten.“ „Das geht nicht“, schluchzte aufgebracht Diana, und Anouk, der aus seinem Zimmer gekommen war, befand, dass das große Scheiße sei. „Wenn sie ihr Tier behalten wollen, muss mindestens noch ein weiteres Schwein hinzukommen.“ Fixe-O quiekte fröhlich, und hinter der Nachbarstür polterte es nun ganz unverhohlen. Auch ich war inzwischen dazugekommen und fragte, ob es nicht noch eine andere Möglichkeit gäbe. Die Damen schauten sich an. „Ich will das nicht“, rief Anouk trotzig, nahm Fixe-O auf den Arm und verschwand mit ihm in seinem Zimmer. „Vielleicht können wir Ihren Sohn als Spielkamerad eintragen, sozusagen als Ersatz für ein zweites Schwein.“ „Ja klar, kein Problem“, rief Anouk aus seinem Zimmer. Das Schwein grunzte, „die Englein sangen“, alle freuten sich, und so wurde Anouk, nachdem wir noch ein paar gute Tipps zur Pflege von Schwein und Sohn mit Schwein samt gesetzlichen Vorschriften zur Haltung der beiden bekommen hatten, tatsächlich zum Ersatzschwein auf dem amtlichen Papier.
Was Frau Argarilla angeht, so begriff sie, dass sie gescheitert war, und versuchte es nun mit Liebe. Ihre Krücke als Verteidigungsinstrument für sich und ihre von Fixe-O gern gejagten Katzen ließ sie weg, gab Fixe-O sogar dann und wann ein Leckerli, und schließlich kam es dahin, dass die beiden sich anfreundeten und manchmal sogar zusammen in je eigener Weise Frühstück fraßen.
Besuch beim Inder
Eines Sonntags befand Diana, dass es Zeit sei, mal wieder essen zu gehen - und zwar beim Inder. Die Idee fand Zustimmung, und so wurde Fixe-O ein Sonntagshalsband angelegt, was ihn sichtlich entzückte, und man spazierte los. „Manche kommen mit Hund, ihr kommt mit Schwein“, so räusperte sich der Inder, ein Sikh mit Turban und Säbel, fast wortgleich mit Dianas früherer Schweinsapologie. Das war nun offensichtlich richtig, und man ließ sich folglich in einem Halbséparée, das glücklicherweise noch frei war, auf gut gepolsterten Stühlen nieder. Fixe-O hingegen verschwand sofort unter dem großen runden Tisch des halbrunden Räumchens und ward nicht mehr gesehen. Oberhalb des Tisches bestellte man nun, eine gute Weile hin und her wählend, schließlich Reis mit Spinat oder Kichererbsen und unterhalb mit deutlich forderndem Gegrunze Küchenabfälle. Das munter sich drehende Bestellkarussel blieb nicht unbemerkt und zog heimliche Blicke in die abgeteilte Ecke, während wir wiederum bemerkten, dass sich die Blickfrequenz der übrigen Gäste zunehmend steigerte und völlig offensichtlich wurde, als Fixe-O’s fürchterliches Schmatzen ertönte. Dass eine Familie sich derart schamlos getraute zu schmatzen, bezweifelte man scheinbar und versuchte, sich nun diesbezüglich zu vergewissern. Da Fixe-O sich jedoch noch unter dem Tisch verbarg, verblieb auch der Grund für das schweinische Geräusch weiterhin in unterirdischen Gefilden. Die Folge waren immer mehr schamlos abwertende Blicke, die schließlich beinahe polternd aus sich schüttelnden Köpfen fielen. Selbst Diana wurde es langsam peinlich, aber man konnte jetzt schlecht aufstehen und die Schuld von sich wälzen. Davon entband uns jedoch plötzlich Fixe-O, wodurch dann allerdings die Peinlichkeit bis in die Wolken stieg. Mit Reis- und Okraresten bedeckt kam er unter dem Tisch hervor und fing an, sich für die Speisen der Gäste zu interessieren. Jetzt wurde wieder einmal klar, dass das Sonntagshalsband nichts taugte. Es rutschte dem Eber über den halslosen Kopf, und nun war er frei, sein Unwesen zu betreiben. Das tat er ohne Zögern und hemmungslos, indem er, akribisch Fressbares erschnuppernd, durch das Gastzimmer stürmte. Besonders, wenn ihm war, als habe er etwas Schnauzendes gefunden, hielt ihn nichts zurück - jeweils auf den Hinterläufen abwechselnd an verschiedenen Tischen hochgereckt -, sich die Speisen der Gäste grunzend, schnaubend und vor allem schweinisch schmatzend einzuverleiben. Das ließ das Geschrei dieser und auch das unsrige, das heftig auf Unterlassung drang, so laut werden, dass Passanten, die auf der Straße am Gasthaus vorbei gingen, die Köpfe drehten, als ob ein Mord geschehen sei. Aus dem Gewirr von Stimmen erhob sich immer wieder heftig die unangebrachte Frage, was denn das um Gottes willen sei, obwohl die Antwort dazu nun wirklich auf der Hand lag. Mittlerweile standen die Gäste an ihren Tischen und erlebten Fixe-O im Schlaraffenland und uns - bemüht ihn, der wieder einmal keine Lust hatte zu gehorchen, einzufangen.
Doch der verkroch sich schließlich wieder unter dem runden Tisch im Séparée. Was wir, ihm nachjagend, kurze Zeit später dort vorfanden, war unmenschlich. Es stank fürchterlich, war sehr groß gehäuft und war, wonach es stank. Die Peinlichkeit ragte jetzt weit über die Wolken und trat an unseren knallroten Köpfen deutlich in Erscheinung - eine bemerkenswerte Epiphanie der Schande. Der Tisch wurde weggeräumt und aus der Küche stürmte der turban- und säbelbewehrte Sikh mit einem aschegefüllten Kehrblech hervor, gefolgt vom ebenfalls aschetragenden Koch, um das üble Malheur, eine im wahrsten Wortsinn uns innerlich tief in den Kot drückende Malaise, zu überschütten. Diana, die Tapfere, hatte sich inzwischen coram publico des zappelnden und laut quiekenden Schweins bemächtigt und war mit diesem unter dem Arm auf die Straße gelaufen. Von Peinlichkeit gekrümmt versuchte ich den Vorfall zu bereinigen. Man glaube mir: Unter dem Strich war das nicht billig, sondern wahrhaft schweineteuer.
Der Fall in den Mist
Wir tranken Tee, als das Telephon klingelte. Diana nahm den Hörer ans hübsche Ohr, stammelte noch „Ja, ja, natürlich“ und wurde dann bleich. „Unser Vermieter kommt gleich, der Mist vom Balkon muss schleunigst weg. Hol den Anhänger! Ich packe die Säcke.“ „Verfluchte Schei..“, entfuhr es mir, „Ich muss doch jetzt zu meiner Gruppe.“ „Meintest du Scheiße“, fragte Anouk. „Ja, so etwas Ähnliches“, antwortete ich hastig.
Als der Anhänger geholt, die fraglichen Säcke zwei Treppen heruntergetragen und verladen waren, fuhr ich schleunigst, wie es Diana überflüssigerweise dringend geraten hatte, los. Das Dorf, wo sich der mir zur Verfügung stehende Misthaufen türmte, war bald erreicht, und nun ging es ans Abladen und Beschütten. Anouk hat wirklich recht: „Es ist ekelhaft“, dachte ich und auch noch „Beeilung tut jetzt Not, sonst komme ich zu spät.“ „Unrast und Hast sind ein bös' Gast.“ Diese großmütterliche Weisheit bewahrheitete sich nun einmal mehr, denn nun stolperte ich mit dem Ekelsack vor mir in den Händen über die unsichtbare mistbedeckte kleine Umrandungsmauer des widerlichen Haufens und lag nun ohne Umkehr lang ausgestreckt und wutgehörnt in demselben. „Was machen sie denn da?“, fragte der herbeigeeilte Mistbesitzer. „Das ist mir bisher auch nicht klar“, war meine Antwort - und brüllend: „Ich weiß nicht, wie ich aus dem Scheiß herauskommen kann.“ Der Bauer war ein netter. Er lachte, schnäuzte sich ohne das übliche Tuch die rote Nase und griff beherzt nach mir im Mist. Mein Gehirn war jetzt offensichtlich zu unpassenden Scherzen aufgelegt, jedenfalls gebar es unabwehrbar sofort den blödsinnigen Satz: „Schnell streift er ab Hemd, Hos‘ und Jacke und stürzt sich in die brodelnde Kacke.“ Dieser Vers aus der unseren Deutschlehrer früher zum unbeherrschbaren Zorn bringenden Verballhornung von Schillers schönem Gedicht „Der Ring des Polykrates“ war in mein Gehirn wie eingemeißelt, während der Bauer an mir zog und riss. Der Rettung war glücklicherweise ein schneller Erfolg beschieden, und nun standen wir einander wirr gegenüber. Ich sah, dass Hemd, Hos‘ und Jacke des Bauern ihren angestammten Ort nicht verlassen hatten und fand nun meinen unerwarteten Einfall aus ferner Jugend während des Hinfalls mehr als redundant. „Ja die Mauer, mir ist das auch schon mal passiert“, sagte der nette Mann. Ich bedankte mich aufs Herzlichste. Der Landwirt gab mir eine alte Pferdedecke, die ich über die Sitze meines Autos legte, dann gab ich Vollgas, die Kiesel auf dem Boden flogen hoch, und ich eilte zur dringend gebotenen Vollwaschung in meinen Musikraum, der ganz in der Nähe lag.
Ich hatte, obwohl kurz danach frisch gewaschen und neu bekleidet, die Angelegenheit bislang nur zur Hälfte gemeistert. Jetzt galt es so schnell wie irgend möglich im übernächsten Dorf Kohlen zu kaufen, um den Gruppenraum für unseren Übungsabend zu beheizen. Unterwegs in Stokelbusch blinkte mir jedoch eine rote Ampel entgegen. Da ich schnell weiterkommen wollte, bog ich nach rechts ab, wendete nach 20 Metern und umfuhr so mit rumpelndem Anhänger das unerwünschte Hindernis. Beim Supermarkt in Schneehaus angekommen wollte ich gerade aussteigen, als ein Polizeiwagen neben meinem Auto hielt. „Sie wissen, warum wir sie ansprechen?“, fragte der männliche Teil des Polizeipärchens. „Nein, eigentlich nicht“, erwiderte ich. „Sie haben in Stokelbusch die auf Rot gestellte Ampel umfahren.“ „Ist das verboten?“, fragte ich. „Ja natürlich. Zeigen sie mir bitte Ihren Führer- und auch den Fahrzeugschein.“ Ich öffnete das Handschuhfach und erlebte eine Riesenüberraschung, denn mein Blick fiel auf einen großen Trommelrevolver, den ich noch nie gesehen hatte - und besonders nicht in meinem Handschuhfach. Der Polizist zog seine Waffe. „Legen sie die Hände hinter den Kopf und verlassen sie augenblicklich den Wagen!“ Der weibliche Teil des beamteten Pärchens sprang auf die andere Seite meines Autos und öffnete die Beifahrertür, wo das Handschuhfach war. „Die Hände aufs Wagendach!“ Der Befehl klang sehr bestimmt. „Was ist denn los, ich habe doch gar nichts verbrochen?“ „Aufs Dach!", schrie das Pärchen. „Das ist ja wie im Hollywoodkrimi“, hörte ich mich sagen. Inzwischen hatte sich um uns ein Kreis von Menschen gebildet, und ich entdeckte darin den Pastor, bei dem ich allsonntäglich Orgel spielte. „Bitte helfen sie mir, Herr Dickbung!“, rief ich ihm zu. „Was ist denn los, Herr Hortiensis, um Gottes willen? Haben sie sich verspielt?“ „Wenn ich das wüsste“, antwortete ich. „An meinem Orgelspiel liegt es, glaube ich, nicht. Oder?“, fragte ich den Polizisten. „Werden sie jetzt nicht auch noch unverschämt“, antwortete der.
Endlich hatte die Polizistin sich der Waffe bemächtigt und betrachtete sie nun von allen Seiten. Dann schüttelte sie ihren amtlich bemützten Kopf, suchte Augenkontakt mit dem mich waffentechnisch noch immer bedrohenden Kollegen und schüttelte ihn erneut. „Ein Spielzeug? Wie kommt das in ihr Auto?“, fragte mich der Polizist. „Ich weiß das nicht, könnte mir höchstens erklären, dass mein Sohn … aber der besitzt so etwas nicht." Ich musste unter Polizeibegleitung zurück zu unserer Wohnung fahren. Es wurde geklingelt und Diana öffnete. „Was ist los?“ „Gar nichts“, antwortete ich. „Das werden wir sehen“, sagte der Polizist. „Ist ihr Sohn da?“ Anouk kam und wurde gefragt, ob er das Ding - gemeint war der Revolver - kenne. „Ja, der gehört meinem Freund Anton. Wo haben sie ihn denn gefunden? Wir haben schon danach gesucht.“
Nun war nichts mehr zu retten. Der Übungsabend fiel aus. Aber wenigstens hatte der Vermieter Fixe-Os Mist nicht gesehen.
Aus heutiger Sicht betrachtet beschrieb ich in meinem Traumbuch bis zu diesem Punkt eine vielleicht skurrile, aber im Ganzen problemlose und glückliche Zeit. Aber die Kapitel waren noch nicht an ihr Ende gekommen und steuerten auf eine fulminante Entwicklung zu.
Das Schwein im homo sapiens sapiens
Tempora mutantur … Unser Dichter aus längst vergangener Nachbarschaft formulierte das anders und schöner: „Eins zwei drei im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit.“ Ja tatsächlich: Fixe-O und Anouk wurden größer, das Söhnchen entwickelte sich zu einem bemerkenswerten Sportler, dessen Ruhmesblatt sogar international in diversen Zeitungen und Magazinen prangte. Diana bestaunte ihre Freundin Brunsgard, der sie es gleichtun wollte. Die lief hin und wieder magisch angezogen in einem Stück fast 100 km bis zum Brocken, verleibte sich dort jeweils 8 Knödel ein und bekam als Vegetarierin auch eine Siegermettwurst riesigen Ausmaßes, die Diana im Internet teuer für sie verkaufte. Aber nicht genug damit: Brunsgard vergaß auch mit Hinweis auf Kneipp, der angeblich selbst im Winter nicht an sondern in der Donau zu sehen war, ihre nächtlichen Nacktwanderungen in der Leine nicht. Ich schrieb weiter an meinen Partituren und Büchern, und gab als Pianist und Organist im In- und Ausland Konzerte.
Das war nun alles nicht verkehrt, aber wie gesagt: „Wir laufen mit“. Wieder einmal schlug die Kirchenglocke an einem schönen Sommermorgen siebenmal, und mir kam, während ich träumte, mein böser Traum von damals in den Sinn. Noch immer war sie schön und jung, meine Diana, und lag wie ehedem verführerisch neben mir. Ich hörte, wie sich in die Glockenschläge ein merkwürdiges helles Klingeln mischte. Es war die Klingel an unserer Wohnungstür. Ich stand auf, warf mir meinen Morgenmantel um und öffnete. Ein hübscher schlanker Mann mit Blumen in der Hand stand vor mir, schaute mich erstaunt an und fragte nach Diana. „Meine Frau schläft noch.“ Er ließ die Rosen erschrocken fallen, drehte sich um und verschwand. Was um Gottes willen war das? Doch nicht etwa? Nein das ist unmöglich, oder doch?
Ich dachte an die Zeit der 68er. Die hatte sich nicht nur in Berlin abgespielt, sondern auch in Hamburg in der LH25, dem Haus meiner Eltern. Damals gab es noch