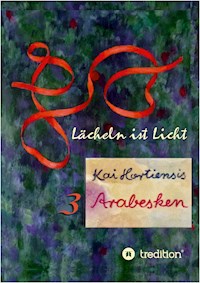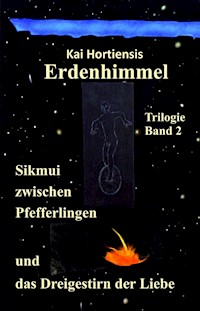
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Merle, ein blutjunges, auf den Babystrich gezwungenes Mädchen, hört in einer Kirche Orgelmusik und spricht die junge Organistin Sikmui mit dem Satz an "Das ist mein Leben!" Ein so tiefes Verständnis für sich und ihre Musik ist Sikmui nie vorher begegnet, und so entsteht zwischen den beiden eine unverbrüchliche Liebe. Sikmui, Saphira, eine walkürenhafte Riesin, und die Schamanin Finja erleben anlässlich eines Konzertes das herzzerreißende Coming-out Merles und nehmen sie in ihre Obhut. Zwischen den Frauen Sikmui, Merle und Saphira entsteht ein Dreigestirn der Liebe, das seinen Kontrapunkt in der Beziehung zwischen Sikmui und ihrem Freund, dem Portraitmaler Albért, erfährt. Traum und Wirklichkeit, Magie und Realität im Spiegel fernster Vergangenheit und Zukunft durchdringen das sich bunt und matriarchal zwischen einer Menge engstirniger "Pfefferlinge" entfaltende Leben der Frauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kai Hortiensis
Erdenhimmel
Trilogie - Band 2
Sikmui zwischen Pfefferlingen
und
das Dreigestirn der Liebe
Impressum
© 2021 Autor: Kai Hortiensis
Herausgeber: Kai Hortiensis
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN:
978-3-347-35194-3 (Paperback)
978-3-347-35195-0 (Hardcover)
978-3-347-35196-7 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorderseite: Gemälde von Henning Loeschcke 150 x 115, Öl auf Leinwand (ohne Titel), 2015
Die Geschichte ist frei erfunden.Falls es Ähnlichkeiten mit lebenden Personengeben sollte, sind diese rein zufällig.
Sikmui zwischen Pfefferlingenunddas Dreigestirn der Liebe
Inhalt
Die Landorganistin
Pastor Hartbock
Kaiser Rothaar
Musiklehrer
Das schlimme Zimmer
Stille Nacht, heilige Nacht
Der Wolf, das Lamm
Beim Psychologen 1
Katharsis
Rosenrot und Schneeweißchen
Up’n Dörpe
Finja und das Mädchen
Der Anschlag
Frau Dr. Grarmstiel
Stille Nacht, heilige Nacht 2
Sikmui und Albért
Bei Menzig
Saphira
Ein Konzert in Hannover
Der Brecher
Ein Dreigestirn der Liebe
Der Portraitmaler und andere Unglaublichkeiten
Merle
Das Portrait
Finja und Merle im Wald
Eine neue Malaktion
Einssein
Frau Krähol
Die Pferdeflüsterin
Yoga
Wieder in Hannover
Erneutes Treffen mit Albért
Egbert und die Bärenkussfrau
Matriarchalische Knospen
Der Wels
Zurück in Hannover
Sikmui, Albért und Finja
Das Konzert
Kein Rathauskeller
Die Rübenzählerin
Weihnachten - ein tierisches Märchen
Eine Oase des Lebens
Die Hochzeit
Sikmui zwischen Pfefferlingenunddas Dreigestirn
Die Landorganistin
Als Sikmui 14 Jahre alt war, hatte sie nicht das Bedürfnis, ihre Heimat und den See darin zu verlassen, wie es Zarathustra tat, und schon gar nicht war sie verliebt, wie einst Viktoria in Johannes. Stattdessen saß sie auf der Orgelbank in der Kirche und spielte klangverloren ihre eigene Musik. Die war zwar noch grün, hatte aber schon unverwechselbar Sikmui in sich. Aber nur im eigenen Topf zu garen, kam für Sikmui nicht infrage. Sie war neugierig und wollte - was sie schon seit vielen Jahren tat - die gesamte europäische Kunstmusik kennenlernen und, soweit es ihre bis dahin gediehenen Fähigkeiten zuließen, auch spielen. Deshalb nahm sie sich Noten von Pachelbel, z. B. sein Hexachordum Apollinis vor, wozu ihr ihre Lehrer geraten hatten, oder auch Orgelwerke von Buxtehude, dem Lehrer Bachs, und brachte auch gerne selbst verfasste Transkriptionen wie z. B. Saties Gymnopédien, Hindemiths Fünftonstücke oder die kleine d-Moll-Phantasie Mozarts auf der Orgel zum Klingen. Ja, Musik war Sikmuis große Liebe.
An Jungen dachte sie selten. Die waren ihr einfach zu blöde und wenn, dann verbannte Sikmui sie in ein fernes Elysium.
Zu dieser Zeit war sie bereits Land-Organistin an einer akzeptablen zweimanualigen Ott-Orgel, und während die meisten die Beatles, Pink Floyd und Ähnliches hörten, schlug sie gerne das Kirchengesangbuch auf und vervollkommnete spontan die dort vorfindlichen einstimmigen Lieder zu drei oder vierstimmigen Sätzen. Das Improvisieren in traditionellen Sprachen, die ganz anders waren als ihre eigene, machte ihr Spaß, und auch die Kirchgänger erfreuten sich meistens daran.
Hingegen langweilte sie das Gerede in der Kirche. Antworten auf wichtige Fragen wie: „Was ist die Liebe und was bedeutet der Tod?“ wurden ausgelassen oder wurden derart flach und floskelmäßig beantwortet, dass es Sikmui geratener erschien, während der Babbelzeit Bücher zu lesen, z. B. Platons Symposion oder Doktor Faustus von Thomas Mann.
Sehr erfrischend hingegen erlebte sie unfreiwillige Theaterstücke im Gotteshaus oder überhaupt Unbotmäßiges, das dort nicht hingehört. Das war meistens zum Lachen oder zum Weinen oder zu beidem gleichzeitig, was meistens der Fall war.
Pastor Hartbock
So kam es z. B. in Holterbach zu einem ungewöhnlichen Geschehen zwischen dem Pastor und seinen lieben KonfirmandInnen. Es war nach einem Gottesdienst. Sikmui spielte noch ein wenig - gewissermaßen als Nachklang ihres Schlussstückes, als sie in der Kirche Jugendliche herumtoben hörte. Der Pastor war offenbar schon nach draußen gegangen, und nun tanzten die Mäuse. „Warum nicht?“ dachte Sikmui, zog ein kräftigeres Register und spielte weiter. Als der Lärm aus Schreien, Rufen wie „Hierher, guck doch hin, ja der Pass saß, Blödmann! Abgeben, hier stehe ich, hieeer du dumme Pute!“, dazu Poltern, Krachen Schreien wie „Ich habe mir den Arsch am Ofen verbrannt, Auaaaa“, wechselte Sikmui zur Improvisation, zog noch weitere Register und veredelte das Getöse musikalisch. Von den unflätigen Höllenklängen zurückgelockt kam Herr Hartbock angelaufen und - obwohl schon älter - schlug die Tür auf und sprang tatsächlich wie ein gehörnter Bock in seine heilige Kirche. Was er sehen musste, davon zehrte er noch lange. Es war ein gekonnter Fallrückzieher, der bewirkte, dass dem geistlichen Herrn der Adventskranz um die Ohren flog. „Wer hat“, brüllte Herr Hartbock, krebsrot im Gesicht, die »dumme Pute« an, die gerade in seiner Nähe stand, „mit dem Adventskranz Fußball gespielt?“ Die dumme Pute war die rote Zora, wie man sie normalerweise respektvoll nach dem gleichnamigen Jugendbuch nannte, und die war gerade mit Besserem beschäftigt als mit dem Pastor zu plaudern. Sie sprang zirkusnummerverdächtig über die Bänke der Heils-Anstalt, was Sikmui, in den Orgelspiegel blickend, wiederum musikalisch wunderbar karikierte, und hatte nun die Absicht, dem Idioten, der sie so abschätzig während des Adventskranz-Fußballspiels tituliert hatte, ein paar „aufs Maul“ zu geben. „Verflucht“, schrie Pastor Hartbock, „Zora“ - ihm war ihr Spitzname nicht entgangen - „spring nicht herum, sondern komm her und antworte: wer hat mit dem Adventskranz Fußball gespielt?“ „Gleich“ rief Zora, „Ich muss noch etwas erledigen.“ „Nein komm sofort her. Welcher Schweinebengel hat den Adventskranz durch die Kirche geschleudert und auch noch mit dem Fuß?“ Sein Zorn war wirklich bemerkenswert. Er hatte tatsächlich Hörner wie das liebe Vieh. Zora war unterdessen am Ort ihrer Erledigung angelangt und vollzog ihre Strafaktion respekteinflößend, was Sikmui mit staccatierten Rhythmen aufgriff. „Orgel aus!“, brüllte nun Pastor Hartbock nach oben, was Sikmui ärgerte und sie jetzt nur noch einen Dauerton spielen ließ. „Wir haben einen Heuler in der Orgel, lieber Herr Hartbock“, rief sie nach unten. Die Jugendlichen lachten und die rote Zora am meisten. Das war nun allerdings für „Hartbocki“ - wie ihn die KonfirmandInnen nannten - der Gipfel. Mit dem Kranz in den Händen machte er sich daran, die Meute zu jagen und leider auch in der Absicht, sie zu schlagen. Hörner hatte er ja schon.
Da machte ihm der Adventskranz jedoch vorübergehend den Garaus. Das blöde Ding, der Kranz, der inzwischen seinen Kerzen- und sonstigen Weihnachtsschmuck verloren hatte, ging auf und verwandelte sich in einen langen grünen stacheligen Schwanz. Der geriet dem heiligen Mann im heiligen Zorn zwischen die heiligen Beine und brachte ihn zu Fall, worauf teuflisches Gejohle ausbrach. Der Gehörnte jedoch sprang, was man nicht für möglich gehalten hatte auf die Hinterbeine, ergriff den Stachelschwanz erneut, schwang den wie ein Cowboy sein Lasso hoch über seinem Silberhaupt und begab sich brüllend erneut auf Jagd, was Sikmui mit einem gewaltigen Akkord kommentierte, nicht ohne freundlich darauf hingewiesen zu haben, dass die Orgel wieder in Ordnung sei. Weit kam Herr Hartbock nicht mehr. Die demnächst zu firmenden, angeführt von der roten Zora, liefen hakenschlagend wie die Hasen zwischen den Bänken hin und her und dann schleunigst aus der Kirche hinaus ins Freie. „Kirche kann wirklich toll sein“, dachte Sikmui. Aber darin verfing sie sich nicht. Letztlich hatte sie Besseres zu tun.
Kaiser Rothaar
In der Nachbargemeinde mit dem merkwürdigen Namen „Ballibax“, wo es in der Nähe der Kirche sogar einen kleinen Zoo gab, wurde Sikmui gelegentlich gebeten, als Gastorganistin zu spielen, wenn der dortige Organist, Herr Puff, sich krankgemeldet hatte oder beim Knobeln hockte. Nun war es so, dass seit Kurzem in dieser Kirche „Kaiser Rothaar“, wie man den großgewachsenen jungen Pastor seiner mehr als schulterlangen rötlich blonden Haare wegen nannte, die Aufgabe hatte zu predigen.
Das tat er sprachgewandt und heftig, besonders wenn er erst nachts um fünf aus der Disko nach Hause gekommen war. „Nur dies Gepolter auf der Treppe fast jede Nacht, ist bös Herr Döppe“ zitierte Fräulein »Pipi«, eine im selben Haus zur Untermiete wohnende schon seit langem pensionierte Gemeindeschwester, ihren Hausdichter Busch, wenn sie Kaiser Rothaar vorbeitrampeln hörte. Der Kaiser versprach, sich zu bessern, was aber leider nicht geschah.
Sikmui gefiel dieses „Himmelstier“, wie sie den jungen Pastor heimlich und unbewusst zutreffend nannte. Es waren wohl die ersten noch gänzlich jungfräulichen Gefühle und zaghaften Erregungen, die Sikmui durchfuhren, wenn sie dem, wie sie fand, hübschen Mann begegnete. Und dem „Himmelstier“ gefiel die braunblonde schöngewachsene junge Frau so sehr, dass er nachts von ihrer Schönheit träumte, aber nicht nur davon. Konnte das gutgehen? Vielleicht wäre es das ja, wenn Kaiser Rothaar Sikmui in ganzer Zartheit und tiefer scheuer Einfühlung verehrt hätte. Aber als bereits erfahrener Mann, dessen Hormone ihn schon manchen Haken schlagen ließen, wusste er, dass Sikmui geschlechtsreif war und hoffte, sie in absehbarer Zeit „pflücken“ zu können. Mag sein, dass ihm das bei anderen Frauen gelungen war, bei Sikmui jedoch legte der Kaiser eine furiose Bruchlandung hin, und das kam so: Immer wenn Sikmui beim „Himmelstier“ an der Orgel Dienst tat, spielte sie, naiv wie sie in Liebesdingen war, besonders innig und schön, und besagtes Tier lobte sie dafür, bis ihm der Schnabel weh tat. Das war auch gut so, denn es war gelogen. In Wahrheit hatte er wie die meisten PastorInnen keine Ahnung von guter Musik und war wie mit dem Holzhammer vors rotblonde Haupt geschlagen, wenn Sikmui es schüchtern gewagt hatte, etwas von der eigenen ein wenig noch an 12-Ton erinnernden Musik und damit von der eigenen Seele preiszugeben.
Dann zeigte sich am rotblonden Kaiser eine sehr hässlich Variante geistiger Umnachtung. Das betraf besonders sein Hörverstehen, das durch Rock und Pop nieder gehalten wurde und selbst im Kirchenzuschnitt nie avancierter neuer Klassik z. B. Krzysztof Penderecki, Ligeti oder Strawinski begegnete. Dem schlichten Gottesknecht hatte das Schicksal im Laufe der Jahre tatsächlich stattliche Durchschnittsohren wachsen lassen. Dennoch bog sich dieser Mensch vor gespielter Begeisterung und machte, Sikmuis Spiel lobend, peinliche Komplimente, nicht wissend, wovon er sprach. Sikmui bemerkte das, spürte, dass da etwas schief lief und dachte zunehmend an den goethischen Knaben, der ein Röslein stehen sah. Ihre Offenheit gegenüber dem Pastor nahm ab und ihre Vorsicht zu. Das bemerkte der Rotblonde zwar, aber seine Faszination für Sikmui nahm trotzdem nicht ab.
Musiklehrer
Sikmui war für Komplimente ihr Spiel betreffend nicht grundsätzlich unempfänglich, die gehörten zur Kritik, die sie gelegentlich von ihren Lehrern gleichermaßen empfing, dazu. Mit Komplimenten jedoch ihr Haar, ihr Gesicht, ihren Körper betreffend, konnte sie nicht viel anfangen, sie waren ihr eher lästig und ganz besonders, wenn sie durch Pfiffe erfolgten, die dazu auch noch in falschen Intervallen erklangen. Aber wenn ihr Derartiges begegnete, musste sie zu ihrer Überraschung an den Kaiser denken. Dann wurde ihr heranreifendes Mädchenherz seltsam unruhig. Aber das geschah selten. Meistens kümmerte sich Sikmui um die Verbesserung ihrer Fähigkeiten auf der Orgel, dem Klavier, der Gitarre, der Geige und sogar im Hinblick auf die Komposition.
Von den Instrumentallehrern mochte sie besonders ihren Orgellehrer. Letzterer war ein kleiner, zum Jähzorn neigender glatzköpfiger Konzertorganist, der zugleich Kantor des besten Chores ihrer Heimatstadt Gurlett war. Er hieß Hornrothh, und wie er hieß, so war er auch. Wenn sie Orgelunterricht hatte, ließ er es sich oft nicht nehmen, auf die Orgelbank zu springen und sie mit den Worten „Weg, weg, weg!“ derart zu bedrängen, dass sie von dieser oft herunterfiel. „Können sie sich nicht wie ein normaler Mensch an die Orgel setzen?“ fragte Sikmui dann, aber das hörte Herr Hornrothh nicht mehr, denn er spielte bereits vor, wie Sikmui zu spielen hätte. Meistens überzeugte sie das, und sie nahm ihm seine Tempramentsausbrüche nicht übel. Er war eben ein Rumpelstilzchen, aber eins von der liebenswerten Sorte. Sikmui mochte ihn als Lehrer und er sie als hochbegabte Schülerin, auf die er stolz war. Gerne nahm diese nun auch an seiner Arbeit als Kantor teil und sang voll Freude im Sopran alle großen Werke der Kirchenmusik, die Herr Hornroth mit seinem Chor und dem städtischen Sinfonieorchester aufführte, mit. Auch in der Chorarbeit war der Kantor ein begnadeter Wüterich, beinahe wie Friederich im Struwwelpeter, nur dass der an Haaren auf dem Kopf viel zu viel hatte, was Herrn Hornroth an Haaren - jedenfalls auf dem Kopf - fehlte. Einmal. nachdem er mehrfach um Ruhe gebeten hatte und ein schwarzlockiger Theologiestudent namens Jungquis noch immer dazwischen quatschte, geschah es, dass der Kantor auf den Stuhl vor dem Flügel sprang und „Raus, raus, raus!“ brüllte und dann, als nichts geschah, sogar den Flügel als Plattform gemsgleich eroberte und schrie: „Herr Jungquis, sie stören permanent durch ihr unverschämtes Dazwischengerede. „Raus mit ioi“, - seine Stimme überschlug sich - „ich meine Ihnen, rrr“ - er klang jetzt wirklich wie ein bissiges Tier - „Rrrrrrrraaaaaaus!“ Bei dieser herzerfrischenden Rede bekam Herr Hornrothh, was in seinem Namen schon angelegt war, rote Hörner und einen riesigen knallroten Kamm, eine Übung, die ihn später fast das Leben gekostet hätte, wenn der Klinik-Hubschrauber nur ein wenig später gekommen wäre. Besagter Jungquis bemerkter endlich, dass er gemeint war, zog still den Schwanz ein und verdrückte sich, den Boden intensiv betrachtend, schleunigst. Der Kantor sprang vom Flügel ab, schüttelte sich heftig und rief Sikmui zu sich. „In die Kirche mit dir und den Sopranen. Und übe die Einzelstimme ordentlich!“ „Gerne, Herr Hornroth“, antwortete Sikmui, die seinen Namen besonders freundlich und leicht gedehnt aussprach, sodass einige der Männer im Bass ein Lächeln nicht überwinden konnten. Die Jungfrau ging, die Damen folgten ihr und Herr Jungquis, der noch beschämt vor der Tür stand fragte: „Seid ihr etwa auch rausgeflogen?“ „Einzelprobe“, antwortete Sikmui, „wie bei dir, nur etwas anders.“ Ja, Meister Hornrothh war schon ein besonderer, was sich allerdings sehr positiv auch in seinem höchst hörenswerten furiosen Spiel von Liszt-Werken ausdrückte, die er selber für die Orgel umgeschrieben hatte.
Der andere ihrer wichtigen Lehrer zu dieser Zeit war ihr Kompositionslehrer, den sie regelmäßig in Hannover aufsuchte, Prof. Max Lax, im Temprament das komplette Gegenstück zu Hornroth. Für Sikmui war dieser noch verhältnismäßg junge Mann geradezu vom Himmel für sie geschaffen. Selber noch ein Suchender, überließ er Sikmuis Entwicklung ihrem eigenen Stern. Fest umrissene Aufgaben gab es selten. Dafür viele vorsichtige Empfehlungen, respektvoll vorgebracht, dies oder das z. B. von Stockhausen oder Ligeti zu hören. Aber auch seiner Meinung nach lesenswerte Bücher nannte er, z. B. „Doktor Faustus“ von Thomas Mann, „Einbruch in die Freiheit“ von Jiddu Krishnamurti, was Sikmuis Leben positiv stärkte, oder Alma Mahlers „Erinnerungen an Gustav Mahler“. Kompositionstechnisch ging es um Messiaens Buch über seine musikalische Sprache, das Sikmui erst aus dem Französichen übersetzen musste, wobei ihr ihre Mutter weitgehend helfen konnte. Auch Hindemiths Unterweisung im Tonsatz wurde durchgearbeitet, und die Kapitel Schönberg, Berg, Webern einschließlich der Bücher dazu ließ Prof. Lax selbstverständlich folgen. „Mach dich niemals davon abhängig, das sind nur Beispiele, wie man es machen kann, nicht mehr. Zeig mir lieber deine eigenen Arbeiten und erkläre genau dein kompositionstechnisches Herangehen.“ Hier ließ Herr Lax wenig durchgehen.
„Das klingt nach Bartok, das klingt nach Strawinsky, das ist Hindemith pur und hier hast du wohl zuviel Messiaen gehört. Ach, und Versuche mit 12-Tontechniken hast du auch schon gemacht. Aber: Wo bleibt Sikmui. Ich will nicht sagen, dass ich gar nichts von dir in deinen Noten entdecke, aber das muss stärker werden.“ Sikmui spürte das auch. Aber wie konnte das stärker werden?
Herr Lax war da wohl etwas weiter. Zu der Zeit verfasste er jedenfalls skurrile Musiktheaterstücke, die Sikmui gefielen und sie wünschen ließ, dass Herr Lax auf diesem Wege weitergehen würde. Von ihrem ersten Kompositionslehrer Prof. Gans in Gurlett hatte sie die traditionellen Kompositionstechniken kennengelernt: Kontrapunkt, Harmonielehre, Formenlehre, - und das über mehrere Jahre. Und wie es wichtige zeitgenössische Komponisten machten, wusste sie nun auch. Aber was war ihr Ding? Sikmui fühlte sich unter dem Gelernten wie eine Verschüttete nach einem Erdrutsch. Es war nicht so, dass sie das Eigene Unverwechselbare gar nicht in sich spürte. Beim klangverlorenen Improvisieren am Klavier und besonders auf der Orgel lag es oft wie eine glühende Kohle in ihr. Und dann klang ihre Musik so, dass Kaiser Rothaar die Krätze kriegte und sich in gelogenen Lobeshymnen verlor. Oder irrte sie sich? Vielleicht hatte er dummschwätzend doch etwas Eigentliches, Echtes gespürt? Vielleicht sogar wie ein Mädchen vom Steintor in Hannover, das, als sie zufällig Sikmuis Improvisationen in der Kirche hörte, zu ihr ging und sagte: „Das ist mein Leben“, woraufhin Sikmui weinte und das Mädchen vom Babystrich umarmte. „O Gott, mein Gott“ schluchzte Sikmui und drückte das ebenfalls tränenrote Mädchen an sich. Sie hielten sich aneinander fest und hörten halb unbewusst zweimal die Turmuhr unterschiedlich oft schlagen.
In diesen Minuten gewannen die Quellen, aus denen sich Sikmuis und des fremden Mädchens Leben gestaltete, eine ungeahnte Vertiefung.
Sikmui bemerkte das zuerst in der plötzlichen Bantwortung ihrer Frage nach dem unverwechselbar authentischen Anfang ihrer Musik: Ihr kam die Szene eines Romans in den Sinn, wie eine junge Dichterin ihr Gedicht sich auf dem Teppich wälzend quasi gebar. „Das ist es!“ fühlte Sikmui. „Aus dieser Quelle wird meine zutiefst eigene Musik entstehen.“
Das schlimme Zimmer
Einige Jahre später, Sikmui war nun tatsächlich zu einer schönen jungen Frau herangewachsen, traf sie Kaiser Rothaar in der Nähe seines großen Niedersachsen-Fachwerkpfarrhauses, in dem er nach wie vor residierte, wieder. Eigentlich wollte sie sich nur noch einmal die Orgel ansehen, denn sie hatte in der nächsten Zeit in der dortigen Kirche in einer Reihe von Gottesdiensten zu spielen. Ganz wohl war ihr bei dem Gedanken, dem Himmelstier wieder zu begegnen, nicht. Aber als sie ihn nun traf, um den Kirchenschlüssel zu holen, kam er ihr nicht mehr ganz so bedrohlich vor. Das vielleicht auch deshalb, weil sie inzwischen auch ein wenig mehr Erfahrungen mit dem männlichen Geschlecht gemacht hatte und wusste, worum es den Vertretern dieser Art von Menschen vor allem ging. Damit konnte sie umgehen.
„Hallo Sikmui“ rief ihr der Kaiser auf der Straße zu. „Ich war noch bei den Schafen, aber wir können gleich reingehen.“ „Eigentlich will ich nur den Schlüssel für die Kirche abholen.“ „Den gebe ich dir gleich, komm.“ Er duzte sie noch immer, und sie tat es ihm nun gleich. „Albért, ich habe wenig Zeit.“ Er behauptete, dass auch er noch viel zu tun hätte, aber ihrer beider Zeit für eine Tasse Tee noch ausreichend sei, zumal sie sich lange nicht gesehen hätten. Als sie das Haus betraten, sagte Albért, er wolle ihr zuerst etwas Interessantes zeigen, lief die Treppe zum ersten Stock hoch und forderte Sikmui auf, ihm zu folgen. Kurz darauf standen beide in einem größeren hellen Raum mit vier Fenstern und vielen Gemälden an den Wänden. Sikmui bekam einen Schreck, denn die Bilder zeigten unterschiedliche Frauen völlig nackt. Die Köpfe waren recht klein und fast schemenhaft gehalten, aber zum Becken hin nahmen die Figuren an Größe und Deutlichkeit erheblich zu und zeigten sich schließlich photographisch genau und übermäßig groß im Bereich ihrer Genitalien.
„Ja wie du siehst male ich auch,“ sagte das Himmelstier, „in Kassel studiere ich nebenbei Portraitmalerei. Hier sind schon ein paar Ergebnisse zu sehen.“
Sikmui hatte in solcher Präsentation noch nie weibliche Genitalien gesehen, und selbst die eigenen hatte sie sich noch nie derart gründlich im Spiegel angeschaut.
„Unter Portraitmalerei stelle ich mir eigentlich etwas anderes vor“, sagte Sikmui. „Das war früher“, sagte Albért. „Heute arbeitet im Portrait jeder und jede am menschlichen Körper das heraus, was ihn oder sie besonders interessiert. Ich habe vor einiger Zeit eine Ausstellung von einer Photokünstlerin gesehen, die hunderte von unterschiedlichen weiblichen Genitalien zeigte, völlig unbehaart in verschiedenen Zuständen, z. B. neutral, menstruierend oder auch sexuell erregt. Soweit habe ich mich in meiner Malerei noch nicht vorgewagt.“ „Ja“, sagte Sikmui „die Ausstellung gab es auf Schloss Löfck. Ich habe davon gehört. deine Malerei ist zweifellos gekonnt. Aber erkläre mir mal, was das soll. Oder bist du einfach nicht ganz frisch im Kopf?“ „Das kann auch sein“, meinte Kaiser Rothaar, „aber du kannst auch eine seriöse Erklärung haben: Ich liebe Frauen und lehne deren Jahrhunderte alte sexuelle Unterdrückung durch die Kirche ab. „Ach, deshalb diese Galerie im Pfarrhaus“ meinte Sikmui ironisch. „Einen besseren Platz kann ich mir kaum vorstellen“ erwiderte Albért. „Und ich kann mir keinen besseren Startplatz für den Abflug eines gewissen Kaiser Rothaar aus seinem Amt vorstellen“, meinte Sikmui trocken. „Und wenn schon“, sagte das Himmelstier, „aber dann soll diese Galerie noch vollendet werden, und dazu kann ich mir nichts Wunderbareres vorstellen, als dich zu portaitieren.“ „Etwa auch so wie die Frauen da an der Wand?“ „Nein noch besser.“ „Ich glaube, bei dir ist nicht nur ein Rad ab, sondern die Deichsel dazu. Ist dir nicht klar, dass das, was du produzierst, frauenverachtende Pornographie ist?“ „Nein, wieso denn das?“, sagte Albért etwas kleinlaut. „Muss ich das wirklich erklären?“ „Bitte!“, sagte Kaiser Rothaar. „Mein Gott beschütze diesen Vollidioten! Eine Frau ist unendlich viel mehr als ihre Scheide, und wer das anders sieht und darstellt, wie du das offensichtlich tust, betreibt durch Reduktion Detailfetischismus, also gewalttätige Pornographie, und das ist das Gegenteil von Befreiung der weiblichen Sexualität, du unglaublicher Blödmann. Ließ mal das Buch »Pipis und Sieben« von Kai Hortiensis, dann wird dir klar, was ich meine.“ „Und welche Darstellung z. B. von dir würde vor deinen Augen Gnade finden?“ „Was ist denn an mir wohl noch mehr dran als meine Scheide, und nun sag bloß nicht »deine Brüste«, dann zertrümmere ich diesen Stuhl auf deinem Dummschädel.“ „Nein, natürlich nicht“, druckste das Himmelstier hervor, „sondern z. B. dein Orgelspiel.“ „Ja“, sagte Sikmui „ja, zum Beispiel.“ „Aber dann“, meinte Kaiser Rothaar, „könnte ich dich doch nackt an der Orgel malen.“ „Meinst du dich als Nackedei?“ „Gerne auch, aber nein, dich natürlich!“ Sikmui trat gegen den besagten Stuhl, dass der durchs Zimmer flog, stampfte mit dem Fuß auf und verließ einen Wutschrei ausstoßend, den Ort der Schande im gestreckten Galopp.
Aber damit hatte es sich noch nicht. Der Abflug des rothaarigen Kaisers stand in ungeahnter Opulenz tatsächlich noch bevor. Denn was Sikmui prophezeit hatte, wurde wahr und schlimmer, als sie es ahnen konnte.
Stille Nacht, heilige Nacht
Es weihnachtete wieder einmal mit hochgeschmücktem Kranz, der diesmal da blieb, wo er hingehörte, und keinem Kirchgänger kerzenlos um die Ohren flog. Sikmui war eingeteilt, mit Kaiser Rothaar zusammen den Heiligabend-Gottesdienst zu gestalten, er auf der Kanzel, sie an der Orgel. „Hier wird er wohl keinen Scheiß produzieren“, dachte Sikmui. Das war auch so, denn das Himmelstier hatte davon schon zur Genüge hervorgebracht, so dass es erstmal reichte. Die Kirche war im Gegensatz zu sonst voll wie in Tokio die Züge, in die die Menschern von extra dafür angestellten Pushern bis zur Erstickung gepresst wurden. Sogar auf die Orgelbank wälzte sich die Masse Mensch, so dass Sikmui Mühe hatte, die Aufdringlichen wegzustoßen. Dabei zerbrach allerdings die Bank, und Sikmui lag menschenüberhäuft auf den Pedalen, was die großen Pfeifen zum Tönen brachte.
„Was ist los?“, rief das Himmelstier. „Ich bin verschüttet, Männer liegen auf mir und auch Frauen. Und Kinder klettern darüber.“ „Waaaas?“, schrie Kaiser Rothaar. Der Menschenhaufen bewegte sich heftiger, und das ergab eine bassbetonte aleatorische Musik. „Cage hätte seine Freude daran“, dachte Sikmui, die sich plötzlich an den Armen und Schultern vorsichtig, fast zart gepackt spürte. Es war der Kaiser, der Sikmui nicht ohne verständnisvolles Zureden half, dem Menschenhaufen zu entkommen. „Ein Rüpel ist er nicht, eher rücksichtsvoll und vorsichtig“, dachte sie. Die Bankreste wurden zum Verheizen verschenkt und die alte stabile Eichenbank, die hinter der Orgel stand, wurde herbeigeholt. Sikmui spielte ein schönes getragenes Eingangsstück, und der Gottesdienst nahm seinen Lauf wie immer mit schreienden Kindern und um Ruhe flehenden schreienden Eltern. Sikmui war versucht, das musikalisch zu kommentieren, hielt sich aber derart im Zaum, dass ihr zu Weihnachten besonders edles Zaumzeug zu zerreißen drohte. Kaiser Rothaar gab auf der Kanzel ein beeindruckendes Bild ab, und diesmal hörte Sikmui zu. Es war nicht das übliche, den Lärm in der Kirche überbrüllende Gerede von Herberge, Stall, Krippe und Maria, die scheinbar vor allen Leuten ein Kind gebar, welches in Windeln gewickelt wurde.
Nein, Kaiser Rothaar sprach von einem neuen, Heilung bringenden Bewusstsein, das - sofern es im Menschen bestimmend wäre - das Böse wie Krieg, Auschwitz, Vergewaltigung, Frauenverbrennungen wie z. B. im Falle der Französin Margareta Porete und anderen heiligen Frauen, Hexen genannt, unmöglich machen würde. Er sprach von der göttlichen Liebe, die - fern der Kirche - hinter solchem Wandel als Wirkkraft stünde. Und diese Liebe sei nun mit dem nie dagewesenen Bewusstsein des kleinen Jesus in die Welt gekommen. Er sei - was sein späteres Leben offenbar machen würde - ein Beispiel für die Möglichkeit eines Bewusstseinswandels im Menschen, eines Bewusstseinswandels des Mit- und nicht Gegeneinanders, worum sich jeder und jede zu bemühen hätte, wenn nicht die Welt in den Orkus fallen sollte. Und das Mittel dazu sei nicht nur das Gebet, sondern, wie es im alten Testament stünde, das völlige Stillsein vor Gott, und zwar täglich mindestens eine Stunde. Das erinnerte Sikmui an das, was sie bei Krishnamurti in dessen Buch „Einbruch der Freiheit“ gelesen hatte.
Als sich dadurch ihr Bild vom Himmelstier gerade zum Besseren zu wandeln begann, gab es einen großen Krach an der Kirchentür, die geradezu aufgebrochen wurde. Polizisten stürmten herein, die liebe Gemeinde einschließlich der Kinder hielt endlich mal den Brüll-Schnabel, und man konnte in ganzer Stille fassungslos erleben, wie der eben noch von Liebe sprechende Mann von der Kanzel gezerrt und ins Polizeiauto gebracht wurde. Sikmui spielte laut „O du fröhliche, o du selige gnadenbringende Weihnachtszeit“, was am Schluss des Gottesdienstes, der nun etwas anders als geplant endete, vorgesehen war, und einige ließen es sich nicht nehmen, in das schöne Weihnachtslied einzustimmen.
„Was war das?“ fragte man sich, und das fragte sich auch Sikmui, der der Kaiser nun leid tat. Selbst wenn er etwas Schlimmes verbrochen hatte, was Sikmui nicht glaubte, musste man ihn in seinem Weihnachtsgottesdienst am heiligen Abend verhaften?
Seine Verfehlungen wurden bald offenkundig. Der Mann war bis vor kurzem noch verheiratet gewesen. Seiner Sujet-Obzession als Maler wegen geriet er aber seit langem schon immer wieder in heftige Auseinandersetzungen mit seiner Frau. „Musst du ständig Frauen suchen, die bereit sind, ihre Genitalien malen zu lassen? du bist doch nicht ganz sauber im Kopf“, zitierte man sie. Für sie als Frau Pastor war das verständlicherweise schon abartig genug, aber als dann herauskam, dass er die Damen auch „pflücken“ wollte, was so gut wie immer gelang, reichte sie die Scheidung ein.
Über den gemeinsamen Besitz konnte man sich nicht einigen, und so kam es zu einer gerichtlichen Festsetzung, die das Himmelstier nicht anerkannte. Schließlich entwickelte sich das Elend dahin, dass er sich Sachen, die seiner Meinung nach sein Besitz waren, in einer Nachtaktion holte. Das wurde seitens seiner Ex mit einem Anruf bei der Polizei geahndet. Gefahr schien im Verzug zu sein und die Beamten rückten ein. Wie man erzählte, ging es nur um ein paar Bücher, was allerdings nur zum Teil stimmte. Denn tatsächlich wollte Albért nur seine Doktorarbeit, die in der Wohnung seiner Ex als fast fertiges Manuskript lag, an sich bringen.
„Wie kann das alles nur sein?“, fragte sich Sikmui, „bei einem Mann, der eben noch gute, zu Herzen gehende Worte gesprochen hatte, der sich - wie auch immer - um das Gute im Menschen kümmerte, hilfsbereit war, an den Gott der Liebe glaubte, sogar Schafe sich zur Freude und nicht zum Schlachten hielt. Sikmui verstand das nicht. Aber das Leben, das immer den Überblick hat, lachte: „du wirst es bald begreifen lernen, Sikmui.“
Der Wolf, das Lamm
Eines frühen Morgens lag Sikmui in der Badewanne und nahm mit geschlossenen Augen ein Tannennadelschaumbad mit Kokosöl. Sie hatte am Abend zuvor lange in der Kirche geübt und genoss nun das heiße duftende Wasser sehr. Als sie die Augen öffnete, durchfuhr sie ein Schock, der ihren Körper krampfartig zusammenzog. Über den Badewannenrand gebeugt stand ein großer grauer Wolf. Das Tier sah sie direkt an, war ruhig, bewegte aber manchmal seine Lefzen, so dass die Zähne sichtbar wurden. Gleichzeitig hörte Sikmui dann ein leises Knurren. Sie wollte aufspringen, hielt es dann aber für geraten, die Augen lieber wieder zu schließen. Sie lag völlig starr im schaumbedeckten Wasser, aber durch ihren Körper vibrierten unablässig Wellen der Angst. „Hurz“ dachte sie, und dann noch einmal „Hurz!“ Woher kam bloß dieses blöde Wort? Ach von diesem Kerkeling, diesem Ling, der die 12-Ton-Musik meinte lächerlich machen zu können. Aber das war jetzt nicht wichtig. Die wirkliche Frage war eine andere, und die ließ sich nun nicht mehr zurückdrängen: „War sie das Lamm?“ Sikmui schwitzte jetzt nicht nur vom heißen Wasser. Nichts geschah. Die Zeit stand still, Sikmui wagte nicht zu atmen, nur die Angstvibrationen blieben unkontrolliert.
Da fiel ihr plötzlich ein großes Plakat ein, das sie oft bei ihrer Freundin Finja an der Wand gesehen hatte. Darauf war eine junge hübsche Frau in einem blauen Wald zu sehen, die an ein Lamm gelehnt ihren Wolf, am Fell des Halses liebkoste. Das Tier genoss das scheinbar, sah aber gleichzeitig so aus, als ob es für die Verteidigung seiner Herrin jederzeit bereit war. Sikmui fragte mit weiterhin geschlossenen Augen ihren tierischen Besucher flüsternd, was es mit seinem Besuch auf sich habe. Der antwortete nicht. Wieder verging viel Zeit. Da öffneten sich ihre Augen. Aber Sikmui sah jetzt keinen Wolf mehr neben ihrer Wanne.
Als Sikmui ein paar Tage später ihrer Freundin Finja von ihrem Badewannenerlebnis erzählte, war Finja der Meinung, das Sikmui unbedingt einen Psychologen aufsuchen müsse, denn mit Halluzinationen sei nicht gut Kirschen essen. „Ich wollte dir das nur erzählen, aber keine Ratschläge haben, und Kirschen essen schon gar nicht. Dadurch wird, was in mir heil werden will, nur unterbrochen.“ Aber Finja ließ nicht nach. „Dann geh‘ doch wenigstens zur Familienaufstellung. Das habe ich auch schon 0mal gemacht und dann siehst du klarer.“ Sikmui war unsicher. Schließlich jedoch machte sie einen Termin bei einem Psychologen, einem gewissen Dr. Arschoff, überfraute sich und ging hin. Als Sikmui den Mann sah, durchfuhr sie die Gewissheit, dass eine Therapie bei ihm nichts bringen würde, zumal sie sowieso nicht wusste, wofür die überhaupt gut sein sollte.
Beim Psychologen 1
„Sie sind Schülerin?“, fragte Dr. Arschoff. „Nein“, erwiderte Sikmui. „Was machen Sie dann?“ „Ich gehe zur Schule.“ „Dann sind Sie doch Schülerin“, sagte Herr Dr. Arschoff. „Damit habe ich nichts zu tun.“ „Womit haben sie denn etwas zu tun?“ „Mit Musik.“ „Ja“, sagte Dr. Arschoff, sich bei der jungen Frau anbiedernd, „da gibt es ja heute auch tolle Gruppen, junge Leute mit E-Gitarren und so.“ „Die interessieren mich überhaupt nicht. Derartiges höre ich nicht, und spielen tue ich das schon gar nicht.“ „Sie spielen ein Instrument?“ „Ja, Klavier und Orgel.“ „Also Keybord, da kann man ja die verschiedensten Instrumente einstellen.“ „Ich spiele auf richtigen Instrumenten, - in der Kirche die Orgel, und zuhause habe ich einen Flügel.“ „Dann sind Sie wohl berühmt, oder wollen es werden.“ „Das ist Unsinn“, sagte Sikmui, „ich spiele aus anderen Gründen, aber Sie werden das nicht verstehen.“ „Das ist ja sehr interessant. Was spielen sie denn auf ihren Instrumenten?“ „Auf der Orgel Buxtehude, auf dem Klavier Bartok.“ „Nie gehört“, sagte der Herr Doktor. „Sie kennen diese Komponisten nicht?“, fragte Sikmui. „Nein, wieso sollte ich? Dann war‘s das, mit Kästchenklopfern will ich nichts zu tun haben. Meine verschwendete Zeit stelle ich ihnen in Rechnung.“ Sikmui war wütend, stand auf und ging. „Das ist das letzte Mal, dass ich derartige Idioten aufsuche“, dachte sie.
Katharsis
Das Gedichtgebären der jungen Dichterin hatte Sikmui nachhaltig beeindruckt, und nun geschah es tatsächlich, dass sich Sikmui auf den Teppich in ihrem Zimmer warf. Nicht nackt wie die Frau im Roman, die damit vom absoluten Nullpunkt anfangen wollte. „Ähnlich wie Stockhausen beim Sinuston“, dachte Sikmui, die ihre Szene gut vorbereitet hatte: Ihr Tonbandgerät lief bereits, und nun brachte Sikmui, der das Erlebnis mit dem geschändeten Mädchen nicht aus den Gefühlen ging, Ausdruckslaute erneuten Weinens und schließlich Schreiens hervor. Ganz von selbst wälzte sich ihr Körper immer wieder krampfend über den Boden, als sie plötzlich die Genitalien der vielen Frauen vor sich sah, die Kaiser Rothaar gemalt hatte und mit denen sie sich irgendwie solidarisch fühlte, ohne es zu sein. Es war eine Katharsis, die Sikmui durchlitt, und Sikmui fühlte sich plötzlich stark vom Drang gepackt, dem Mädchen vom Babystrich ganz nahe sein zu wollen. Sie ging zögernd ins Bad und entfernte ihr Schamhaar, bis sie meinte auszusehen wie das Mädchen und nicht weniger auch die gemalten Frauen. Dann überkam sie die Scham, und eine Vermutung fiel ihr wie ein großer Eiszapfen in den Kopf. „Jetzt bin ich verrückt geworden“, dachte sie, „jetzt brauche ich wirklich Hilfe.“ Doch beim Gedanken an einen Psychologen kam sie ruckartig wieder zu sich und fand nach einiger Zeit die Kraft, ihren ursprünglichen Plan erneut zu verfolgen. Das Tonbandgerät hatte sich inzwischen abgeschaltet, aber das gesamte Ausdrucksgeschehen war unversehrt erhalten. Sikmui schaltete das Gerät wieder ein und hörte sich alles an. Sie weinte dabei erneut, und der Satz des unglücklichen Mädchens „Das ist mein Leben“ dröhnte in ihrem Kopf. „Ja, offensichtlich ist es unser Leben“, und Sikmui schüttelte sich, als ihr die Tränen aus den Augen stürzten. „Aber nicht ganz“, dachte sie, „da gibt es noch einen gravierenden Unterschied.“
Sikmui stand mit einem Ruck auf und begann, das Klangmaterial zu analysieren. Sie zeichnete die Geräuschkurven in punkto Höhenverlauf, Stärkenverlauf, Farbverlauf einschließlich der Tonverlaufsansätze auf, und man staune nun: dem Ausdrucksgeschehen in Geräuschen entsprossen Töne, eine Musik der Befreiung, der Verarbeitung im wahrsten Sinn des Wortes, eine Verarbeitung des Schrecklichen. „Ach so“, dachte Sikmui und sie sah klar wie nach einer Operation am grauen Star: „Den Satz am Anfang der Duineser Elegien kann man auch umdrehen. Aus »Denn das Schöne ist nur des Schrecklichen Anfang« würde dann: »Denn das Schreckliche ist nur des Schönen Anfang«. Und dann“, dachte Sikmui, „bekommt auch der folgende Satz einen anderen und, wie mir scheint, wesentlich tieferen Sinn: »Das gelassen verschmäht, uns zu vernichten«.“
Dann war sie also so etwas wie eine Übersetzerin, die das Schreckliche zum Schönen macht, zum Schönen, was die Vernichtung verschmäht. Es war für Sikmui eine Art Notreifung, und sie fühlte sich neu.
Rosenrot und Schneeweißchen
Sikmui war nicht mit einem goldenen Löffel, auch nicht mit einem silbernen geboren worden, und selbst ein kupferner fehlte. Ihr Vater war gestorben, und die Familie war in tiefe Armut gefallen. Die Mutter bemühte sich redlich, aber sie hatte mehrere Kinder. Sikmui war daher gezwungen, sich sehr früh schon selbst durchs Leben zu schlagen. Gottseidank ging das leidlich mit Orgelspiel in der Kirche, und auch unterrichtete sie bereits ein paar SchülerInnen auf dem Klavier und ihren anderen Instrumenten. Aber das reichte oft nicht aus, besonders wenn es um dringende Anschaffungen wie Instrumente, ein gebrauchtes Auto, Reparaturen etc. ging. Dann war sie gezwungen, auch geldbringender entfremdeter Arbeit nachzugehen.