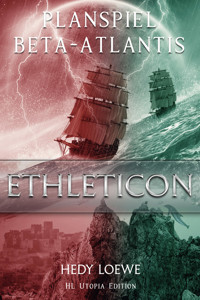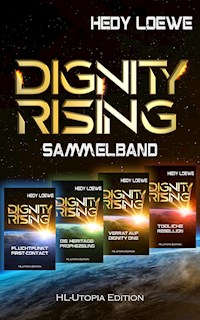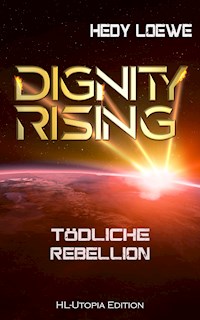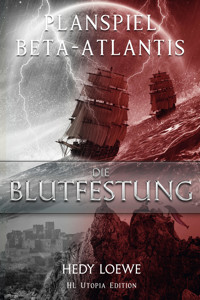
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HL UTOPIA EDITION
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das größte Live-Rollenspiel aller Zeiten wird zur Falle für alle Beteiligten. Kann Juniya dem Psychopathen Vadim Smalov noch entkommen? In dessen Blutfestung auf der Insel Albatrasca schwebt sie in höchster Gefahr. Der Rote Vadim regiert mit grausamer Brutalität, die er nicht nur an den eigenen Leuten, sondern auch an den Wasserwesen auslässt. Juniyas Erzfeindin Ambiela verbündet sich mit Abweichlern der Wasserwesen und setzt alles daran, Juniya zu ermorden. Skye und die Männer der Quicksilver müssen sich den Weg nach Albatrasca hart erkämpfen, immer wieder kreuzen schwer bewaffnete Händlerschiffe ihre Route. Während Cliff mit Yphemi alles versucht, um die zunehmend aufgebrachten Wasserwesen zu besänftigen, rinnt Viverrin und Skye die Zeit davon. Werden sie die Blutfestung rechtzeitig vor der großen Katastrophe erreichen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Planspiel Beta-Atlantis: Die Blutfestung
Vorschau Band 4
Glossar
Die Autorin
Danke!
Titel
Hedy Loewe
Planspiel Beta-Atlantis
Die Blutfestung
HL UTOPIA EDITION
Impressum
©2021 Hedy Loewe
Erste Ausgabe, November 2021
Herausgeber: HL UTOPIA EDITION, Sabine Schöberl, Veilchenstr. 4, 90587 Veitsbronn
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung, wozu auch die Verbreitung über „Tauschbörsen“ zählt..
Covergestaltung: Magicalcover.de / Giusy Ame Bildquelle: Depositphoto
Lektorat: Marion Voigt, folio-lektorat.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.hedy-loewe.de
Kontakt:
.
Planspiel Beta-Atlantis: Die Blutfestung
Ambiela
Was war das für eine irre Reise! Ambielas Nerven standen immer noch unter Strom. Egal, welches Mittel ihr Shaka da in ihrem Haus in Numinala eingeflößt hatte: Es hatte nicht nur ihre Zunge in Nullkommanichts betäubt, sondern auch den Rest ihres Körpers. Sie erinnerte sich, dass sie umgefallen war und Shaka sie aufgefangen hatte. Danach legten sich Schleier über ihr Erinnerungs- und vor allem über ihr Sehvermögen. Hab ich das nur geträumt, dass ich die ganze Zeit unter Wasser war? Weshalb bin ich nicht ertrunken? Sie wollte sich umsehen, konnte sich aber nicht bewegen. Das machte ihr Angst, ihr Herz begann zu rasen. Ihr Körper fühlte sich feucht und kalt an, Ambiela fror und zitterte. Das bisschen Wäsche an ihrem Leib war nass, auch ihre Haare klebten klatschnass um ihren Kopf. Jemand breitete eine Decke über sie.
Shaka!, wollte sie rufen, doch sie brachte kein Wort heraus. Sah er etwa besorgt aus? Es waren auch andere Männer seiner Art im Raum.
»Es war doch etwas lang«, hörte sie einen sagen.
»Sie wird sich erholen. Gib mir noch eine Decke.« Das war Shaka. Er sagte es sicher und bestimmt. Ambiela war sofort beruhigt. Dann war es also geglückt. Der Transport auf die Insel Albatrasca, den er ihr versprochen hatte, war gelungen.
Shaka kam wieder in ihr Gesichtsfeld. Sie sah seinen Blick nachdenklich auf sich ruhen.
»Deine Augen haben sich verändert«, stellte er fest. Dann befahl er jemandem: »Hol eine deiner Schwestern. Sie braucht Unterstützung. Wir können sie nicht allein lassen.«
Ambiela wollte protestieren, doch sie konnte keinen Finger rühren. Fast zärtlich strich ihr Shaka die Haare aus der Stirn.
»Du bist jetzt in Albatrasca. Schlaf und ruh dich aus. Jemand wird kommen und dir helfen. Sag ihr, wenn du etwas brauchst. Ich werde in ein paar Tagen wieder nach dir sehen.«
Er wandte sich ab, und Ambiela wollte nach seiner Hand greifen. Doch ihr Arm zuckte nur. Es wurde still und dunkel im Zimmer. Sie war sich zunächst nicht sicher, ob jemand nur das Licht ausgemacht hatte oder ob sie träumte. Definitiv war sie allein. Ihr erschöpfter Körper forderte nach der Anstrengung der letzten Stunden – oder waren es Tage gewesen? – seinen Tribut. Endlich schlief sie ein und träumte von einer fantastischen, bunten und vielfältigen Unterwasserwelt mit Wesen, die sie sich in ihrer kühnsten Fantasie nicht hätte ausdenken können.
Ambiela schlug die Augen auf. Es war taghell im Raum, sie fühlte sich gut. Vor ihr an einem Tisch saß eine massige Ichtyofrau.
»Was tust du hier? Ich brauche keine Aufpasserin in meinem Schlafzimmer.« Schwungvoll schlug Ambiela die Decken zurück und wollte aufstehen. Die dicke Frau stand schneller auf, als Ambiela der Masse zugetraut hätte, und drückte sie zurück auf das Bett.
»Wann du aufstehst, entscheide ich. Ich bin Engabkema. Shaka hat mir befohlen, mich um dich zu kümmern. Er hat mir schon angekündigt, dass du etwas eigenwillig bist. Tu, was ich sage. Ich will mit Shaka keinen Ärger.«
»Wie redest du mit mir? Du nennst mich gefälligst Lady Ambiela. Ich werde dich Engma nennen. Was für ein komischer Name.«
Die Frau verzog säuerlich ihr Gesicht und starrte missmutig auf sie herunter. »Und ich werde dich ignorieren, wenn du mich nicht anständig behandelst. Du bist hier fremd. Du brauchst mich. Dein Transport hat länger gedauert, als gut für dich war. Also bleib liegen und ruh dich aus. Sonst wird es nichts mit deinem Tatendrang. Mir ist da so einiges zu Ohren gekommen. Scheinst ja ein ziemlich raffiniertes Weib zu sein, wenn du sogar Shaka um den Finger wickeln konntest. Bei mir wird dir das nicht gelingen. Verlass dich drauf.«
Mit wenigen kraftvollen Handgriffen hatte Engma die feuchten Decken fortgezogen und neue, trockene so eng um Ambiela herumgestopft, dass sie sich nicht mehr rühren konnte. Ambiela zeterte und beschimpfte die Ichtyo mit allem, was ihr einfiel. Was Engma nicht weiter zu stören schien. Diese tauchte ihren Zeigefinger in ein Schälchen und strich ihr etwas auf die Unterlippe. Sofort verlor sie das Bewusstsein.
Als Ambiela erwachte, war sie allein. »Hey, ich muss aufstehen! Ich muss mal. Es ist dringend!« Noch immer fühlte sie sich unter dem Berg aus Decken gefangen. Die Tür ging auf und Engma trat ein.
»Wirst du dich benehmen, wie es sich für eine Frau in deinem Alter gehört?«
Ambiela dachte, sie höre nicht richtig. »Ich bin nicht alt!«, keifte sie zurück. »Ich muss mal. Also lass mich aufstehen. Oder willst du meine Exkremente aufwischen?«
Die Ichtyo grinste unverschämt. »Ich werde vielleicht außerhalb dieses Hauses deine Dienerin spielen, weil Shaka es mir befohlen hat. Hier drin aber«, sie machte eine ausholende Handbewegung, »da kannst du deinen Dreck gern selber wegmachen.«
Trotz dieser Frechheit war Ambiela froh, dass die dicke Frau auf sie zukam und die Decken unter ihr lockerte.
»Wo ist das Badezimmer?«
Engma deutete auf eine schmale Tür.
Ambiela kochte, als sie auf der gruseligen Holztoilette saß, die nicht mehr war als ein Brett mit einem Loch, unter ihr das Meerwasser, und sich endlich erleichterte. Shaka kann was erleben. Was erlaubt er sich, mir eine so impertinente Person zu schicken. Und mich in so einen Verschlag zu stecken. Dieses Haus ist ja nur eine Fischerhütte. Sie sah sich um. Das Badezimmer war viel einfacher als das in Numinala. Ein kleiner Sack lag neben einigen Lumpen. Sollen das Handtücher sein? Ambiela starrte in einen fleckigen Spiegel. Wer zum Teufel ist das? Ihr entfuhr ein grässlicher Schrei, als sie sich selbst erkannte. Die Tür sprang auf und Engma stand im Türrahmen, bewaffnet mit einer Bratpfanne.
»Was ist passiert?«
»Meine Haare sind eine Katastrophe!«
Während Ambiela sich ihre verknoteten Haarsträhnen raufte, zog Engma ihr Gesicht in verdrießliche Falten.
»Und deshalb schreist du hier so rum? Ich dachte schon, die wollten dich abholen.«
Ambielas Verstand schaltete. »Wer?«
»Was glaubst du, warum ich hier bin? Du hast Feinde. Also hör auf, hier herumzubrüllen. Benimm dich und gehorche, damit ich auch auf dich aufpassen kann.«
»Mit der Bratpfanne?« Ambiela deutete auf den immer noch erhobenen Arm Engmas und lachte schrill.
Diese knallte die Pfanne mit voller Wucht gegen den Türrahmen, dass das Holz knackte. Sofort war Ambiela still.
»Egal, womit«, antwortete sie grollend, »ich werde Shakas Auftrag erfüllen.«
Sie schüttete den Inhalt des Säckchens auf einen kleinen Tisch. Ambiela sah ihre Haarbürsten und Kämme.
»Und jetzt kümmere dich, um was du willst. Ich bin nicht dein Dienstmädchen. Du darfst die Hütte vorläufig nicht verlassen. Wenn du was brauchst, sag es.«
Damit knallte die dicke Ichtyo die Tür zum Badezimmer von außen wieder zu, dass es nur so rumste.
Ambiela brauchte mehrere Stunden, um ihr Haar einigermaßen in Ordnung zu bringen. Es hätte nicht viel gefehlt, und ihre langen Locken wären einer Schere zum Opfer gefallen. Doch die Fummelei hatte auch etwas Gutes. Ambiela brauchte diese Zeit, um Ordnung in ihre Gedanken zu bekommen und einen Plan zu entwickeln. Sie würde sich weder von diesem rabiaten Ichtyoweib noch von Shaka einsperren lassen. Außerdem hatte sie festgestellt, dass sie bei der Unterwasserreise ihre blauen Augenlinsen verloren hatte. Die tiefschwarzen Augen der Thon-Rhe starrten ihr aus dem Spiegel entgegen. Macht nichts, beschloss sie für sich. Ich werde es Shaka schon irgendwie erklären. Und hier kennt mich ja sowieso keiner. Systematisch untersuchte sie im Anschluss an die Frisieraktion das Haus. Im Grunde war es eine bessere Hundehütte, kleiner und weit weniger komfortabel als ihr Haus in Numinala. Aber einige ihrer Kleider waren immerhin da, wenn auch tropfnass und leider durch das Salzwasser größtenteils verdorben.
Engma saß in einem kleinen Vorzimmer neben der Haustür und starrte aus dem Fenster.
»Wo ist meine Geldkiste?«, fragte Ambiela mit in die Taille gestützten Händen. »Ihr habt sie hoffentlich auch mitgebracht. Wenn du schon nur hier herumsitzen willst, dann beschaff mir eine Bedienstete. Meine Kleider brauchen Pflege. Hier muss jemand saubermachen. Ich will, dass mir jemand zur Hand geht.«
»Ich werde Shaka fragen, wenn er wieder hier ist«, antwortete das Weib mürrisch und rührte sich nicht von der Stelle.
Ambiela begann schon wieder zu köcheln. Draußen schien die Sonne. »Ich weiß ja nicht, ob ihr eure Klamotten irgendwie pflegt«, spuckte sie giftig aus. »Meine jedenfalls brauchen Trockenheit. Ich werde sie draußen aufhängen. Ob dir das passt oder nicht.«
Mit dem Arm voller Kleider ging sie an Engma vorbei und wollte die Tür öffnen. Sie war verschlossen. Engma hob ihre Masse langsam aus dem Stuhl. Ambiela war groß, doch die Ichtyo überragte sie um einen halben Kopf. Und war auch noch zweimal so breit. Finster schnappte sie nach Ambielas Kleidern und schubste sie zurück.
»Du gehst hier erst raus, wenn Shaka es erlaubt.«
Ambiela konnte nicht erkennen, wie sie das anstellte, aber bei ihr sprang die Tür auf. Die Ichtyo ging mit den Kleidern hinaus. Neugierig spähte Ambiela durch eines der winzigen Fenster hinterher. Draußen sprach die Ichtyo mit einem Mann ihrer Art. Schlecht gelaunt kehrte sie kurze Zeit später zurück und knallte die Tür ins Schloss. Na, das kann ja heiter werden, dachte Ambiela. Sie fuhr fort, das Haus zu untersuchten und über ihre Pläne nachzudenken.
Am Abend saß Engma immer noch vor der Tür, einen Hinterausgang hatte das Haus nicht.
»Hast du keinen Hunger?« Ambiela hatte beschlossen, anders vorzugehen. Sie hielt der Ichtyo eine Frucht hin, die sie in der Küche gefunden hatte. Sie selbst biss herzhaft in eine davon hinein. Roter Saft tropfte heraus.
Ein Kopfschütteln war die Antwort.
»Du bist nicht gerade zufrieden, für mich die Aufpasserin zu spielen«, stellte sie fest.
Engma beobachtete sie aus zusammengekniffenen Augen.
»Ich kann mir was Besseres vorstellen.«
»Hör mal, ich weiß nicht, was Shaka dir erzählt hat. Ich werde ihm nicht abhauen. Ich wüsste ja gar nicht, wohin. Ich habe ihn gebeten, mich hierher zu bringen, weil ich etwas Wichtiges erledigen will. Und er wollte mir dabei helfen. Also warum muss ich im Haus bleiben?«
Engma runzelte die Stirn. »Ich habe nicht zu hinterfragen, was Shaka befiehlt. Mach das mit ihm selber aus. Er wird schon wiederkommen.«
»Wann denn?« Ambiela versuchte, locker zu plaudern. Am liebsten wäre sie wieder laut geworden und hätte gebrüllt: »Wenn ich hier drei Tage eingesperrt verbringe, dreh ich durch!« Doch sie schaffte es diesmal, sich zu beherrschen.
Die Ichtyo zuckte mit den Schultern. »Vielleicht morgen Abend. Vielleicht auch später. Es soll dich keiner sehen. Noch nicht. Er hat irgendwas geplant.«
»Was denn?« Natürlich war Ambiela jetzt gespannt.
Doch die Antwort war wieder nur ein Schulterzucken. Wütend drehte Ambiela sich um und ging zu Bett.
Am nächsten Morgen – sie hatte wider Erwarten gut und lange geschlafen – textete sie Engma zu. Erzählte ihr die Geschichte der armen Waise, die sie auch Shaka vorgelogen hatte. Und schilderte ihre Widersacherin Juniya in den erdenklich schlechtesten Farben. Und was Ambiela erhoffte, trat ein. Engma war empfänglich für Klatsch und Tratsch. Und davon konnte ihr Ambiela jede Menge liefern. Immer wieder ließ sie in ihre Erzählungen einfließen, wie einfach die Welt für alle wäre, wäre Juniya endlich tot.
Und irgendwann nickte Engma und sagte, sie hätte da eine Idee. Nur welche, verriet sie nicht. Eine Weile gab Ambiela Ruhe, doch lange hielt sie es nicht aus und durchsuchte die Hütte.
»Was suchst du da?«
»Meine schwarzen Sachen für die Nacht.«
»Wozu? Du kommst hier nicht raus.«
Ambiela fand das schwarze Kopftuch und zog es aus dem Kleiderstapel. Natürlich hatte sich noch niemand gefunden, der hier aufräumte.
»Ich will spazieren gehen. Es ist dunkel, kein Mensch wird mich sehen. Ich werd verrückt hier drinnen.«
Engma stellte sich demonstrativ vor die Tür und verschränkte die Arme.
»Geh doch mit und pass unterwegs auf mich auf. Ich will den Ort kennenlernen.«
Ambiela hatte beschlossen, so spontan und aufrichtig zu Engma zu sein, wie es für ihre Zwecke erforderlich war. Die Ichtyo war schon viel zugänglicher geworden. Heute Nachmittag hatten sie sogar gemeinsam gelacht. Endlich hatte sie auch die dunkle Hose gefunden und zog sie an.
»Siehst du? Kein Mensch wird mich erkennen.«
War das eine Art zustimmendes Grunzen? Engma spähte durch ein Fenster nach draußen. Sie öffnete die Tür einen Spalt.
»Wenn du mir abhaust, werden wir dich finden. Und das, was Shaka dann mit mir macht, werde ich danach mit dir machen.«
Ambiela lachte hell auf. »Keine Sorge. Ich kenne mich hier doch überhaupt nicht aus. Ohne dich wäre ich verloren. Und ich bestehe drauf, dass sich Shaka zuerst mich vornimmt, bevor er sich um irgendwen sonst kümmert.«
Das Lachen der Ichtyo war eher ein tiefes Gluckern. Auf jeden Fall hatte sie Spaß an Ambielas Antwort und öffnete die Tür.
Albatrasca war für Ambiela eine Enttäuschung. Vielleicht lag es nur an der Mitternachtsstunde. Es war stockdunkel in den Gassen, nur hier und da brannte eine Fackel, alles schien wie ausgestorben.
»Du liebe Zeit, ist das stinklangweilig hier«, rutschte Ambiela heraus.
»Tagsüber gar nicht«, meinte Engma. »Das Hafenviertel ist einen Besuch wert. Da verwandeln sich diese ganzen Hütten in hübsche bunte Läden. Es ist schon erstaunlich, was ihr Menschenvolk alles hierhergebracht habt und zum Leben braucht.«
»Und ihr? Mögen Ichtyofrauen keine schönen Dinge?«
»Ich spreche nicht für die anderen, nur für mich. Der meiste Kram ist nicht überlebenswichtig. Zeitverschwendung, sich damit abzugeben.«
»Womit gebt ihr euch denn ab?«
»Mit der Erhaltung unserer Art«, meinte Engma ernst.
Ambiela kicherte. »Ihr habt ja auch ordentlich potente Kerle.«
Engma prustete wie ein Walross, verschluckte sich dabei, lachte und hustete, bis ihr die Tränen übers Gesicht liefen. »So hab ich das nicht gemeint. Denkst du eigentlich an nichts anderes?«
Doch. Tag und Nacht. Aber Ambiela antwortete nur: »Man muss sich auch mal ein bisschen Spaß gönnen.«
Sie waren am Kai angekommen. Heute lag kein einziges Schiff im Hafen.
»Hier ist wirklich nichts los. Es war wohl eine bescheuerte Idee, Shaka zu bitten, mich hierherzubringen.«
»Es ist eigentlich selten, dass kein Schiff hier ist. Manchmal liegen zwei hier am Kai, und andere ankern draußen in der Bucht und warten darauf, entladen zu werden. Da hinten«, sie zeigte auf die andere Seite des Kais, »stehen große Lagerbaracken. Hier kommen alle Waren des Roten Vadim an und er verteilt sie auf die anderen Inseln. Du wirst es schon noch bei Tageslicht sehen.«
Die Ichtyo ging auf das Ende der Kaimauer zu und klapperte irgendwas in dieser abscheulich klingenden Sprache. Ein Wesen, das im Dunklen ausgesehen hatte wie ein großer Stein, erhob sich und plumpste mit einem Gurgeln ins Wasser.
Engma kam zurück. »Bald wird die Feuervogel mit dem Roten Vadim hier eintreffen«, erzählte sie daraufhin im Plauderton. »Deine Feindin wird er auch mitbringen. Es kann nicht mehr lange dauern.«
Ambiela war nicht nur wegen dieser Nachricht wie elektrisiert. »Hast du mit diesem Ding da gesprochen?« Sie wies auf die Stelle am Wasser.
Engma zog beleidigt die dicken Augenbrauen nach oben. »Dieses Ding da ist ein Wesen meiner Welt. Sei nicht so respektlos. Und jetzt komm. Wir müssen zurück.«
Als sie sich umdrehten, wuchsen wie aus dem Nichts sechs dunkle Gestalten aus dem Boden.
»Shaka!«
Ambiela wollte sich ihm an den Hals werfen, doch er fing sie ab und stieß sie zurück, beachtete sie gar nicht, sondern schimpfte auf Engma ein. Ambiela registrierte, wie stolz die Ichtyo auf Shakas Angriff reagierte. Trotzig hob Engma den Kopf und ließ Shakas Tirade über sich ergehen. Keinen Millimeter senkte sie ihr Haupt.
»Ich nehme alle Schuld auf mich«, schritt Ambiela ein. »Sie kann nichts dafür. Du darfst sie nicht bestrafen.«
Erst jetzt schien Shaka sie wahrzunehmen.
»Sag mir nicht, was ich darf und was nicht«, zischte er sie an. Dann bellte er einen Befehl an die Ichtyos, die ihn begleiteten. Engma verschwand lautlos mit ihnen. Shakas Hand spannte sich wie ein Schraubstock um Ambielas Oberarm. Sie sah, wie sich eine seiner kupferroten Haarsträhnen aus der geflochtenen Kappe löste und wusste, wie er drauf war.
»Und du, Weib ohne Gehorsam, wirst deine Strafe sofort erhalten«, zischte er.
Brutal zerrte Shaka Ambiela den Kai entlang bis zu einem Durchgang zwischen zwei Holzbaracken. Er stieß sie hinein, dass sie auf Händen und Knien im Staub landete. Anstatt sich zu beschweren, beugte sie demütig ihren Kopf zur Erde und hob ihm damit unmissverständlich ihr Hinterteil entgegen. Sie wusste, was folgen würde. Und erzitterte vor lustvoller Erwartung.
Juniya
Juniya stand unglücklich am Bug der Feuervogel und blickte mit dem neuen Ufer auch einer neuen Situation entgegen, bedrohlicher als alle anderen zuvor. Sie beneidete den Wind um seine unendliche Freiheit, ließ sich von ihm die Haare zerzausen und wollte zusehen, wie das Schiff am Kai von Albatrasca anlegte. Schon von Weitem war geschäftiges Treiben auszumachen. Die Stadt schien wie verwandelt. Juniya erinnerte sich mit Grauen daran, wie sie vor ein paar Wochen aus der Festung geflohen und mit letzter Kraft in Richtung Hafen gelaufen war. In der Mittagshitze hatte bei ihrer Flucht alles wie ausgestorben gewirkt. Heute, es war später Nachmittag, herrschte in der Stadt ein quirliges Leben.
Was für ein Glück, dass Skye sie damals gefunden hatte. Wo er wohl jetzt war? Juniya zermarterte sich den Kopf, wie sie ihn erreichen konnte. Ob sie an Land versuchen sollte, Tkitamea zu finden? Vielleicht konnten sie Viverrin benachrichtigen. Und über ihn Skye? Aber wie nur, denn die Zwillingsmatrosen ließen Juniya nicht mal an Deck eine Sekunde aus den Augen und würden ihr sicher auch an Land auf Schritt und Tritt folgen.
»Juniya, kommst du bitte?«
Kemal stand auf einmal hinter ihr. Immerhin war er hier an Bord die einzige freundliche Seele. Auch wenn Juniya sicher war, dass seine ganze Loyalität dem Roten Vadim galt, warum auch immer. Trauen konnte sie Kemal jedenfalls nicht, und helfen würde er ihr garantiert auch nicht. Jedenfalls nicht, zu fliehen. Enttäuscht wendete sie den sehnsuchtsvollen Blick von der nahen Küste ab und folgte ihm unter Deck, denn seine nette Bitte war nichts anderes als ein Befehl des Roten Vadim. Geschäftig arrangierte Kemal schon seit gestern Abend alles für ihre Ankunft in der Stadt, und er war aufgeregt, als stünde gleich ein Staatsakt bevor. Natürlich war der Rote Vadim der Mittelpunkt seiner Anstrengungen, aber auch Juniya hatte eine feste Rolle in diesem absurden Theater. Wie eine künftige Königin wollte Vadim sie präsentiert haben, und Kemal hatte seine Freude daran, Vadims Wünsche zu erfüllen. Juniya war dieses Getue um ihre Person peinlich. Besonders, weil sie sich bald entscheiden musste. Doch ihr Protest nutzte nichts. Vadims Drohungen klangen ihr noch in den Ohren. Kooperierte sie nicht, würden einfach andere – angefangen mit Clodia – für ihre Missachtung seiner Befehle bezahlen. Und auch wenn Clodia in der kurzen Liste von Juniyas Freunden gar nicht erst auftauchte, wollte Juniya nicht, dass irgendjemandem ihretwegen etwas zuleide getan wurde. Also betrat sie hinter Kemal ihre Kajüte und erschrak. Alles war weggeräumt. Und damit auch das bunte Kissen, in dem sie die Ichtyokleider versteckt hatte, die sie unbedingt hatte behalten wollen.
»Wo sind denn die ganzen Sachen hingekommen?«, fragte sie und versuchte, die Panik in ihrer Stimme in den Griff zu bekommen. Sie atmete erleichtert auf, weil Kemal antwortete: »Wird alles in deine Räume in der Festung gebracht. Du wirst schon sehen, es wird dir dort gefallen.« Juniya ließ es zu, dass Kemal ihr schlichtes Lieblingskleid wegräumte, und sie zog das prächtige Gewand an, das er ihr bereitlegte. Die Grundfarbe war fliederfarben mit kostbaren silberfarbenen Stickereien. Wunderschön waren diese Stoffe, und es war nicht so, dass sie Juniya nicht gefielen. Die Umstände waren es, die das alles hier zu einer schrecklichen Farce machten. Noch drei Tage hatte sie Zeit, dem Roten Vadim mitzuteilen, ob sie ihn heiraten würde. Natürlich war diese Vorstellung absolut undenkbar. Doch das hieß auch, dass sie in spätestens drei Tagen geflohen sein musste, denn sonst würde sie sterben. Vadim sprach eine Drohung nicht grundlos aus. Juniya nahm sich vor, sich so gut es ging zu verstellen und sich ihm gegenüber freundlich zu zeigen. Aber mit ihrem ersten Schritt auf festem Boden würde sie über die Flucht nachdenken. Es klopfte an der Kajütentür.
»Einen winzigen Moment«, rief Kemal und steckte mit der letzten Nadel Juniyas Frisur fest.
Als würde Vadim warten. Natürlich trat er ein. Seine eigenen kostbaren Kleider waren auf Juniyas Stoffe abgestimmt. Ihr heller Fliederton passte sehr gut zur dunklen Brombeerfarbe seines ebenfalls silberdurchwirkten Brokatrocks. Die dunkle Hose endete unter den Knien, die Beine steckten in makellos weißen Strümpfen, die Füße in eleganten Schuhen mit silbernen Schnallen.
Instinktiv lächelte Juniya.
»Meine Königin schenkt mir ein Lächeln. Du überraschst mich immer wieder. Womit habe ich das verdient?« Vadim deutete mit einem Nicken eine Verneigung an.
»Ich sehe einen Mann in Strümpfen, und anstatt es eigentümlich zu finden, halte ich deine Erscheinung für durch und durch elegant.«
Etwas ging offenbar in Vadim vor. Voller Erstaunen schaute er sie an, musterte sie, als würde er Juniya zum ersten Mal sehen.
Hinter ihm maulte eine Stimme: »Du liebe Zeit, Juniya, du versuchst dich doch wohl nicht im Arschkriechen?«
Patsch! So schnell konnte sich Clodia gar nicht ducken, wie Vadims Pranke auf ihrer Wange landete. Sie torkelte an die Wand und hob abwehrend die Hand. »Schon gut, Verzeihung«, murmelte sie und hielt tatsächlich die Klappe.
Vadims Aufmerksamkeit galt wieder Juniya. »Diesmal warst du schneller mit den Komplimenten. Du würdest es ermüdend finden, wenn ich mich dir gegenüber wiederhole. Ich mache es wieder gut.« Er lächelte sie auf eine eigenartige Weise an, fast schüchtern, und bot ihr den Arm. »Komm. Ich zeige dir dein neues Zuhause.«
Der Rote Vadim plauderte mit Juniya, als wäre nie etwas Unangenehmes zwischen ihnen geschehen. Während das Schiff festmachte und sich der Kai mit neugierigen Menschen füllte, erklärte er ihr die Hafenanlage und die Grundidee der Stadt.
»Irgendwann wird es hinter dem Kai eine breite Strandpromenade geben. Gleich im Anschluss befinden sich schöne, stilvolle Wohnanlagen, alle mit Zugang zum Strand. Im Hinterland der Insel werden wir mithilfe der Ichtyos Früchte und Getreide anbauen und eine Versorgung mit Fleisch sicherstellen. Die Meere sind reich an Fisch. Du wirst für Kultur sorgen. Wir müssen Schulen bauen, denn irgendwann wird sich Nachwuchs einstellen. Handwerk und Kunsthandwerk werden sich ansiedeln. Wir werden alles haben, was wir zum Leben brauchen.«
»Glaubst du denn ernsthaft, die Rollenspieler werden sich langfristig hier niederlassen?«
Sie folgte ihm das Fallreep hinunter, Kemal wieselte beflissen hinterher und arrangierte ihren langen Rock.
Vadim wehrte einen aufdringlichen Gaukler ab, indem er ein paar Münzen in den Staub warf. Es gab genug Menschen am Weg, die sich gierig danach bückten. »Siehst du das?« Er deutete auf die Menschen im Staub, die sich für die Münzen auch noch vor ihm verneigten. »Sie werden es hier als meine Untertanen besser haben und sicherer leben als in jeder der bekannten Welten. Wer mir gehorcht und seiner Aufgabe gerecht wird, braucht sich um seinen Lebensunterhalt keine Sorgen zu machen.«
»Wenn es denn gerecht zugeht und nicht willkürlich.«
»Was ist denn gerecht, meine Liebe?«
Juniya wunderte sich, dass er aufgrund ihres Widerspruchs gar nicht wütend wurde, wie es bisher jedes Mal der Fall gewesen war. Wie ein Lehrer zu einem unmündigen Kind dozierte er weiter. »Keines der Rechtssysteme der ach so freien Welt hat dauerhaft funktioniert. Alle Systeme sind untergegangen, früher oder später. Auch das jetzige System ist durch und durch korrupt. Oder warum glaubst du, ist Sylvius Beard hier?«
»Wer ist das?«
Vadim stutzte. »Du kennst den ersten Minister der Föderation nicht? Den obersten Befehlshaber aller exoterrestrischen menschlichen Verteidigungseinheiten?«
Juniya schüttelte den Kopf. »Ich komme aus Ambions Welt, dort war ich die letzten fast zwanzig Jahre.«
»Ambions Welt.« Nachdenklich strich sich Vadim über den gepflegten Bart. »Heute Abend musst du mir mehr über ihn erzählen. Aber nun schau sie dir an!« Er wies auf die Leute, die angelaufen kamen, um ihn – und damit auch sie – zu sehen. Viele freuten sich wie Kinder und klatschten. »Die Menschen sind im Grunde einfach gestrickt. Sie wollen Sicherheit. Und brauchen feste Regeln. Beides sollen sie hier bekommen.«
»Können sie auch wieder weg, wenn sie herausfinden, dass dieses Lebensmodell für sie nicht taugt?«
Sein Auge zuckte verdächtig.
Juniya, du bewegst dich nahe an seinem nächsten Wutausbruch.
»Oh!« Sie ging ein paar Schritte auf einen Tkitamea zu, der an einem hölzernen Gestell Stoffe aufhängte, und fuhr mit der Hand darüber. »Schau, wie schön sie sind. Über ein Gewand mit solchen Farben würde ich mich freuen. Die Stoffe der Tkitamea sind überaus haltbar, hat mir einer von ihnen einmal erzählt. Er hieß Viverrin.« Sie hatte es nicht nur geschafft, Vadim abzulenken, sondern auch die Aufmerksamkeit des Tkitamea auf sich gelenkt. Der verbeugte sich zuerst Vadim gegenüber – sehr geschickt, registrierte Juniya – und machte dann vor ihr eine formvollendete Verbeugung.
»Madame Juniya, du bist noch schöner, als es in den Erzählungen der Tkitamea ohnehin schon heißt. Es wäre mir eine Ehre, wenn du dir eines meiner Muster aussuchen würdest. Vielleicht das mit den Delfinen? Es würde Viverrin auch gefallen.«
Er kennt Viverrin! Juniya versuchte, ihre Freude über diesen kleinen Hinweis des Tkitamea vor Vadim zu verbergen, sie beugte sich über den meergrünen Stoff, auf dem sich zierliche Delfine tummelten.
»Wunderschön«, flüsterte sie. »Man könnte meinen, sie bewegen sich. Ich wünschte, ich würde den Delfin einmal wiedersehen.« Der Alte sah sie ernst an. Dann zwinkerte er ihr zu. Ja, Juniya hatte die kleine Geste bemerkt. Vielleicht konnte der Tkitamea Viverrin eine Nachricht zukommen lassen.
»Kemal«, rief Vadim, sichtlich erfreut über ihr Interesse an schönen Dingen, »such für unsere zukünftige Königin etwas Passendes aus.« Und als Juniya ihm ein ihrer Meinung nach dankbares Lächeln schenkte, fügte er an: »Und bezahle den Ichtyo angemessen.«
Viverrin
In Viverrins dunkle Träume mischte sich immer wieder eine helle, unbekannte Stimme. Er wusste nicht, ob er wach war oder träumte. Seine Augen konnten nicht sehen. Seine Ohren hörten wie durch einen Nebel. Er nahm Wärme wahr, eine wohlige Wärme, die ihm guttat, obwohl Wesen seiner Art im kalten Wasser zu Hause waren. Sein Bewusstsein schärfte sich langsam, Viverrin versuchte, die Augen zu öffnen, doch das ging nicht. Ein Verband? Er wollte mit der Hand danach tasten, konnte aber keinen Finger rühren. Ich bin fixiert, wurde ihm klar. So schlecht, wie ich mich fühle, wird das seinen Sinn haben. Er döste wieder ein. In den wacheren Momenten strengte er sich an, sich zu erinnern, was passiert war. Der Abschied von Vater! Der Gedanke an Vivandro schmerzte mehr als seine Austauschmembran. Nach gefühlt endlosen Stunden hörte er endlich eine ihm vertraute Stimme. Manateka! Er wollte sie rufen, doch das ging nicht, seine Stimme versagte, er hatte keine Kraft, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Resigniert lag er still und lauschte auf ihre Worte.
»Seine Austauschmembran ist überdehnt. Die stundenlange Anstrengung hat seinen inneren Organen zu viel Wasser entzogen. Es ist ein Wunder, dass er noch lebt. Sein Körper funktioniert nur noch auf Sparflamme. Wenn er überlebt, wird er wahrscheinlich blind sein, und auch sonst werden wohl Schäden bleiben. Du wirst dich gedulden müssen, Shaka. So jedenfalls wirst du ihn nicht mitnehmen. Und wenn du irgendetwas tust, was ihm in diesem Zustand schadet, dann kriegst du es mit mir zu tun! Genkor hat selbst gesehen, was mit ihm im großen Graben passiert ist. Ich verstehe nicht, warum du ihn abholen sollst«, hörte Viverrin seine Lehrerin und Mentorin schimpfen. Auch, wenn er sich ein wenig über Manatekas resolute Worte freute, griff doch eine kalte Hand nach seinem Herzen. Blind werden? Redet sie von mir? Sein bewegungsunfähiger Körper jagte ihm Angst ein, er hatte überall Schmerzen. Viverrin war selbst ein von Manateka ausgebildeter Helifa, sie sagte sowas nicht nur so dahin. Und er wusste, wovon sie redete. Er hatte das mit der Überanstrengung der Austauschmembran nur nicht ernst genommen. Jedenfalls nicht bei sich selbst. Anderen hätte er sicher geraten, ja, er hätte ihnen befohlen, mindestens alle sechs Stunden eine Pause einzulegen, damit das Herz sich beruhigen und die Membran sich dem Herzschlag wieder anpassen konnte. Das Gleichgewicht durfte nicht aus dem Takt kommen. Außerdem brauchten Tkitamea, die lange und weit reisten, regelmäßig Nahrung, um den Stoffwechsel in den großen Tiefen zu unterstützen. Nichts davon hatte Viverrin berücksichtigt. Er lauschte in sich hinein. So müde hatte er sich noch nie in seinem Leben gefühlt. Seine Austauschmembran brannte wie Feuer, seine Knochen taten ihm weh, und wenn er sich konzentrierte, meinte er, jedes einzelne Organ zu spüren. Beim Gedanken daran, sich zukünftig blind durch sein Leben zu tasten, hätte er seine eigene Dummheit am liebsten laut hinausgeschrien.
Endlich war die vertraute Stimme bei ihm. Manateka!
»Oh, bei den großen Ahnen, du bist bei Bewusstsein!« Sanft legte sie ihre Arme um ihn, und sofort wurde Viverrins Angst erträglicher.
»Lieg still, du bist in meinem Haus. Du darfst dich nicht bewegen und ruhst dich einfach aus. Sonst haben wir uns umsonst angestrengt, hörst du?«
Er spürte ihre Hand an seinem Gesicht, und ihre zuversichtliche Stimme beruhigte Viverrin schneller als jeder Heiltrank. Zu Tode erschöpft schlief er ein.
Als er das nächste Mal aufwachte, fühlte er sich etwas besser. »Manateka, wo bist du?«, flüsterte er durch seine rissigen Lippen. Der Verband auf den Augen war immer noch da. Jemand griff nach seiner Hand.
»Sie ist unterwegs. Sie kommt bald wieder.«
Viverrin konnte die junge Frauenstimme niemandem zuordnen, den er kannte. Er versuchte, sich aufzurichten, und wurde sofort niedergedrückt.
»Wir haben dich aus dem Fixierkokon herausgeholt. Bleib bloß ruhig liegen, hast du mich verstanden? Sie wird mich umbringen, wenn dir während ihrer Abwesenheit etwas passiert.«
Mehr als ein schwaches Nicken brachte Viverrin nicht zustande. Aber die Angst des Mädchens vor Manatekas Schelte und ihre resolute Art, das zum Ausdruck zu bringen, brachte sein Innerstes zum Lächeln. Etwas berührte sacht seine Lippen, er nahm den schwachen Geruch und den ungewöhnlich sauren Geschmack von vergorenen roten Seesternen mit Kräutern wahr. Dieses Heilmittel kannte er gut. Es war selten und kostbar, und es bedeutete bei vielen Erkrankungen den letzten Versuch, eine Heilung herbeizuführen. Außerdem erleichterte es Sterbenden ihren Weg durch das schwarze Tor. Nein, ich will nicht sterben, nahm sich Viverrin vor. Ich will leben und den Mörder meines Vaters finden.
»Entspann dich«, hörte er die junge Frau sagen. »Ich will dich noch nicht einbalsamieren. Manateka meint, du bist noch nicht über den Berg. Also bleib ganz ruhig liegen. Pass auf, ich drehe dich jetzt um.«
Mit geschickten Bewegungen drehte sie seinen Körper im Schlafkokon so, dass sie an seinen Rücken kam. Viverrin wusste, was jetzt folgen würde, und wappnete sich. Ihre Hände waren geschickt und vorsichtig, sodass der Wechsel der Kräuterauflage, die Manateka bestimmt auf seine Austauschmembran gelegt hatte, gar nicht so sehr schmerzte wie befürchtet. Trotzdem biss er sich auf die Lippen.
»Schon vorbei«, flüsterte sie. »Jetzt schlaf wieder.«
Sie machte ihre Sache gut. Noch bevor sie ihn sachte wieder in die Schlafposition gedreht hatte, taten die Kräuter auf dem Verband ihre Wirkung, und Viverrin fiel in einen tiefen Schlaf.
Einige Zeit später lag Viverrin wach in seinem Kokon. Die Schmerzen waren etwas erträglicher geworden. Irgendwo, gar nicht so weit weg, hantierte jemand mit Steingefäßen, Viverrin erkannte sie an dem tiefen Klang, der entstand, wenn sie aneinanderstießen.
»Landis, wie viel rote Heilalgen haben wir noch?«, hörte er Manateka fragen.
Landis heißt meine Pflegerin also. Er bekam mit, wie Manateka Landis wegschickte, um Nachschub für die Kräuterregale zu holen. Dann kam sie an seinen Schlafkokon.
»Guten Morgen! Wie fühlst du dich?«
Viverrin räusperte sich, seine Stimme wollte nicht recht gehorchen. »Besser.« Das Wort kam ihm schwer über die Lippen. Er spürte Manatekas liebevolle Umarmung.
»Ich bin so froh, dass du noch lebst. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht.«
»Was ist mit meinen Augen?«, fragte er mühsam.
»Es ist noch nicht die Zeit, um nachzusehen. Hab noch etwas Geduld. Du hast so ein Glück, dass sich dein Zustand überhaupt so schnell bessert. Wir dürfen das nicht verspielen und dir zu früh zu viel zumuten. Versprich mir, nur dieses eine Mal vernünftig zu sein.«
Viverrin schaffte ein Nicken. Sie befühlte seine Verbände. Er wusste, sein ganzer Körper war zur Unterstützung der Austauschmembran fest bandagiert. Eine weitere Frage brannte Viverrin auf den Lippen.
»Hat der Rat den Dolch?«
Manateka stoppte ihre Tätigkeit. »Welchen Dolch?«
»Der Admiral fand Vater mit einem Dolch der Kikrokka im Rücken. Wo ist er? Wem gehörte er?«
»Wovon redest du? Es war ein Messer der Menschen, das deinen Vater getötet hat.«
Viverrin glaubte, er hätte sich verhört. Er wollte sich aufrichten, doch Manateka drückte ihn zurück in den Kokon.
»Ich war bei Admiral Parker. Er hat Vater gefunden. Er hat mir den Dolch der Kikrokka beschrieben. Eindeutig. Woher sollte er die Waffe sonst kennen?« Das Reden strengte Viverrin sehr an, doch es wurde besser.
»Was? Seymo hat uns ein Messer der Menschen übergeben.«
Seymo. Einer von Shakas Offizieren. »Habt ihr die Einstichstelle nicht untersucht? Habt ihr nicht …«
Er spürte Manatekas Hand auf seinem Mund. »Sch. Reg dich nicht auf, bitte«, sagte sie so flehentlich, dass Viverrin versuchte, ihr zu gehorchen. »Tyrrab war es, der den Leichnam deines Vaters für das Zeremoniell freigegeben hat. Er wird gründlich gewesen sein.«
Ein Seufzer entfuhr Viverrin. »Sie wollen uns entzweien«, flüsterte er. »Sie machen Stimmung gegen die Menschen, um die große Entscheidung zu beeinflussen. Es war ein Dolch der Kikrokka, der Vater umgebracht hat.« Er fühlte etwas auf seinen Lippen. Mit dem sauren Geschmack der roten Seesterne auf der Zunge schlief er erschöpft ein.
Als Viverrin erneut wach wurde, konnte er nicht mit Manateka sprechen, sie war fort. Landis kümmerte sich die nächsten Tage um ihn, und sie machte das gut. Beim Wechseln der Verbände verursachte sie kaum Schmerzen. Ihre Handgriffe saßen an den richtigen Stellen. Sie wusste, wann er Ruhe brauchte und wann er in der Lage war, zu reden. Nach und nach lernte Viverrin sie besser kennen. Landis war ein paar Jahre jünger als er, hatte das Studium der Helifa noch nicht abgeschlossen. Sie kam aus Ilumia.
»Du hast dir dort einen guten Namen gemacht«, erzählte sie ihm. »Meine Mutter ist sehr stolz auf dich.«
»Wer ist deine Mutter?«
»Kalawyn. Du hast ihr den Arm gerettet. Ich habe die Verletzung gesehen. Ohne dich wäre sie bestimmt gestorben.«
Viverrin spürte eine heftige Umarmung und ein gehauchtes »Danke« an seinem Ohr, das ihn ganz verlegen machte. »Mutter war nur ein bisschen enttäuscht, dass du abgehauen bist, ohne dich bei ihr abzumelden.«
Viverrin wollte hochfahren. Sanft, aber entschieden drückte Landis ihn zurück in die Schlafposition.
»Ich wollte zu ihr«, protestierte Viverrin. »Aber die Wachen haben mich nicht reingelassen«, erklärte er ihr aufgebracht.
»Welche Wachen? Vor Mutters Residenz stehen nie Wachen.« Viverrin spürte direkt ihren fragenden Blick auf sich.
»Doch! Zwei Kikrokka haben mich in der Nacht weggescheucht. Und da es eilig war, bin ich mit Yphemi aufgebrochen.«
»Was ist denn passiert?«, fragte Landis interessiert.
»Das würde mich jetzt auch endlich mal interessieren.«
»Manateka!« Viverrin fühlte sich sehr erleichtert. Er würde seine Geschichte und seinen Verdacht erzählen. Manateka würde die Zusammenhänge verstehen.
Er redete sich die Vorkommnisse von der Seele. Wie er die von einem Kikrokka schwer verletzte Yphemi fortgebracht und dadurch und durch den feigen Anschlag auf ihn mit den Fischernetzen fast seine Anhörung verpasst hatte. Und was ihm der Admiral über den Tod seines Vaters erzählt hatte. »Immer wieder ist es Shaka. Es kann doch nicht allein an Kerralis Tod liegen, dass er mich und die Menschen so hasst«, schloss Viverrin seinen Bericht traurig ab.
»Du glaubst, dass Shaka hinter dem Mord an Vivandro steckt?«, fragte Manateka nach.
»Der Admiral beschrieb die Waffe ganz genau«, bestätigte Viverrin. »Sie ragte aus Vaters Austauschmembran und hatte ein dreieckig geformtes Heft aus Korallenkiesel. Er hat das schimmernde, mit kleinen Löchern durchbrochene Material ganz genau beschrieben. Sogar den eingravierten Dreizack am Ende hat der Mensch bemerkt. So verzierte Dolche werden nur den Hauptmännern verliehen. Fragt Shaka doch mal, wo seine Waffe ist.«
»Das ist eine schwere Anschuldigung«, sagte Manateka betrübt. »Es könnte ja auch einer der anderen Hauptmänner gewesen sein. Oder jemand hat Shaka den Dolch gestohlen.«
Viverrin stöhnte. »Der Admiral berichtete mir, dass er den Hafenmeister geholt hat, und das war Seymo. Der hatte bestimmt eine Gelegenheit, die Mordwaffe auszutauschen. Dann hat Shaka seinen Dolch längst zurück. Seine Offiziere stehen wie ein Mann hinter ihm. Es war ja auch einer seiner Leute, der Yphemi fast umgebracht hat.«
Ein aufgebrachtes Schnauben ließ Viverrin zusammenfahren. Manateka oder Landis waren das jedenfalls nicht. »Genkor!«
»Berichte noch einmal, was in Ilumia vorgefallen ist. Und sag mir, wo meine Tochter jetzt ist.«
Heiß fuhr der Schreck durch Viverrins Adern. Manateka hatte den großen Genkor mitgebracht, und dieser hatte die ganze Zeit mitgehört. Mein Leben ist verwirkt. Jetzt brauche ich nichts mehr zu verschweigen. Wenn er mir jetzt nicht glaubt, dann nie mehr. Viverrin berichtete von der Zeit, als Yphemi ihn in Ilumia bewachte. Er redete sich die Zweifel von der Seele, ob die Annäherung an die Menschen nicht falsch gelaufen war. Berichtete von Captain Skye und dem Admiral, und deren Anstrengungen, für Ordnung zu sorgen. Davon, dass sie herausgefunden hatten, dass das Sturmphänomen seinen Ausgangspunkt in Ethleticon haben musste. Und er sprach auch von Yphemis Erlebnissen. Nun ja, nicht von allen. »Yphemis Verletzung war allerdings ein Unfall. Ron wollte eigentlich mich töten. Yphemi ging dazwischen.«
Genkor schnaubte vernehmlich. Viverrin musste ihm in allen Einzelheiten von Yphemis Wunde erzählen und wie Viverrin diese behandelt hatte.
»Warum hast du sie nicht nach Hause gebracht?«, wütete er zornig. »Die besten Helifa stehen ihr zur Verfügung.«
»Weil sie nicht wollte. Ich wusste, sie würde nicht sterben. Und sie wollte zu ihrem Gefährten.«
»Zu Shaka?«
Viverrin schüttelte den Kopf und bezahlte die heftige Bewegung mit einem stechenden Kopfschmerz. »Nein. Zu einem Menschenmann. Er pflegte sie gesund.«
Jetzt war es doch heraus. Viverrin spürte, wie das Wasser um ihn herum wallte. Genkor schnaubte. Manateka griff ein.
»Genkor, du bist inkognito hier. Du wolltest dir ein Bild von der Lage machen, ohne die Einflüsterungen deiner Hofschranzen. Gerade erfährst du eine Wahrheit, die dir nicht in den Kram passt und die bei der derzeitigen Lage nicht nur Viverrin, sondern auch deine Tochter in große Gefahr bringt. Als Wächterin durfte sie sich nie mit den Menschen einlassen, außer um sie zu bewachen und auszuspionieren. Alles andere müssen wir Angehörige der Ratskommission als Verrat werten. Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, unsere Situation zu überdenken. Es wird einen Grund haben, dass sich deine Tochter von Shaka abwendet. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass Tyrrab mit Shaka und einem Teil der Kikrokka ein eigenes Spiel spielt. Du vermutest es doch auch, deshalb bist du mitgekommen. Wenn du dich den neuen Ideen nicht endlich öffnest, wirst du Viverrin und deine Tochter irgendwann zum Tod verurteilen müssen. Willst du das?«
Viverrin hasste es, dass er nicht sehen konnte, wie Genkor reagierte. An den Wasserbewegungen spürte er, dass es den ersten der Räte nicht auf einem Platz hielt.
»Wie geht es meiner Tochter jetzt, und wo ist sie?«, herrschte er Viverrin an.
»Sie ist wieder gesund, es geht ihr gut.«
»Und? Wo ist sie? Antworte!«
Die Gedanken rasten durch Viverrins Kopf. Wie schnell könnten die Sucher der Kikrokka Captain Skyes Schiff mit Yphemi, Captain Cliff und den anderen Freunden aufspüren? Und was würden die Kikrokka von Genkor mit ihnen tun? Viverrin entschloss sich zu einer folgenschweren Antwort.
»Ich werde nicht sagen, wo Yphemi ist. Ich bin sicher, sie wird sich melden.«
»Du wagst es …«
»Stopp! Du wirst ihn nicht anrühren, und keiner deiner Kikrokkasoldaten wird Viverrin auch nur ein Haar krümmen! Besinne dich, Genkor!«
Offenbar hatte Manateka einen tätlichen Angriff des großen Genkor auf ihn abgewendet. Viverrin hörte ihn wieder erbost schnauben und konnte sich gut vorstellen, wie dessen mächtiger Schnauzbart zitterte.
»Du widersetzt dich mir, Helifa. Das wirst du büßen.«
Viverrins Gehör war so weit wieder in Ordnung, dass er hörte, wie Genkor davonschwamm. Manateka neben ihm seufzte.
»Wohin soll das alles nur führen?« Sie drückte sanft seinen Arm. »Ich werde ihm nachschwimmen und sehen, was ich tun kann. Und du tust nichts Unüberlegtes, bis ich wieder da bin. Versprich es mir!«
Wie sollte er auch. Konnte er sich doch kaum bewegen, geschweige denn sehen.
Cliff
»Kurs voll und bei, Mr Jonessy!«, brüllte Cliff seinem ersten Offizier gegen den Wind zu und lachte aus vollem Hals. Die Gischt eines Brechers spritzte über die Reling auf sein Gesicht und die nackte Brust. Noch nie hatte er so viel Spaß am Segeln gehabt wie in den letzten Tagen auf der Viking. Die Fleute war ein schneller Dreimaster, hoch getakelt und wendig. Cliff hatte der neu zusammengewürfelten Mannschaft einiges abverlangt, unablässig segelexerziert und an den Kanonen geübt, doch die Männer machten begeistert mit, und viele hatten genauso viel Freude an Wasser, Wind und Wellen wie ihr blonder Captain, der mit seiner wilden Mähne und dem zu vielen Strähnchen gedrehten Bart immer mehr einem echten Wikinger glich. Einer seiner Männer meinte, nun fehle nur noch ein Wikingerhelm. Doch Tierhörner waren auf Beta-Atlantis nun mal nicht aufzutreiben. Cliff legte auf seinem neuen Schiff überall mit Hand an, stand am Ruder, enterte auf, um beim Segelsetzen zu helfen, saß stundenlang im Ausguck und wanderte durch das Schiff, um es kennenzulernen und seine Bewegungen zu studieren, damit bald jeder Handgriff saß, jede Rah richtig getrimmt und jedes Segel optimal angeschlagen war. Er bekam die Viking in den Griff und sein eigenes Leben gleich mit.
Die Viking machte gute Fahrt und war auf dem Weg nach Numinala. Endlich war Cliff bereit dazu, seinem Vater zu begegnen. Es war der richtige Zeitpunkt. Erstens musste sich Admiral Percy Parker persönlich davon überzeugen können, dass sein Sohn Cliff den feigen Mordanschlag des Roten Vadim überlebt hatte. Und zweitens wurde es Zeit, gegen den Händlerkönig und seine Bande von Dieben und Mördern vorzugehen. Cliff stand in der Abenddämmerung mit seinem Bootsmannsmaat am Steuer, als Yphemi zurückkehrte. Seine wunderschöne Tkitameafrau sprang geschickt über die Reling. Wieder wunderte sich Cliff, wie die Tkitamea bei voller Fahrt die glitschigen Bordwände hochklettern konnten. Yphemis silberne Haarsträhnen glitzerten in der Abendsonne. Sie eilte auf ihn zu und umarmte ihn, wie es auch menschliche Liebespaare taten.
»Übernimm das Steuer, Bootsmann!«
Cliff hob das zierliche Wesen auf und drückte sie an sich. Nach einem zärtlichen Begrüßungskuss setzte er sie sanft wieder ab.
»Und? Hast du ihn gefunden?«
Yphemis hellgrüne Augen leuchteten. »Natürlich. Es war nicht schwer, zu ihm zu kommen. Ich habe im Hafen einen deiner Männer von der Clara getroffen und gesehen, dass er immer wieder an Bord des Flaggschiffs ging. Ich soll dir Grüße von Pearly ausrichten, er ist jetzt auf dem Schiff deines Vaters. Er hat mir gezeigt, wie ich ungesehen zum Admiral komme, und mich auch angekündigt. Dein Vater ist sehr glücklich.« Sie strahlte Cliff an. Hand in Hand gingen die beiden auf das Achterdeck. Cliff brauchte sie gar nicht weiter aufzufordern, begeistert erzählte Yphemi von der Begegnung mit dem Admiral.
»Dein Vater ist ein sehr höflicher Mensch.« Sie trat einen Schritt zurück und musterte Cliff von dort. »Ihr seht euch gar nicht ähnlich!«
Cliff grinste. »Ja, das sagt er auch immer. Ich komme nach meiner Mutter. Er gibt auch zu, dass er bis heute nicht weiß, warum sich so eine schöne, gebildete Frau wie meine Mutter mit ihm abgegeben hat.«
»Ich kann es mir schon denken«, antwortete sie keck. »Er ist sehr gebildet. Aufmerksam. Offen für Vorschläge. Er behandelt alle Wesen gut. Man muss ihn einfach mögen, denn er hat ein gutes Herz.«
Diese überschwängliche Beschreibung versetzte Cliff einen kleinen Stich. Er selbst hatte in den letzten Jahren an seinem Vater kein gutes Haar gelassen. Ständig gab es Streit – wenn er ehrlich war, ging dieser immer von ihm aus, und nicht von seinem Vater – und Cliff konnte dessen verbindlicher, stets kompromissbereiter Art lange nicht viel abgewinnen. Erst in den letzten Wochen war ihm klar geworden, welche Lebensleistung hinter dem Namen Percy Parker stand. Der Admiral war nicht nur ein akribischer Forscher von allerhöchstem Rang. Sein Ansehen hatte er sich besonders damit verdient, dass er es verstand, Menschen zu führen und für seine Sache zu gewinnen. Und zwar mit Argumenten und Begeisterung, nicht durch Vetternwirtschaft und Korruption. Für Cliff war die Zeit gekommen, dies anzuerkennen. Sein Vater hatte den Respekt und die Liebe seines einzigen Sohns verdient, und nicht die pubertären Eifersüchteleien eines unzufriedenen, verzogenen Burschen.
»Was hat er gesagt? Wie geht es ihm?«
»Er wollte gleich am nächsten Morgen auslaufen. Wir haben ausgemacht, dass er von Numinala aus Kurs Nordnordwest segeln wird.« Sie schaute auf das Wasser und prüfte den Wind. »Du solltest den Kurs ein wenig korrigieren. Dann treffen wir ihn in ungefähr zwei Tagen.«
Cliff war so stolz auf dieses Wasserwesen. Er ging mit ihr hinunter und zeigte ihr, wie er einen neuen Kurs aus ihren Angaben berechnete, und zeichnete zwei Linien in die Seekarte: Dort, wo sie sich kreuzten, würden sich die Emerald, das Flaggschiff des Admirals, und die Viking bald begegnen.
Nach ihrem nächsten Tauchausflug brachte Yphemi überraschenderweise eine kräftige Tkitameafrau mit an Bord.
»Willkommen auf der Viking!« Cliff verbeugte sich elegant vor der Tkitamea. Es war schon dunkel, viele Männer hatten Freiwache und waren unter Deck. Nur die beiden Männer am Steuer glotzten neugierig herüber. Yphemi verhielt sich eigenartig. Anstatt ihn stürmisch zu begrüßen, wie sie das sonst tat, oder die Fremde vorzustellen, war sie ernst und still.
»Können wir runtergehen?«, bat sie ihn leise.
Cliff war mit einem Schritt bei ihr und zog sie in seine Arme. Schon brachen die Dämme, und sie schluchzte.
»Was ist denn passiert?«
Die Tkitameafrau beobachtete ihn und Yphemi aufmerksam und stumm.
»Kommt mit in meine Kajüte.«
Unten bot Cliff der Fremden einen Stuhl an, Yphemi lehnte ab und blieb bei der anderen stehen. Sie hatte sich ein wenig gefasst.
»Noch einmal willkommen auf der Viking. Mein Name ist Captain Clifford Parker. Mit wem habe ich das Vergnügen?«
»Ich bin Manateka. Heilerin und Angehörige des Regierungsrats der Tkitamea.«
Cliff ließ Yphemi nicht aus den Augen. Ob diese Manateka nicht wissen sollte, dass Cliff und Yphemi ein Paar waren? »Wie lange wollt ihr mich denn noch auf die Folter spannen, was passiert ist?«
Eine Träne lief über Yphemis Gesicht. »Viverrins Vater wurde ermordet. Und Viverrin ist sehr krank. Er wäre fast gestorben.« Anklagend fuhr sie fort. »Warum hat mir dein Vater nichts von dem Mord erzählt?«
Cliff fühlte sich ein wenig überfahren. »Wieso fragst du mich das? Vielleicht wusste er nichts davon!«
Manateka ergriff das Wort. »Von Viverrins Zustand kann der Admiral nichts wissen. Und vielleicht hatte er seine Gründe, dir nichts über den Mord an Vivandro zu erzählen. Schließlich kannte er dich ja auch nicht.«
»Vivandro hieß der Gouverneur von Numinala«, meinte Cliff erstaunt. Natürlich kannte Cliff den Tkitamea. »Er war Viverrins Vater? Was weiß man über das Verbrechen?«
»Leider nicht besonders viel. Und das, was erzählt wird, gibt es auch noch in mehreren Varianten. Fakt ist offenbar, dass Admiral Percy Parker Vivandro tot aufgefunden hat. Ich würde gern mit ihm darüber sprechen. Aber nicht offiziell. Noch nicht«, schob sie zögernd hinterher.
Cliff nickte. »Wir wollen ihn auf See treffen. Nach meinen Berechnungen müssten wir seinem Schiff morgen im Lauf des Tages begegnen. Aber was ist mit Viverrin? Er hat uns sehr geholfen. Was ist ihm denn passiert?«
»Er wollte die Beisetzungsfeierlichkeiten für seinen Vater nicht verpassen und hat sich auf dem Weg dorthin überanstrengt.«
»Können wir etwas für ihn tun? Die Emerald hat eine sehr gute Krankenstation an Bord«, versuchte Cliff zu helfen.
Sie schüttelte mit dem Kopf. »Wir sind zu verschieden. Eure Ärzte werden nicht helfen können. Auch, wenn er es schafft, wird er nicht mehr gesund werden. Wenn es der Wunsch der Ahnen ist, wird er sein Leben blind weiterleben müssen.« Sie seufzte, und Yphemi blinzelte verdächtig ein paar Tränen weg. Cliff fiel Manatekas dunkle Gesichtsfarbe auf, die grau-silbernen Haarsträhnen bildeten einen schönen Kontrast dazu. Die Frau war deutlich älter als Yphemi, trotz ihrer Fülle war sie beeindruckend, ja geradezu schön. Es war ihrem bekümmerten Gesichtsausdruck anzusehen, wie besorgt auch sie um Viverrin war. Cliff streckte die Hand nach Yphemi aus, und sie flog in seinen Arm. Er lächelte erleichtert. Yphemi hatte sich offensichtlich entschieden, ihre Beziehung nicht vor dieser Angehörigen des Tkitamearats zu verstecken. Gut so. Das Gesicht Manatekas war ernst, aber nicht abweisend.
»Es ist gut, dass ich dich gefunden habe, Yphemi. Du hast deinen Dienst verlassen«, sagte sie ernst. »Dein Hauptmann hat derzeit anderes im Sinn und hat deine Abwesenheit noch nicht gemeldet. Du hast jetzt also die Chance, deinen Fehler zu korrigieren.«
Yphemi straffte die Schultern. »Ich kann mir schon denken, was Shaka anderes im Sinn hat. Wisst ihr im Rat eigentlich, was man sich über ihn erzählt?«
Die Rätin blieb auf Yphemis Ausbruch hin gelassen. »Er wird sich verantworten müssen, wenn es um ihn geht. Zunächst einmal geht es mir um deine Verfehlung. Was hast du dazu zu sagen?«
Obwohl Manateka freundlich war, schien Yphemi eingeschüchtert. Sie berichtete, bemüht um Sachlichkeit.
»Nach dem Untergang der Clara habe ich Shaka getroffen. Er hat mich mit keiner anderen Aufgabe betraut. Also habe ich mir selbst eine gesucht. Zuerst war ich in Ilumia und habe Viverrin bewacht. Shaka weiß das. Er war dabei, als mein Vater es gestattete. Ich bin sogar für einen seiner Männer eingesprungen. Und jetzt bin ich wieder Wächterin des Schiffs von Captain Cliff.«
Ein winziges Lächeln spielte um die Lippen der Rätin. »Nun, so kann man es sehen. Wie es mir scheint, bist du weit mehr als eine Wächterin.«
Cliff hatte sich die ganze Zeit beobachtend zurückgehalten. Ihm kam das Gespräch wie ein Verhör vor, nur wunderte es ihn, dass Manateka ihn dabei sein ließ. Yphemi tastete nach seiner Hand, und er umschloss sie zärtlich.
»Ein paar von uns haben einen Bund mit den abtrünnigen Menschen geschlossen«, gestand sie der Rätin. »Wir wollen das Blutvergießen beenden und Frieden schließen. Es muss eine gemeinsame Zukunft geben für Tkitamea und Menschen«, sagte sie tapfer. »Wir wollen helfen, dass die große Entscheidung zu ihren Gunsten ausfällt.«
»Und was ist mit deinem Bund mit Shaka?«, hakte diese nach und hatte Cliff dabei im Blick. Er merkte, wie erstaunt die Tkitamea war, dass er gar nicht auf diese Frage reagierte. Oder jedenfalls nicht so, wie sie offenbar erwartete.
»Shaka wird nicht mein Gefährte sein«, antwortete Yphemi ein bisschen trotzig, das ließ Cliffs Herz aufgehen. Er konnte sich ein stolzes Lächeln nicht verkneifen.
»Dann solltest du ihn das bald wissen lassen. Und deinen Vater auch.«
Yphemi nickte. »Shaka weiß es schon. Darf ich vorerst hierbleiben?«
Manateka lächelte. »Ich sehe, dass ihr beide ein besonderes Bündnis eingegangen seid. Du kennst mich, Yphemi. Ich gehöre nicht zu denen, die den harten Kurs verfolgen. Im Moment sehe ich keinen Grund, dich von diesem Schiff abzuziehen. Tyrrab mag das anders sehen, aber dein oberster Dienstherr ist gerade nicht anwesend. Deshalb gestatte ich, Manateka, dir ausdrücklich, deinen Dienst auf diesem Schiff zu versehen.«
Yphemi war die Erleichterung anzusehen.
»Ich bin auch sehr froh darüber«, flüsterte Cliff ihr zu, sodass Manateka es auch hören konnte. Diesmal redete sie ihn direkt an.
»Ich würde gern morgen den Admiral kennenlernen. Gestattest du, dass ich über Nacht an Bord bleibe?«
Cliff verbeugte sich im Sitzen. »Diese Kajüte steht euch zur Verfügung, Madame«, meinte er zuvorkommend. Nun lachte Manateka. »Ihr habt eigenartige Ausdrucksweisen, wenn ihr Respekt zeigen wollt. Das gefällt mir! Aber ein Platz an Deck wäre mir lieber. Ich bin es nicht gewöhnt, in einer Holzkiste zu schlafen, auch wenn sie schwimmt.«
Yphemi sprang auf. »Ich richte dir einen Platz.« Und schon war sie draußen. Manateka erhob sich, und Cliff stand höflicherweise auf. »Weißt du, welche Bedeutung Yphemi in unserer Welt hat?«
»Sie ist Genkors Tochter, bestellte Wächterin und Priesterin der Moorii«, wiederholte Cliff, was Yphemi ihm erzählt hatte.
»Ja, aber hat sie dir auch erzählt, was das bedeutet?«
Cliff musste den Kopf schütteln. »Ich weiß, dass ihr Tkitamea eure Welt schützen wollt und dass Yphemi mir vieles nicht erzählen darf. Sie versucht alles, um sich daran zu halten. Ich fände es außerordentlich wichtig, wenn wir aufhören könnten, Geheimnisse voreinander zu haben.«
Ihr tiefer Blick ruhte auf ihm, Cliff hielt stand, auch wenn er sich fühlte wie unter einem Lasermesser.
»Mensch«, antwortete sie, »ich hoffe für uns alle, dass die Zeit kommen wird, in der wir uns gegenseitig unsere Geheimnisse offenbaren. Hoffen wir, dass es dafür nicht schon zu spät ist.«
Der Ernst in ihrer Stimme ließ Cliff mit einem unguten Gefühl im Magen zurück.
Juniya
Der Weg zur Festung war nicht weit. Juniya und Vadim gingen ihn zu Fuß, sie brauchten nur deshalb so lange, weil immer mehr Menschen herbeigeeilt kamen, um Vadim und Juniya zu sehen. Wie ein echter Fürst verteilte er mit großzügigen Gesten kleine Münzen. Juniya nutzte jede Gelegenheit, um stehenzubleiben und sich etwas anzusehen. Weder die Töpferwaren noch der Stand mit dem frischen Gebäck oder das Gemüse interessierten sie wirklich. Sie prägte sich die Wege und Gassen ein, die von der Festung zurück zum Hafen verliefen. Schließlich waren sie doch am Ziel, und sie trat voller Unbehagen durch das große Tor. Der Eingang hatte sich verändert. Vor ein paar Wochen war hier nur ein Durchlass zwischen halbfertigen Mauern gewesen. Mittlerweile hingen schwere Holztore in armdicken Türangeln, die Mauern waren bestimmt drei Meter hoch, Wächter flankierten den Zugang. Sie sahen genauso abgerissen aus wie Jacks damals. Juniya erschauerte. Die Männer nahmen Haltung an, als Vadim näherkam. Sie versuchten es zumindest. Juniya kannte sich wenig mit Soldaten aus, aber diese Burschen hier hatten sicher noch keinen Drill erlebt. Sie zupfte Vadim am Ärmel. Als er sich zu ihr umdrehte, flüsterte sie ihm ins Ohr: »Meiner Ehrengarde sollten wir vielleicht auch eine Art Uniform verpassen. Sie muss ja nicht gerade rosa sein, aber ein bisschen adretter könnten die Männer schon aussehen. Würde das nicht auch vor dem Rest dieser Welt einen besseren Eindruck machen?«
Zuerst kniff Vadim die Augenbrauen zusammen. Dann fing er an zu lachen. Er nahm ihre Hand und hauchte einen Kuss darauf. Juniya berührte diese elegante und ehrerbietige Geste.
»Meine Königin hat wie immer recht. Meine besten Männer sollten nicht wie die größten Lumpen im Hafen aussehen. Kemal«, rief er hinter sich. Dieser wuselte sofort zu ihm hin. »Juniya möchte, dass wir unsere Wachen in eine ordentliche Uniform stecken. Lass dir etwas einfallen!« Und wieder zu Juniya gewandt, bot er ihr den Arm: »Komm, meine Liebe. Lass uns oben eine Erfrischung nehmen.«
Juniya hatte viel zu wenig Zeit, den Innenhof hinter dem Tor und die Gebäude zu inspizieren. Rechts erkannte sie das Haus, aus dem sie geflohen war. Hier wohnten also die Wachen, solche Leute wie Jacks. Vadim stolzierte mit ihr durch den Hof auf einen breiten Eingang zu. Unter hölzernen Vordächern saßen Händler mit Korbwaren, echten Hühnern – Juniya hatte diese Tiere auch schon auf den Schiffen gesehen – , Gewürzen, Holz und allem möglichen anderen Kram. In der Mitte des Hofs stand ein niedriges, überdachtes, rundes Bauwerk. »Was ist das?«, fragte sie neugierig und zog Vadim dorthin.
»Sag bloß, du hast noch nie einen Brunnen gesehen?«
Tatsächlich fasziniert blickte Juniya durch ein Gitter nach unten in einen schwarzen Schacht. Sie schüttelte mit dem Kopf. »Wasser kam bei uns aus den Wänden. Leitungen, nannten sie das«, antwortete sie ihm augenzwinkernd. »Im Mittelalter habe ich bisher nicht gelebt und ich weiß so gut wie nichts über diese Zeit.«
Vadim lächelte gelöst. »Nun ja, vielleicht können wir mit der Zeit über kleine Modernisierungsmaßnahmen nachdenken. Im Moment wird es dir auch so an wenigen Dingen fehlen. Du wirst sehen.«
Nur wenige Schritte hinter dem Eingang führte eine breite Treppe in den ersten Stock des Haupthauses und endete in einem großen Saal, von dem mehrere Türen abzweigten. Die Außenwand bestand aus raumhohen steinernen Bögen, die einen atemberaubenden Ausblick auf das Meer boten. Scheiben aus Glas oder gar Kunststoff gab es keine. Die Steinböden waren mit Teppichen ausgelegt. Auf einem schweren Tisch lagen Früchte und kleines Gebäck. Vadim persönlich schenkte Juniya aus einer Glaskaraffe eine hellgelbe Flüssigkeit in ein schlankes Glas.
»Du musst ein Zauberer sein. Mindestens ein Künstler.« Juniya bekam langsam Übung darin, Vadim Honig um den Bart zu schmieren. Vielleicht half es ja doch, besser mit ihm umzugehen.
»Wie kommst du darauf?«, fragte er auch umgehend erstaunt.
»Wie schafft man es, so fragile Gegenstände über so weite Strecken zu transportieren, ohne dass sie kaputtgehen? Ich nehme mal an, Kunststoffverpackungen sucht man hier vergeblich?«
»Mit den uralten Tricks der Kaufleute und Händler. Gläser und sehr zerbrechliche Gegenstände werden in Fässer geschlichtet. Diese füllt man mit flüssiger Butter oder anderem flüssigem Fett. Ist das Fett fest geworden, können die Fässer gefahrlos transportiert werden. So eingepackt kann ein Fass sogar zu Boden fallen, ohne dass es Bruch gibt.«
»Davon habe ich noch nie gehört.«
Vadim lachte. »Das ist eine Technik, die die Händler auf der alten Erde schon vor über tausend Jahren anwendeten. Aber Geschichte ist in den neuen Welten ein seltenes Fach. Leider.« Wenn er so entspannt war, hörte sich sein Lachen tief und sympathisch an. Jeder Mensch hat zwei Seiten, dachte Juniya.
Während sich Vadim ein Stück abseits anhörte, was seine Wachen zu sagen hatten, kostete Juniya von dem Getränk, das Kemal Limonade nannte, und den hübsch angerichteten Lebensmitteln. Sie schlenderte zu den Fensterbögen. Das Meer glitzerte in der Sonne des frühen Abends, keinerlei Brüstung oder Geländer schützte vor dem Hinaustreten und Abstürzen. Juniya trat bis zur Kante vor. Von unten fuhr der Wind herauf. Die Festung stand wie in Numinala an der Wasserlinie, hoch auf den Klippen. Obwohl sie vom Hof aus eigentlich nur in einen hohen ersten Stock gestiegen war, ging es hier sicher gute zwanzig Meter – Juniya war nicht besonders gut im Abschätzen von Entfernungen – hinunter. An eine Flucht über diese Wand auf die zerklüfteten Felsen, an die das Wasser heute sanft anspülte, war sicher nicht zu denken. Juniya hörte, wie Vadim herantrat. Sie erkannte ihn am Knistern seines Seidengewands.
»Es ist schön hier«, sagte sie, ohne sich zu ihm umzudrehen.
»Es wird von Jahr zu Jahr schöner werden.« Er nahm sie sanft am Ellbogen. »Komm ein Stück herein. Es wäre doch furchtbar, wenn dich eine Windböe packen würde und du abstürzt.«
Diese kleine Geste war direkt fürsorglich. Sollte er tatsächlich etwas für sie empfinden? Am Ende der Halle war deutlich das Patschen einer Ohrfeige zu hören, und schon brach ein Streit aus. Einer der Wächter hielt sich die Wange und lieferte sich mit Clodia einen wütenden verbalen Schlagabtausch.
»Ruhe!«, donnerte Vadim dazwischen. Sein Gesicht hatte sich unheildrohend verzogen. Er winkte die beiden heran. Clodia versank sofort in einen tiefen Knicks und senkte zerknirscht das Haupt.
»Verzeih, Herr«, sonst sagte sie nichts.
Sie hat besser gelernt als ich, richtig auf Vadim zu reagieren, ging es Juniya mit einer Mischung aus Bedauern und Bewunderung durch den Kopf.
Der Mann von Vadims Wache dagegen lief böse in die Falle.
»Du kleine Hure brauchst hier gar nicht so unschuldig zu tun. Bist noch gar nicht ganz angekommen und spielst dich schon auf wie …«
Vadim hob die Hand, der Mann kapierte endlich und hielt den Mund.
»Wie wer spielst du dich auf, liebe Clodia?«
Für jeden, der Vadim kannte, war diese Tonlage ein Zeichen, sich nach Möglichkeit unsichtbar zu machen. Clodia warf sich ihm zu Füßen.
»Meine Aufgabe ist es, für Juniya hier alles so angenehm wie möglich zu machen. Ich hab den Kerl gerügt für diesen dreckigen Aufzug, in dem er hier erscheint und sich über euch lustig macht.«
»Das stimmt doch gar nicht!«, empörte sich der Mann. »Du freches Weib kommst hier rein und …«
Vadim sah zu den Zwillingsmatrosen hinüber und machte ihnen ein Zeichen. Der Mann vor ihm verstand und riss seine Augen entsetzt auf. »Nein! Was hab ich denn gemacht? Die lügt!«