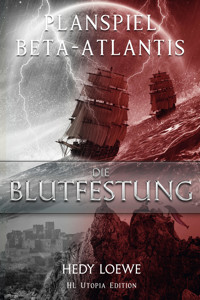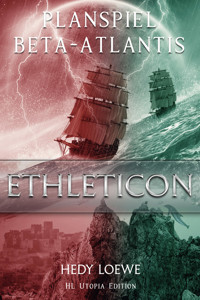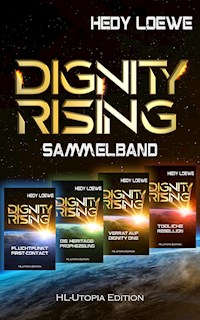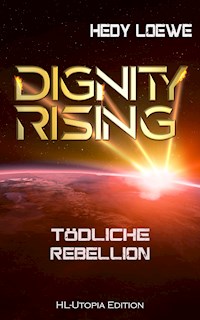2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HL UTOPIA EDITION
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Drei mächtige Intriganten – gesteuert von Habgier und Ehrgeiz – überziehen die Welt der Wasserwesen auf Beta-Atlantis mit Gewalt, Betrug und Mord. Wer von ihnen ist für die rätselhaften Stürme verantwortlich, die den Unterwasserstädten Tod und Verderben bringen? Während Viverrin bei seinem Volk in arge Bedrängnis gerät, weil er Juniya ein großes Geheimnis offenbart hat, entkommt Captain Skye Collins nur knapp den niederträchtigen Plänen des Generals. Als Freibeuter auf sich allein gestellt, macht er sich auf die Suche nach Juniya. Sie ist dem berüchtigten Händlerkönig Vadim Smalov in die Hände gefallen und kämpft um ihr Überleben. Unterstützung bekommt Skye von einer unerwarteten Allianz. Doch seine Hilfsbereitschaft fordert von Viverrin einen schrecklichen Preis …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Widmung
Planspiel Beta-Atlantis Quicksilver
Glossar
Danksagung
Die Autorin
Titel
Hedy Loewe
Planspiel Beta-Atlantis
Quicksilver
Band 2
Scifi-Fantasy/LitRPG
HL UTOPIA EDITION
Impressum
©2020 Hedy Loewe
Erste Ausgabe
Herausgeber: Hedy Loewe, Sabine Schöberl, Veilchenstr. 4, 90587 Veitsbronn
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung, wozu auch die Verbreitung über „Tauschbörsen“ zählt..
Covergestaltung: Magicalcover.de / Giusy Ame Bildquelle: Depositphoto
Lektorat: Marion Voigt, folio-lektorat.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.hedy-loewe.de
Kontakt:
.
Widmung
Für all jene,
für die der Zauber der See
im Wort Sehnsucht
lebendig wird.
Planspiel Beta-Atlantis Quicksilver
Der Admiral
Der Teufelskerl hat es tatsächlich geschafft! Admiral Percy Parker, genannt die Gräte, jubelte im Geheimen und starrte gebannt durch das Fernrohr. Am Horizont verschwand ein Segelschiff im Dunst des späten Nachmittags. Er winkte seinen Adjutanten heran und übergab dem Offizier für seine Verhältnisse fast ungestüm den Kieker.
»Evans, Ihre Augen sind jünger als meine. Welches Schiff erkennen Sie, und welche Flagge führt es?«
Evans stand wie immer wie ein Schatten einen Schritt hinter seinem Admiral. Dass auch er aufgeregt war, bemerkte Percy Parker an seinen leicht zuckenden Augenlidern. Der junge Mann nahm ihm das Glas aus der Hand und starrte hindurch.
»Takelage und Konturen lassen ziemlich eindeutig auf die Fairbanks schließen, Sir. Aber die Flagge …«
»Ja nun, Evans, was ist mit der Flagge?«
»Ich würde fast meinen, Captain Collins hat da einen Jolly Roger hochgezogen!«
Niemand außer Evans konnte sehen, wie der Admiral in sich hineingrinste.
»Das scheint mir doch fast auch so, Evans«, murmelte er mit einer kaum unterdrückbaren Freude. »Das scheint mir doch fast auch so.« Er nahm das Fernrohr zurück und schaute dem Schiff hinterher, bis es hinter dem Horizont verschwunden war. »Was halten Sie von den Wolken, werter Evans?«
»Sieht nach schwerem Sturm aus, Admiral, Sir.«
Der Alte nickte bedächtig. »Wir müssen den General dazu bringen, den Hafen schnellstmöglich wieder zu verlassen. Unser schönes Schiff!«, murmelte er in sein Spitzbärtchen. Der nur wenig befestigte enge Haven in der Helios Bay würde dem stolzen Flaggschiff der Admiralität bei einem Sturm nicht viel Schutz bieten. Im Gegenteil, es war möglich, dass das Schiff an Land geworfen und empfindlich beschädigt, wenn nicht gar zerstört wurde. Es wird nicht einfach, diesem Beard das beizubringen. So wenig Ahnung, wie der hat.
Nach dem Anlegen vor gut einer Stunde ging General Beard sofort von Bord, um seine Leute an Land zu suchen und sich zu erkundigen, was geschehen war. In der Zwischenzeit hatten sich ein paar ehemalige Matrosen der Fairbanks bei Admiral Parker gemeldet, weil sie bei der nächsten Gelegenheit das Spiel verlassen wollten, sie hatten vom Planspiel Beta-Atlantis die Nase voll. Eine andere Gruppe bat ihn um Aufnahme in die Schiffscrew der Emerald. »Evans, veranlassen Sie das. Bringen Sie die Männer unter«, hatte der Admiral befohlen und gleichzeitig die Neuen an Bord ein bisschen ausgehorcht. Aber er hatte nichts Interessantes erfahren. Außer dass Captain Collins schlau genug gewesen war, seine Crew ein wenig auszusieben. Er hat die verlässlichsten Männer in diese neue Aufgabe mitgenommen. Das habe ich gar nicht anders erwartet, lächelte Percy Parker. Der Junge hat bisher alle meine Erwartungen erfüllt. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Nun stand der Admiral wieder auf seinem geliebten Achterdeck und bewunderte einen glühendroten Sonnenuntergang, neben dem sich ungewöhnlich schnell die ersten drohenden Wolkenfelder aufbauten.
»Admiral Parker!«
»Wer kreischt da an unser Ohr, Evans?«, sagte er nur für die Ohren seines Adjutanten bestimmt.
»Admiral, Sir, ich denke, es ist General Beard«, antwortete Evans in der gleichen Seelenruhe und Lautstärke.
Percy Parker seufzte unterdrückt. »Nun, es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als uns unserem Gast zu widmen.« Er drehte sich gemächlich um. General Sylvius Beard stakste, ja, er rannte fast, wütend auf ihn zu und kam die Treppe zum Achterdeck herauf. Beinahe hätte der Admiral gelacht. Der komische Spielzeugsäbel an Beards Fantasieuniform kam ihm immer wieder zwischen die Beine und brachte ihn um ein Haar zu Fall.
»Werter General! Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie an Land erfahren?«, fragte Parker den aufgeregten Mann stattdessen höflich und beherrscht. Natürlich war er neugierig, was in Helios Bay geschehen war.
»Begleiten Sie mich unter Deck! Das ist ein Befehl!« Beard wollte sich schon wieder umdrehen, doch Admiral Parker lenkte dessen Aufmerksamkeit auf den Horizont.
»General Beard, bei allem Respekt, dieses Schauspiel ist Ihnen doch gewiss nicht entgangen?« Lässig zeigte der Admiral auf die Wolkenfront, die weit entfernt in der Abenddämmerung am Horizont zu sehen war und sich schon fast vor die blutrote Sonne geschoben hatte.
»Ein paar Wolken. Ja, und? Kommen Sie!«
Hinter dem davoneilenden General schüttelte Percy Parker resignierend den Kopf.
In der Kajüte des Generals lagen unzählige Seekarten auf dem Tisch. Drei Männer hatten vor der Tür gewartet und drückten sich in einer Ecke herum, nachdem Beard sie mit schneidender Stimme hereinbefohlen hatte. Beard war weiß vor Wut.
»Wo ist Mason?«, schrie er die Männer an, die mit ordentlichen Beulen an den Köpfen kleinlaut vor ihm standen. Sie zuckten mit den Schultern.
Einer nahm seinen Mut zusammen. »Als ich zu mir gekommen bin, lagen wir in einer Hütte. Ich hab versucht, die anderen wach zu kriegen, und bin dann zum Kai zurück. Doch die Fairbanks war schon zu weit draußen.«
»Und eure Waffen? Wieso ist es euch mitsamt der Kette und den Gewehren nicht gelungen, diesen Collins aufzuhalten?«
Diesmal zuckte ein anderer mit den Schultern.
»Da war Zauberei im Spiel. Die Kette ist verschwunden. So haben es uns zumindest die Zeugen erzählt.«
»Zauberei? So ein Schwachsinn!«, schrie Beard unbeherrscht. »Und die Waffen? Sind die auch wie durch Zauberei verschwunden? Holt mir diese angeblichen Zeugen her, sofort!«
Die drei stolperten hinaus. Die Befragung der Crewmitglieder der Fairbanks, die in Helios Bay zurückgeblieben waren, hatte nicht viel Aufschluss gegeben. Die meisten Männer waren verärgert, weil sie von Bord gelockt und ausgebootet worden waren, ohne gefragt worden zu sein. Sie waren stinksauer, doch sie konnten General Beard nichts Besonderes erzählen. Alles war vorher völlig normal verlaufen, die Fairbanks legte an und war von diesem Mr Mason an die Kette gelegt worden. Und irgendwann am Nachmittag war die Fairbanks so mir nichts, dir nichts ausgelaufen, und nichts und niemand hatte sie daran gehindert. Im Ort suchten Beards Männer noch immer diesen Mason, doch der war wie vom Erdboden verschluckt. Zornig fuhr Beard den Admiral an.
»Warum habe ich nur auf Sie gehört? Wir hätten der Fairbanks sofort hinterhersegeln sollen. Los, Anker auf und ihm nach!«
»Werter General«, tat Parker erstaunt. »Sie werden die Fairbanks mit Ihren Methoden sicher bald wiederfinden. Schließlich können Sie sie mit Ihren Drohnen orten. Aber Sie wissen doch, wir können das schnellste Schiff der Flotte nicht mal unter Vollzeug einholen. Die schnittigere Fairbanks läuft uns mit ihren gut 16 Knoten glatt davon. Die Emerald wird auch unter besten Bedingungen nicht mehr als 12 Knoten machen. Ich bin der Meinung, es war sehr vernünftig von Ihnen, sich erst einmal einen Überblick über die Lage hier im Hafen zu verschaffen. Und ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Wir sollten Helios Bay jetzt so schnell wie möglich verlassen. Denn wir müssen unser Schiff vor dem Sturm in Sicherheit bringen.«
»Was für ein Sturm?« Beard war aus dem Konzept gebracht. »Wir liegen hier doch sicher. Einen Sturm können wir hier doch abwarten.«
Du dummer Trottel, dachte sich die Gräte. Nur damit du nicht wieder seekrank wirst, gefährdest du das Schiff. »Sie sind der General. Aber wie wäre es mit diesem Vorschlag: Sie gehen an Land und nehmen sich noch einmal diese Männer vor. Vielleicht finden Sie Ihren Mr Mason ja noch. In einem der Gasthäuser nächtigen Sie viel komfortabler als an Bord unserer Emerald. Ich dagegen werde den Befehl zum Auslaufen geben. Glauben Sie mir, hier in diesem engen Hafen wird uns der Sturm auf die Klippen treiben und das Schiff schwer beschädigen. Sie wollen doch keinen Punktabzug für ein havariertes Flaggschiff riskieren? In ein paar Stunden, wenn der Wetterspuk vorbei ist, hole ich Sie wieder ab.«
Tatsächlich lenkte Beard ein und verließ schnaubend das Schiff.
»Schiff klar zum Auslaufen, Mr Evans«, hustete die Gräte in sein Taschentuch.
»Aye, Sir!«
Skye
Die Mannschaft johlte begeistert, als sich der Jolly Roger an der Spitze des Hauptmasts entrollte und herausfordernd in der steifen Brise flatterte. Skye beobachtete mit seinem Fernrohr angespannt die Küste. »Es sieht nicht danach aus, dass das Flaggschiff sofort die Verfolgung aufnimmt. Eher im Gegenteil«, sprach er eher zu sich selbst als zu seinem ersten Offizier.
»Ja«, bestätigte Jason begeistert. »Die Emerald holt die Segel ein, sie macht klar zum Ankern. Wir sind ihnen tatsächlich entwischt!«
»Halten Sie den Kurs, Mr Small, und bringen Sie uns hinter den Horizont, so schnell die Lady über das Wasser fliegen kann!«, befahl Skye mit sicherer Stimme.
Small lachte dröhnend. »Aye, Captain Scar.«
Skye kniff die Augen zusammen, aber Jason hieb ihm auf die Schulter. »Du hast doch nicht geglaubt, dass du deinem Spitznamen entkommen kannst. Schon gar nicht in unserer neuen Rolle! Ich finde, er passt ausgezeichnet, nicht wahr, Männer?«
Einige Seeleute hatten Mr Smalls Ausruf und Jasons Antwort mitbekommen und lachten zustimmend. Skye ließ es auf sich beruhen. Auch wenn er diesen Spitznamen hasste. Denn er erinnerte ihn immer an das Unvermeidliche. Er lenkte sich mit weiteren Befehlen ab. »Lassen Sie die Royals setzen, Mr Bonney. Wir werden uns den größtmöglichen Vorsprung sichern. Holen Sie an Geschwindigkeit raus, was geht.«
»Aye, Captain Scar!«, antwortete Jason mit einem breiten Grinsen und kümmerte sich um das Schiff.
Skyes Blick wanderte prüfend über das Deck. Die Stimmung an Bord schien gut. Die Männer hatten sichtlich Spaß an den letzten Stunden, witzelten und lachten, ohne die Bordroutine damit zu untergraben, alle packten an und erledigten ihren Dienst gut gelaunt. Es hatte sich schnell an Bord herumgesprochen, dass der Ichtyo namens Viverrin mit irgendeiner Art Seeschwamm die Ketten aufgelöst und die Fairbanks befreit hatte. Skye beobachtete mehrmals, wie der eine oder andere Matrose dem schlanken Ichtyo anerkennend auf die Schulter hieb und ein paar Worte an ihn richtete. Viverrin dagegen hatte sein regloses, arrogantes Gesicht aufgesetzt. Er saß trotz des Seegangs wie angeklebt und ohne sich festzuhalten auf der Reling und schaute den Männern eher gelangweilt beim Segeln des Schiffs zu. Skye war entschlossen, neue Pläne zu schmieden.
»Mr Bonney, übergeben Sie Mr Small das Kommando und folgen Sie mir. Viverrin, komm mit uns unter Deck.«
Der Ichtyo hob trotzig das Kinn. »Bitte«, presste Skye einlenkend durch die Lippen. »Bitte begleite uns nach unten.« Mit dem Anflug eines überheblichen Lächelns und einer minimalen schrägen Kopfneigung sprang Viverrin sicher von der Reling auf das Deck und folgte ihm.
In seiner Kajüte breitete Skye die Seekarten auf dem Tisch aus. Sichtlich interessiert beugte sich der Ichtyo darüber.
»Ganz erstaunlich genau«, merkte er trocken an. »Wie habt ihr die in den wenigen Jahren, in denen ihr hier seid, zustande gebracht?«
»Du kannst Seekarten lesen?«, fragte Jason.
Viverrin rollte mit den Augen und verbeugte sich theatralisch vor den beiden Männern. »Wie gut, dass ihr in unsere Welt gekommen seid. Ohne eure Errungenschaften wären wir noch immer ein ungebildetes Naturvolk, das nichts anderes kann, als sich im Wasser die Zeit zu vertreiben.« Wieder beugte er sich über Skyes Seekarten. »Ihr habt unsere Inseln also schon komplett vermessen?«
Skye nickte. »Die Fairbanks und noch fünf andere Schiffe haben Messgeräte an Bord. Wir hatten den Auftrag, die Seekarten zu erstellen, um die besten Routen für unsere Schiffe zu finden und Untiefen aufzuspüren«, erklärte Skye offen.
»Wie macht ihr das?« Der Ichtyo studierte immer noch die Karten.
»Das Verfahren nennt sich Echolot. Das Schiff sendet Schallwellen zum Meeresboden und misst die Zeit, die sie brauchen, um reflektiert zu werden. Unsere Geräte sind auf die Vermessung von Meeresböden spezialisiert. Mit ähnlichen Verfahren kann man auch Fischschwärme aufspüren.«
Viverrins Haltung änderte sich. Nervös fasste er sich in die Haare. »Wie tief reicht dieses Echolot?«, fragte er tonlos.
Skye beobachtete den Ichtyo aufmerksam. »Mit unseren Geräten bekommen wir eine Tiefe von einigen Meilen ganz gut abgebildet. Für tiefere Gewässer gibt es leistungsfähigere Messinstrumente. Aber zwischen den Inseln sind die Kanäle kaum tiefer als 600 Fuß.«
Viverrin schielte auf die steil abfallenden Randbereiche der Seekarte, die die gesamte westliche Hälfte der Inselwelt abbildete. »Und habt ihr weiter draußen auch schon vermessen?«, fragte er mit gepresster Stimme.
»Wozu? Die großen Tiefen sind für uns derzeit nicht interessant. Was würden wir da finden?« Skyes scharfen Augen entging nicht, dass Viverrin fast unmerklich zusammenzuckte. Er antwortete nicht auf Skyes Frage.
»Schallwellen sind es also«, murmelte der Ichtyo eher zu sich selbst. »Das ist es. Es gibt Walherden, die in letzter Zeit eigenartig reagiert haben. Das kommt also von euren Schallwellen.«
Jason ergriff das Wort. »Ja, Wale und andere Meerestiere haben eine Art natürliches Echolot. Wie ist das mit euch? Wie findet ihr euch unter Wasser zurecht?«, fragte er Viverrin.
Der Ichtyo sah Jason nur hochmütig an. Skye versuchte zu vermitteln. »Deine Antwort auf Jasons Frage würde mich auch interessieren. Wir kennen euch einfach zu wenig. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, das zu ändern.«
Viverrins Augen waren wieder zur Karte gewandert, er reagierte kaum. Skye versuchte weiter, zu ihm durchzudringen. »Ich habe mich noch gar nicht bei dir bedankt. Du hast es geschafft, unser Schiff von der Kette zu befreien. Ich bin sehr froh, dich als Verbündeten zu haben. Danke!« Offen hielt er Viverrin die Hand hin.
Der Ichtyo zögerte. »Verbündete? Wobei?«, fragte er, ohne einzuschlagen. Ein wenig enttäuscht zog Skye seine Rechte zurück.
Jason rettete die etwas peinliche Situation, zog Skyes Seekiste als Sitzgelegenheit an den Tisch und lud die anderen mit einer Handbewegung ein, sich zu setzen. »Eines steht jedenfalls fest. Wir wissen noch viel zu wenig voneinander, da hat Captain Skye offensichtlich recht. Und das sollten wir schleunigst ändern. Ein zurückgewiesener Handschlag bedeutet in unserer Welt zum Beispiel eine unschöne Zurückweisung.«
Viverrin starrte ihn an. »Was du nicht sagst. Wir haben viele eurer Gebräuche studiert. Seid nicht ihr hier zu Gast? Solltet ihr euch nicht so verhalten, wie es bei uns Sitte ist?«
Jason holte Luft, um zu antworten, doch Viverrin schnitt ihm das Wort ab. »Ich stehe im Übrigen gern«, fuhr er fort und inspizierte Skyes Kajüte. »Hier hat sie tatsächlich so lang wohnen müssen? In so einem Loch?«
Skye schoss von seinem Stuhl hoch, auf den er sich gerade erst niedergelassen hatte. »Ein Kriegsschiff hat nun mal keine Hotelsuiten!«, fuhr er Viverrin temperamentvoll an. Es gab ihm einen Stich ins Herz, als der Ichtyo über das Laken streichelte, auf dem Juniya damals gelegen hatte.
»Hotelsssuiten?«, wiederholte Viverrin zischend mit hochgezogener Braue, die bei ihm anstatt aus Haaren aus winzigsten Verästelungen bestand. »Dieses Wort scheint mir doch aus einer anderen Welt zu kommen. Wann werdet ihr endlich dorthin zurück verschwinden?« Seine großen schräg stehenden Augen beobachteten Skyes Reaktion grimmig. Skye fühlte sich ertappt.
Jason sprang ihm bei. »Hey, Viverrin. Wenn du uns nicht leiden kannst, warum hast du uns eigentlich geholfen? Wegen Juniya?« Jasons locker dahingeworfener, aber berechtigter Einwand schien den Ichtyo zu treffen. Seine schlanke Gestalt krümmte sich ein wenig, und seine Augen huschten im Raum umher, eine plausible Erklärung suchend. Er schwieg und starrte an den beiden Männern vorbei. Skye merkte, wie der Zorn in ihm hochkochte. Er musste Viverrin für dessen Hilfe dankbar sein, doch der spitze Stachel der Eifersucht bohrte in ihm. Im Grunde wollte er die Antwort des Ichtyomanns gar nicht hören. Jedenfalls nicht den Teil, der Juniya betraf. Lang lass ich mir sein Getue nicht mehr gefallen.Wenn er jetzt noch irgendwas Blödes sagt, hau ich ihm für seine Arroganz eine rein. Skyes Fäuste waren schon geballt. Eine ungute Stille breitete sich aus. Jasons Augen flogen zwischen Skye und Viverrin hin und her. Es war Jason, der es schließlich schaffte, die knisternde Spannung aus der Situation zu nehmen.
»Ich sag euch jetzt mal was, ihr beiden Sturköpfe«, unterbrach er das Schweigen. »So, wie ich das hier sehe, seid ihr beide hinter dem gleichen Mädchen her. Das macht die Sache nicht einfacher. Aber das ist doch noch nicht alles? Wir sollten uns besser zusammenraufen. Sonst jagen uns die anderen mit ihren Kanonen bei der nächsten Gelegenheit aus dem Wasser. Es heißt hier nämlich gerade für uns ›Einer gegen alle‹, falls euch das entgangen sein sollte.«
»Zusammenraufen«, wiederholte Viverrin. »Eigenartiges Wort. Was bedeutet es?«
Viverrins nachdenklicher leiser Einwurf baute Skye endlich eine Brücke, er beruhigte sich, öffnete die Fäuste wieder und ließ sich zurück auf seinen Stuhl fallen. »Es bedeutet, sich trotz bestehender Unterschiede allmählich zu verstehen und zu akzeptieren. Wir raufen. Streiten. Kämpfen miteinander, ohne uns ernsthaft zu verletzen. Dadurch lernen wir uns besser kennen. Und kommen dabei zu mehr Zusammenhalt.«
Der Ichtyo nickte, seine Haltung veränderte sich, wurde entspannter. Er ließ sich vorsichtig auf Skyes Koje nieder, der einzigen freien Sitzfläche, und atmete tief ein. »Hört sich nicht schlecht an. Gut. Lasst uns raufen.«
Jason grinste. Doch Skye merkte, es war Viverrin ernst. »Was riskierst du, wenn du uns hilfst?«, fragte er aus einer Eingebung heraus.
»Nichts weiter als den Tod.« Die Antwort kam spontan und ehrlich.
»Na dann willkommen im Team.« Jasons Einwurf war nicht witzig, und so war er auch nicht gemeint.
Skye hakte nach. »Bist du in Gefahr, weil du uns hilfst?«
»Nein. Nicht, weil ich euch helfe.« Viverrins Stimme war leise geworden.
»Warum denn dann? Mensch, rede mit uns!«
»Mensch?« Viverrin lachte mit einem bitteren Unterton. »Du nennst mich Mensch und stellst mich auf deine Stufe? Ich verneige mich in Dankbarkeit.«
Skye rollte mit den Augen und musste sich beherrschen, um nicht gleich wieder auf Viverrins ironische Spitze hin die Geduld zu verlieren. »Dann sag uns, was du bist. Wer du bist. Und warum du in Gefahr bist.« Diesmal ließ er nicht locker.
Doch der Ichtyo wich wieder aus. »Du hast mich gerufen, ich bin gekommen und habe dir geholfen. Was willst du jetzt tun?«
»Ich will zu Juniya. Ich will sie holen und in Sicherheit bringen. Wo ist sie?«
Viverrin ignorierte Skyes Frage. »Auf diesem Schiff ist sie doch nicht in Sicherheit. Dein Freund sagt, ihr werdet gejagt.«
Als hätte ich mir das nicht schon selber gesagt. Skye haute mit der Faust auf den Tisch. »Die Fairbanks ist schneller als jedes andere Schiff zwischen den Inseln. Bei mir wird Juniya sicher sein! Ich bringe sie zurück zur Basis.«
Viverrin zog die Brauen erneut nach oben. »Die paar Kuppeln und Landungsstege mitten im Meer kannst du ja wohl nicht meinen. Dort befinden sich die gleichen Menschen wie hier. Und bis zu dieser eigenartigen Ansiedlung auf dem Wüstenkontinent ist es sehr weit. Zumindest mit diesem Schiff, so schnell es in euren Augen auch sein mag.«
Skyes und Jasons Blicke trafen sich. »Du weißt, wo unserer Basis ist?« Der Captain konnte seine Verwunderung nicht verstecken. »Viverrin, Juniya muss von hier fort. Weg von diesem Planeten«, rutschte ihm heraus. Vor unterdrückter Aufregung war seine Stimme heiser.
»Skye! Beruhige dich. Du verletzt die Regeln«, erinnerte Jason.
Das brauchte Skye nicht auch noch, und er antwortete ihm ungehalten. »Die Regeln haben sich längst geändert. Unsere ganze Mission ist am Kippen, und keiner weiß bisher, weshalb. Innerhalb weniger Wochen hat sich das Projekt ›Friendly Colonisation‹ in einen Hexenkessel verwandelt, in dem das Recht des Stärkeren gilt. Ich finde die Bezeichnung ›Unfriendly Take-over‹ durch General Beard sehr viel treffender. Ich will genau zwei Dinge: Juniya in Sicherheit wissen und herausfinden, wer dahinter steckt. Solange ich es noch kann. Und bevor es hier noch mehr Tote gibt.«
Jason nickte in seiner bedächtigen Art. »Ich bin ja auf deiner Seite. Aber ein schnelles Schiff allein wird uns nicht viel nützen, da liegt Viverrin ganz richtig. General Beard setzt Drohnen ein. Damit kann er uns verdammt schnell aufspüren. Auch wenn die Ozeane hier noch soweit sind.«
Skye hatte das Gefühl, dass ihm alles entglitt. Sein Schutzschild aus Selbstbewusstsein bekam Risse. Die Furcht war auf einmal wieder da. Furcht, Juniya nicht in Sicherheit bringen zu können. Furcht, es nicht rechtzeitig zu schaffen, bevor … Verzweifelt stieß er das kleine Fenster am Heck auf und lehnte sich einen Moment nach draußen. Der frische Wind beruhigte seine Nerven. Ein paar tiefe Atemzüge später drehte er sich wieder um. »Du sagst ja auf einmal gar nichts?«, herrschte er Viverrin an. »Du hast doch sicher eine Menge Fragen aus unserem Gespräch gerade.«
Der Ichtyo nickte genauso bedächtig wie Jason, als würde er ihn nachahmen. Oder er will mich beruhigen.
»Ich überlege genau wie ihr, welche weiteren Schritte wir gehen sollten. Wenn es so weitergeht zwischen den Tkitamea und den Menschen, wird es schlimm enden. Und glaubt mir, für euch wird es verlustreicher als für uns.«
Skye trat wieder auf ihn zu. »Tkitamea?«, wiederholte er sorgfältig. »Kein einfacher Name für unsere Zungen. So nennt ihr also euer Volk. Weshalb kennen wir ihn noch nicht?« Der hat wirklich eine unvergleichliche Art, einen mit dem schräg gelegten Kopf für blöd zu verkaufen, dachte Skye. Was findet Juniya nur an ihm, geisterte durch seinen Hinterkopf, und doch wartete er gespannt auf Viverrins Antwort.
»Ihr wart niemals bereit, zu sehen oder zu verstehen. Ihr seid nur gekommen, um uns zu zeigen, wer ihr seid. Wir sind vorsichtig. Wir schützen uns. Ihr wisst nichts über mein Volk.«
Nachdenklich fuhr sich Skye über seinen Bartschatten. »Wahrscheinlich hast du recht. Dann erzähl uns doch von euch!«
Der Ichtyo schüttelte den Kopf. »Ich habe schon viel zu viel verraten. Allein der Blutspakt mit dir kann mich den Kopf kosten. Auf jeden Verrat steht der Tod.«
»Wir wollen deinen Tod nicht. Ich will nichts als Juniya in Sicherheit zu bringen. Jason und ich werden dich nicht verraten. Wäre es nicht besser, wir arbeiten zusammen daran, herauszufinden, was falsch läuft?«
Viverrin zuckte mit den Schultern. »Wir haben nicht mehr viel Zeit. In ein paar Wochen ist die Zeit der Prüfung abgelaufen. Und wenn das so weitergeht mit dem Töten und der Unruhe, wird es euer aller Ende sein.«
Jason räusperte sich. »Nun, übernehmt ihr euch da nicht? Was wollt ihr gegen unsere Kanonen ausrichten?«
»Wie lange könnt ihr noch mal unter Wasser überleben?« Wieder kam dieser überhebliche Ton bei Viverrin durch. Skye verdrehte die Augen. Doch er erstarrte, als der Ichtyo fortfuhr. »Genauso, wie die Schwämme euer Eisen auflösen konnten, gibt es Lebewesen, die Löcher in eure Schiffe fressen, bis sie nur noch ein Haufen morscher Abfall sind. Und das muss nicht mal hier«, er tippte auf einen tiefen Graben auf der Seekarte, »sein. Ein paar Fuß Wassertiefe reichen doch völlig aus, um euch zu ersäufen.«
Sprachlos realisierten Skye und Jason diese simple Wahrheit.
Nach einer winzigen Bedenkzeit ergriff Skye die Initiative und trat auf den Ichtyo zu. »Viverrin! Lass uns weiteres Blutvergießen verhindern. Ich bin nicht hierhergekommen, um Tote zu hinterlassen. Weder bei euch noch bei uns. Wir wollten forschen. Und unseren Spaß an der Seefahrt haben. Mehr war nie geplant.«
»Das denkst du«, warf Jason ein. »Vielleicht haben sie uns ja doch nur die halbe Wahrheit erzählt. Wäre nicht das erste Mal.«
»Verdammt. Eigentlich hab ich der Gräte immer vertraut. Ich glaube immer noch, dass er ehrliche Absichten hatte.«
»Wer ist die Gräte?« Interessiert beugte sich Viverrin vor.
»Unser Admiral Percy Parker«, antworteten Skye und Jason gleichzeitig. »Professor Percy Parker. Er ist ein aufrechter und ehrenwerter Mann. Er hat das Ganze hier maßgeblich geplant und organisiert. Bei ihm mussten sich anfangs alle Interessenten persönlich vorstellen«, fuhr Skye fort.
»Ihr seid also alle freiwillig hier? Weshalb?«
Skye tauschte mit Jason einen langen Blick. Jason nickte. »Wenn wir dir sagen, warum wir gekommen sind, wirst du uns dann mehr über dich und dein Volk erzählen?«
Viverrin erhob sich langsam, und auch Skye stand auf. »Ich werde ohnehin nicht am Leben bleiben. So wollen es unsere Gesetze«, sprach der Ichtyo mit hängenden Schultern.
Dann haben wir etwas ganz Entscheidendes gemeinsam, ging es Skye verblüfft durch den Kopf. Er wollte einhaken, doch Viverrin redete schon weiter.
»Aber bis es soweit ist und sie mich verhaften, würde ich gern mehr über euch erfahren. Ich werde euch im Gegenzug etwas aus der Welt der Tkitamea erzählen. Vielleicht können wir gemeinsam etwas unternehmen. Es darf jedenfalls nicht so weitergehen wie bisher. Das wäre euer Untergang.« Zaghaft streckte Viverrin Skye seine schlanke, fast rautenförmige Hand entgegen. Skye schlug sofort ein. Viverrins Händedruck war fester, als Skye es erwartet hatte. Nicht warm, wie bei einem Menschen, aber fest und trocken, seine Haut fühlte sich rau an. »Danke für dein Vertrauen. Sagst du mir jetzt, wo …«
Skye wurde von der gellenden Alarmglocke unterbrochen, ihre Hände trennten sich. »Sichert das Schiff«, dröhnte Mr Smalls Bass über die Planken. »Der nächste Sturm rollt an.«
»So plötzlich? Was sind das nur für unheimliche Phänomene?«, fragte Jason, und Skye spürte wie die beiden anderen, die Fairbanks begann, heftig zu rollen. Die drei Männer stürmten an Deck.
Skye sichtete die Wetterlage. »Verflucht. Da kommen wieder diese drei Wolkenwalzen. Die haben uns schon beim letzten Sturm schwer zu schaffen gemacht.« Besorgt musterte er den Himmel. Viverrin beugte sich über die Reling und beobachtete die Wellen. Dann taxierte er die Wolken, die mit großer Geschwindigkeit auf die Fairbanks zurasten.
»Captain!«, rief er Skye von der Reling aus zu.
»Ja?« Skye registrierte, dass ihn Viverrin vor der Mannschaft mit Respekt behandelte.
»Ich würde vorschlagen, in diese Richtung zu segeln, soweit der Wind das zulässt.« Die Hand des Ichtyos zeigte in südliche Richtung. »Und zwar so schnell wie möglich.«
»Wir sollten lieber alle Segel einholen, bevor der Wind sie uns zerfetzt«, mahnte Jason.
»Wie kommst du darauf, Viverrin? Warum sollten wir gerade dorthin segeln?« Skye verfolgte den Blick des Ichtyos auf die sich aufschaukelnden Wellen. Erkennen konnte er nichts.
»Versuch es«, bekräftigte Viverrin. »Vielleicht genügen euch zwei bis drei eurer nautischen Meilen, dann kommt ihr aus der Gefahrenzone. Ich komme wieder, sobald ich mehr weiß. Beeilt euch.« Mit einem kühnen Sprung stürzte er sich vor den Augen der Männer Hals über Kopf in die Fluten.
Aus dem Ausguck kam ein erschrockenes »Mann über Bord«. Doch Skye winkte ab, als ein paar Männer mit einem Tau angelaufen kamen. »Er ist ein Ichtyo. Er weiß, was er tut. Und jetzt setzt jeden Fetzen Segel, den wir haben. Kurs Süd-Südwest, Mr Small.« Skyes Stimme war fest, wie die eines Captains sein sollte, der wusste, was er tat. In seinem Inneren sah es anders aus. Und Jason fasste seine Gedanken in geflüsterte Worte.
»Wenn wir unter Vollzeug nicht aus dem Sturm rauskommen, reißt uns der Wind alles in Fetzen. Und wenn wir das Wetter überleben, dann schaukeln wir hier auf hoher See vor uns hin, bis wir verdursten oder von unseren Jägern aufgespürt werden.«
Skye fasste seinen Freund fest ins Auge. »Wir müssen damit anfangen, Viverrin zu vertrauen.« Mit seinen Worten begann ein heftiger Regen auf die Fairbanks niederzuprasseln. Und Skye fiel siedend heiß ein, dass er Viverrin jetzt gar nicht mehr fragen konnte, wie es Juniya ging und wo sie jetzt war.
Juniya
Juniya wurde vor Langeweile ganz kribbelig. Die Stimmung an Bord der manövrierunfähigen Galeone Clara sank von Tag zu Tag. Obwohl die Männer schwer schufteten, gönnte ihnen Captain Cliff keine Pause. Cliff wollte das Schiff, koste es, was es wolle, wieder seetüchtig bekommen. Es blieb ihm gar nichts anderes übrig. Die schwer beschädigte Galeone dümpelte vor sich hin, sie waren meilenweit von der nächsten Insel entfernt, die Rettung bedeutet hätte. Das Trinkwasser ging langsam zur Neige und musste bereits rationiert werden, die Lebensmittel wurden knapp. Mittlerweile hatten die Matrosen immerhin schon einen Notmast aufgerichtet und aufgetakelt, sodass er wenigstens ein paar Segel tragen konnte. Bei entsprechendem Wind würde die Clara so vorwärtskommen, wenn auch langsam. Doch das Segeltuch hing wie leblos an den Rahen.
Heute regte sich kein Lüftchen, die Sonne brannte heiß auf die nackten Rücken der Matrosen, die die geborstene Reling wieder instand setzten und das Deck, so gut es ging mit dem wenigen Werkzeug reparierten. Juniya hörte Cliff immer öfter unbeherrscht herumschreien. Es ging ihm zwar besser, nur den verletzten Arm trug er noch in der Schlinge, aber seine Laune wurde mit jedem Tag mieser.
Pearly brachte Juniya einen Becher Wasser.
»Hier, Missy. Sieht so aus, als gibt’s morgen noch weniger.«
Dankbar nickte Juniya dem netten Mann zu, der sich von Anfang an hier an Bord um sie gekümmert hatte. Einer der anderen Matrosen kam von hinten und trat ihr den Becher grob aus der Hand.
»Warum gibst du dem Miststück von deiner Ration ab, du Idiot? Hast du es immer noch nicht begriffen, dass das Unglück an Bord ist, seit wir die da aufgegriffen haben?«
Pearly war einen guten Kopf kleiner als der rothaarige Matrose, der sich vor ihm aufgebaut hatte.
»Was ich mit meiner Ration tue, ist meine Sache«, stellte Pearly mit einer Sachlichkeit und Standhaftigkeit fest, die Juniya Respekt abnötigte. »Und was du mit deinem hinterwäldlerischen Aberglauben anfängst, ist deine Sache.« Bedauernd sah Pearly dem Becher hinterher. »Auf jeden Fall hast du gerade wertvolle Verpflegung mutwillig verschwendet. Muss ich leider dem Captain melden. Ich …«
Ohne Vorwarnung griff der Mann namens Alfred den kleineren Pearly an und versetzte ihm einen Faustschlag. Sofort entspann sich ein heftiger Kampf. Juniya sprang auf und wollte dazwischengehen, doch andere Männer eilten herbei und hielten sie fest. Dreist begrapschten sie Juniya und drängten sie mit ihren schwitzenden Körpern an die Wand des Kajüthauses. Juniya wurde eiskalt. Noch einmal ertrage ich es nicht. Sie spannte ihre Muskeln, um sich zu wehren. Eine Stimme zischte an ihrem Ohr.
»Halt schön still, Missy, wenn du willst, dass Pearly da lebend wieder rauskommt.«
Die kalte Spitze eines Messers stach sie zwischen ihren Schulterblättern. Juniya keuchte auf vor Zorn, doch sie hielt still, um zu sehen, was mit Pearly geschah. Ihr Freund hielt sich wacker. Der kleine Mann kämpft für mich. Er musste einen heftigen Hieb einstecken, der ihn auf die andere Seite des Decks schleuderte. Dieser widerliche Rothaarige lachte dreckig.
»Na, Kleiner, hast du genug?«
Pearly rappelte sich auf. »Ich frage mich«, keuchte er, »wie es ein Vollpfosten wie du auf dieses Schiff geschafft hat. Du Müllhaufen gehörst in die Steinzeit, aber nicht hierher.« Er riss einen Belegnagel aus seiner Halterung. »Und jetzt komm her, dass ich dich verprügeln kann wie einen Hund!«
Die Männer johlten vor Vergnügen über Pearlys Mut und feuerten ihn an.
»Du willst mich verprügeln?« Hohn troff aus den dahin gespuckten Worten. Plötzlich hatte der Rothaarige, ein Teil der Männer riefen ihn Fred, ein Messer in der Hand. »Dann versuch es doch!«
Heiser grölten die Matrosen Anfeuerungsrufe und bildeten einen Kreis um die Streithähne. Es ist ein ungleicher Kampf. Er will Pearly töten! Wo ist nur Captain Cliff? Juniya war abgelenkt gewesen, da einer der Kerle, die sie festhielten, seine Hände nicht auf ihren Armen hielt, sondern gierig ihre Brüste betatschte. Das war zu viel. Juniyas Zorn wallte auf, sie spürte ihre Energie und lenkte sie auf den Mann, der sie festhielt. Er ließ sie los, als hätte er sich verbrannt. Jetzt konzentrierte sie sich auf den Kampf. Pearly war es gelungen, dem ersten Messerhieb auszuweichen. Er kam mit seiner Schlagwaffe nicht weit genug an diesen Fred heran. Es sei denn …
Die Männer lachten schadenfroh, als Fred aus unerfindlichen Gründen das Messer fallen ließ und stolperte. Pearly nutzte diese Chance sofort. Mit einem hohlen Klonk sauste der Belegnagel seitlich an Freds Schläfe. Der Matrose kippte bewusstlos vornüber. Pearly richtete sich mit erhobenen Armen auf und ließ sich von den feixenden Männern feiern.
»Sonst noch wer?« Herausfordernd und mit breiter Brust grinste er die anderen an. »Missy Juniya ist genauso wenig …«
»Was ist hier los?«
Oh. Endlich. Ich dachte schon, er kommt nicht mehr.
Captain Cliff hatte wieder getrunken. Er wankte auf die Gruppe zu, sein Hemd hing schlampig aus dem Hosenbund. Die Männer sprangen trotzdem auseinander und nahmen Haltung an. Bis auf Alfred. Der lag stöhnend auf den Planken und kam wieder zu sich.
Die Männer, die Juniya festgehalten hatten, waren von ihr abgerückt.
»Pearly, Meldung machen!«, bellte Captain Cliff den kleinen Matrosen an.
»Fred und ich haben eine kleine Meinungsverschiedenheit zum Thema Aberglauben ausgetragen. Ich habe gewonnen«, fügte er grinsend hinzu.
»Ich dulde keine Kämpfe in meiner Crew. Ihr wisst das. Pearly und Fred, ihr habt 24 Stunden Arrest. Und du siehst zu, dass du unter Deck kommst, und du bleibst dort, bis ich dir gestatte, wieder raufzukommen!«, schnauzte er Juniya an.
»Warum soll ich in die stickige Kajüte? Ich bin doch …«
Eine schallende Ohrfeige traf ihr Gesicht und riss ihr den Kopf herum.
»Du Hexe!« Es war derselbe Mann, der sie vorhin betatscht hatte. Verschlagen linste er durch böse zugekniffene Augenlider. »Es gibt keine Widerrede gegen einen Befehl des Kapitäns, verstanden?« Großspurig baute er sich vor Juniya auf. Einer der Männer an der Reling lachte meckernd. »Zeig’s der Fotze, Curtiz!«, zischte ein anderer. Die übrigen Männer starrten sie nur finster an.
Juniya konnte sich kaum beherrschen. Was ist nur mit Cliff los? Warum lässt er das zu? Ihre Hände kribbelten. Am liebsten hätte sie zurückgeschlagen, diesen Mann in Grund und Boden geprügelt. Endlich griff Captain Cliff ein.
»Da sagt der Matrose Curtiz ein wahres Wort«, kam es leise und vor Spott triefend über seine Lippen. »Es gibt keine Widerrede gegen den Befehl des Captains.« Im nächsten Moment riss er eine Peitsche aus seinem Gürtel und zog sie dem Mann namens Curtiz so nahe neben Juniya über das Gesicht, dass sie den Luftzug der Peitschenschnur spürte und sich erschrocken duckte. Wimmernd ging der Mann zu Boden. Captain Cliff stand mit erhobener Peitsche über ihm und herrschte ihn an: »Für die Entscheidungen und die Strafmaßnahmen auf diesem Schiff bin immer noch ich zuständig. Hast du das kapiert, Matrose Curtiz?«
Hündisch zog der Mann den Kopf ein und nickte.
»Aye, Sir«, quetschte er zwischen den Zähnen hervor. Blut lief über sein Gesicht.
»Und wer bei drei nicht wieder an der Arbeit ist, der kriegt meine Peitsche ebenfalls zu spüren!« Captain Cliff mochte betrunken sein, aber sein brutales Auftreten war energisch genug, um die Rangordnung sofort wiederherzustellen. »Eins, zwei …«
Männer stoben auseinander. Cliffs erster Offizier führte Fred, der sich wieder hochgerappelt hatte, und Pearly ab und nahm auf einen Wink des Kapitäns auch Curtiz gleich mit. Der kleine Matrose zwinkerte Juniya noch schnell zu, dann fügte er sich in sein Schicksal.
»Und jetzt unter Deck mit dir, aber fix«, zischte Captain Cliff Juniya zu, als sie an ihm vorbeiging. »Und wag ja nicht, raufzukommen, bevor ich es dir erlaube!«
Juniya hätte sich am liebsten geschüttelt, so widerlich wehte ihr seine Alkoholfahne in die Nase. Aber sie beherrschte sich und gehorchte.
Ambiela
»Ich muss hier weg! Ich langweile mich zu Tode, wenn du nicht hier bist.« Ambiela hatte sich vorgenommen, Shaka nicht wieder fortzulassen, ohne ihn gründlich ausgehorcht zu haben. Wie schon bei den letzten Besuchen bei Ambiela in der Hauptstadt war ihr Liebesspiel eher in einen heftigen, schmerzhaft-süßen Kampf ausgeartet. Shaka war heute schweigsamer als sonst. Der Ichtyo lag angespannt auf Ambielas Bett und starrte an die Decke. Er hatte seine Uniform zum ersten Mal vollständig abgelegt. Eher von seinem gestählten Körper abgezogen. Ambiela schmiegte sich an ihn und betrachtete die immensen Muskelstränge. Seine Haut schimmert und ist mit einem eigenartigen Muster überzogen. Mit der Fingerkuppe zog sie eine der feinen, kaum sichtbaren Linien nach. Sofort schnappte seine Hand nach ihren Fingern.
»Lass das.«
»Weshalb?«
Sie ließ sich nicht beeindrucken. »Sind das Tätowierungen?« Sein ganzer Körper war mit diesen zarten Linien überzogen.
»Nein. So wurde ich geboren, und so werde ich sterben.« Er gab ihre Hand wieder frei.
»Diese Linien sind mir bei Kerrali gar nicht aufgefallen.« Noch einmal berührte sie seine Haut. »Au! Du tust mir weh!«
Schneller, als sie sehen konnte, war Shakas Hand um ihre Finger geschnappt, nur diesmal quetschte er sie schmerzhaft zusammen.
»Was ist los mit dir?«, fragte sie bissig und entzog ihm ruckartig ihre Hand. »Warum stört dich so ein bisschen Berührung so sehr?«
Shaka starrte in ihre Augen. »Kerrali ist tot. Erwähne ihren Namen nie wieder, Menschenfrau, oder ich vergesse mich.«
»Was?« Ambiela richtete sich auf. »Was ist denn geschehen? Warum erzählst du mir das nicht? So viele Tage warte ich auf die liebe K…« Ambiela schrie auf. Shakas Hand umklammerte ihre Kehle. Und er drückte zu.
Sie schnappte nach Luft, schlug auf seine Hände, trat um sich, versuchte, ihn zu treffen. Schreien funktionierte nicht. Schon nach wenigen Sekunden tanzten Sternchen vor ihren Augen, und sie hörte ihr Blut in den Ohren rauschen, die Lunge rang verzweifelt nach Atem. Ihr Überlebenswille war ungebrochen, und doch erlahmten ihre Arme und Beine, sie konnte Shakas Kraft nicht das Geringste entgegensetzen. Gerade als sie dachte, das war es jetzt, ließ Shaka unvermittelt los. Röchelnd robbte Ambiela von ihm fort. Ihr Hals schmerzte, jeder Atemzug brannte wie Feuer.
Sie war schockiert, mit welcher Kälte Shaka sie betrachtete. Als wäre ich ein Insekt, dem er ein Bein ausgerissen hat, um zu sehen, ob es noch laufen kann. Dabei hatte er eine gewaltige Erektion. Na warte. Mit eisernem Willen richtete Ambiela sich auf, ging zum Tisch und goss sich ein Glas Wasser ein. Das Schlucken tat weh, doch sie zuckte mit keiner Miene und hielt sich kerzengerade.
Dann drehte sie sich zu ihm um und starrte ihn wütend an. »Willst du mir mal erklären, was das gerade sollte? Machen dich meine Schmerzen noch geiler, als du ohnehin schon auf mich bist?«
»Ich hatte mir vorgenommen, dich zu töten. Dein Leben für Kerrali«, antwortete er ungerührt. »Doch ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es Verschwendung wäre. Du wirst mir weiterhin nützlich sein und mir helfen, Kerrali zu rächen.«
»Sag mir, was ihr zugestoßen ist«, forderte sie.
»Sie wurde von euch Seefahrern getötet. Grausam aufgeschlitzt ist sie vor euren Augen verblutet.«
Ambiela stellte sich den hübschen Körper Kerralis blutüberströmt auf dem Boden vor. Es berührte sie nicht sonderlich. Dennoch spielte sie Shaka Betroffenheit vor. »Ein Mord? Das ist ja furchtbar. Wer war es? Sie werden den Mann zur Rechenschaft ziehen.«
»Eines Tages werde ich das tun«, meinte Shaka im Brustton der Überzeugung.
An Selbstbewusstsein mangelt es dem Kerl jedenfalls nicht. Ambiela wollte nach ihrem Morgenmantel greifen. Sie traute ihren Ohren nicht, als er befahl: »Wage es nicht, etwas anzuziehen. Und jetzt komm her.«
Eine Stunde später war Shaka verschwunden. Ambiela saß wie gelähmt auf der Bettkante und verstand sich selbst nicht mehr. Ohne jede Widerrede, ja, ohne den geringsten Widerstand hatte sie Shakas Anweisungen befolgt, ihn zu befriedigen. Sie hatte sich unterworfen wie eine Sklavin. Und er hatte ihr auf jede erdenkliche Weise gezeigt, dass er ihr Herr war. Ich habe es geschehen lassen. Ambiela war entsetzt. Sie wusste nicht, ob sie sich gedemütigt oder glücklich fühlte. Es hat mir sogar gefallen. Seine Brutalität und seine Herrschsucht, ja sogar seine heftigen Stöße haben mir den besten Orgasmus beschert, den ich je hatte. Dieser Mistkerl. Ich bin geboren, um zu herrschen. Und nicht, um mich von einem Fischmenschen erniedrigen zu lassen. Dennoch war sie hin- und hergerissen von ihren zwiespältigen Gefühlen, lieber herrschen zu wollen oder sich bedingungslos zu unterwerfen.
Ambiela sog erschrocken den Atem ein, als ihr der Spiegel im Badezimmer die blauen Flecken am Hals zeigte, da, wo er sie gewürgt hatte. Sie brauchte noch eine ganze Weile, um sich zu beruhigen. Ihre Gedanken zu sortieren. Überhaupt nach dieser Nacht wieder einen klaren Gedanken zu fassen. Hinter einem losen Brett der Holzvertäfelung holte sie ihren Schatz heraus. Shakas Messer. Sie strich fast zärtlich darüber. Du bist meine Lebensversicherung. Mit dir werde ich mich an ihm rächen. Aber nicht heute. Ambiela hörte die Haustüre schlagen. Eleni kam zum Dienst. Und in Ambielas Kopf reifte ein Plan.
Juniya
Pearlys Arrestzeit endete, doch er kam nicht zu Juniya. Auch sonst niemand. Sie saß in ihrer Kajüte, starrte auf das Meer und langweilte sich. Sie bekam etwas zu essen und Wasser, das war es aber auch. Captain Cliff ließ sich nicht blicken. Es war wieder Nacht geworden. Ein winziger Windhauch hatte den Männern am Abend Mut gemacht, mit den Segelfetzen nahm die Clara etwas Fahrt auf. Juniya spürte an den Schiffsbewegungen, dass sich die Clara wenigstens langsam von der Stelle bewegte. Ein Matrose brachte ihr einen Kanten altes Brot.
»Wo ist Pearly?« Juniya wollte in Erfahrung bringen, wie es dem kleinen freundlichen Mann ging.
»Hat eins auf die Fresse gekriegt. Liegt in seiner Hängematte, schätze ich«, knurrte der Mann ihr zu.
Behutsam versuchte Juniya, in die Gedanken des Manns einzutauchen. Sinnlos. Cliff ist vorsichtig geworden. Er schickt mir nur Männer, die unlesbar sind. Offenbar kennen sie sich doch mit Telepathen aus.
»Ich will mit Captain Cliff sprechen. Kannst du ihm das ausrichten?«
Der Mann knurrte etwas. Juniya verstand nicht, ob es eine Zustimmung oder Ablehnung war. Die Tür ihrer Kajüte fiel ins Schloss. Sie hörte, wie sich der Schlüssel drehte. Verdammt. Jetzt schließen sie mich auch noch ein.
»Hey, was soll das?« Sie hämmerte gegen die Tür. Ein brummiges Lachen war die Antwort. Wütend und unruhig lief sie hin und her. Sie lauschte auf die Geräusche des Schiffs. Das Knarren der Planken und die Rufe der Mannschaft waren ihr schon vertraut. Langsam wurde es still an Bord, wie jede Nacht. Längst kannte Juniya jeden Winkel des kleinen Raums, hatte in alle Ecken gesehen und alles untersucht, was da zu finden war. Viel war es nicht. In einer Kleiderkiste fand Juniya einen großen schwarzen Schal und die Frauenkleider, von denen Pearly gesprochen hatte. In ihr reifte eine Idee.
Niemand bemerkte den schwarzen Schatten, der sich aus dem kleinen Fenster der Kajüte schwang und sich vorsichtig auf der schmalen Galerie des Hecks entlanghangelte.
Die Sonne brannte auch am nächsten Tag gnadenlos auf die Clara herunter, die leichte Brise war eingeschlafen. Captain Cliff hatte es Juniya erlaubt, für ein paar Stunden an Deck zu kommen. Er hatte ein Einsehen, denn unten in der Kajüte ging kein Luftzug, es war unerträglich stickig. Die Clara kam nicht vorwärts, die Segel hingen wieder die meiste Zeit schlapp herunter. Juniya hatte sich einen Platz im Schatten gesucht, ihre Beine baumelten über dem Rand des Decks, eine Strebe der Reling verhinderte ein Abrutschen. Aggressiv polterten die Männer herum, hielten aber weiten Abstand von ihr. Nicht einmal Pearly kam in ihre Nähe. Träge suchten Juniyas Augen immer wieder die Wasserfläche ab. Wo ist Viverrin nur? Ob er mich hier findet? Sie hatte beschlossen, sich beim ersten Anzeichen seines Auftauchens einfach ins Wasser fallen zu lassen. Aber weit und breit war keine Spur von einem Lebewesen zu sehen, geschweige denn Viverrins markante Rückenflosse.
Noch immer war Juniya aufgebracht und verwirrt. Und das lag am Ergebnis ihres nächtlichen Kletterausflugs über die Heckgalerie. Es war nicht schwer gewesen, bis vor das Fenster von Captain Cliffs Kajüte zu gelangen. Juniya hatte ihn zwingen wollen, mit ihr zu reden. Zumindest wollte sie seine Gedanken ausspionieren. Sicher war sie sich keineswegs, wie sie vorgehen sollte und welches die richtige Strategie im Umgang mit Captain Cliff war. Aus der Dunkelheit spähte sie vorsichtig durch das offene Fenster in seine Kajüte. Der schöne Captain hing sturzbetrunken über dem Sessel und schnarchte. Das Hemd zipfelte schlampig aus der Hose, die blonde Lockenpracht war fettigen Strähnen gewichen. Juniya zählte drei oder vier Weinflaschen. Eine davon hatte ihren dunkelroten Inhalt auf die Holzplanken ausgegossen und einen Fleck hinterlassen, der der Farbe von Blut sehr nahe kam.
Blut. Eine lose Idee geisterte gerade durch Juniyas Kopf, doch sie konnte sie nicht fassen. Ihre Gedanken wanderten zurück zu Captain Cliff. Warum betrinkt er sich nur so? In seinem Zustand, betrunken und schlafend, war es Juniya nicht möglich gewesen, in seine Gedanken zu gelangen. Ihr Ausflug war sinnlos. Vorsichtig kletterte sie zurück. Sie musste dabei am Kajütenfenster der Offiziersmesse vorbei. Mir blieb fast das Herz stehen, als einer der Offiziere das Fenster vor meiner Nase aufstieß. Um ein Haar hätte sie den Halt verloren und wäre ins Wasser gestürzt. Sie hatte die Luft angehalten, besseren Halt gesucht, um nicht ins Wasser zu fallen, und zwangsläufig die Männer belauscht …
Einer der Männer lachte mit einem boshaften Unterton. »Das einzig Gute an dieser Situation ist, dass er meistens zu besoffen ist, um uns über das Deck zu scheuchen. Aber wir müssen bald etwas unternehmen.«
»Was meinst du?«
»Die Notfallkammer. Ich frage mich, wie lange Cliff noch damit warten will. Es wird langsam brenzlig, und noch mehr Tote darf er nicht riskieren.«
»Für den Sturm kann er nichts.« Das ist doch Pearly? Was macht er in der Offiziersmesse?
»Klar konnte er nichts für den Sturm. Aber für diesen Kurs. Der liebestolle Hund hat uns auf Kurs Numinala geschickt, um dieses irre Miststück wiederzusehen. Die hat ihm so den Verstand aus dem Hirn gevögelt, dass unser schöner Captain nicht mehr klar denken kann.«
»Red leiser, Mann. Das Fenster ist offen. Er kann dich vielleicht bis nach nebenan hören.«
»Quatsch. Du warst doch gerade selber mit drüben, Pearly. Der ist voll wie eine Haubitze. In dieser Nacht hört der nichts mehr. Wir sollten ihn morgen dazu zwingen, die Notfallkammer zu öffnen. Und wenn er es nicht tut, dann setzen wir ihn ab und tun es selber.«
»Das ist Meuterei. Du weißt, was darauf steht.«
»Ach«, hörte Juniya den Offizier unwirsch auf Pearlys Einwand antworten. »was kann uns denn schon passieren. Aufgeknüpft wird auf diesem Planeten niemand wegen Meuterei. Sie ziehen uns höchstens ein paar Punkte ab. Ich bin schon so lang hier, dass mir das egal ist. Eigentlich habe ich sowieso die Schnauze voll. Ich …«
An Deck läutete die Glocke für den Wachwechsel. Fluchend verließen die Männer die Offiziersmesse. Als Juniya sicher war, dass sich niemand mehr hinter dem offenen Fenster befand, kletterte sie nachdenklich in ihre Kajüte zurück.
Juniya wusste einfach nicht weiter. Auf diesem Schiff fühlte sie sich wie unter einer Glasglocke. Nichts ging vorwärts, es gab keine Optionen, sie war darauf angewiesen, dass die Clara irgendwo landete und hoffentlich nicht beim nächsten Sturm versank. Am liebsten hätte sie zornig nach dem nächsten Balken getreten. Zorn und Wut waren in den letzten Tagen häufig über sie gekommen. Komisch. Wo so viele denken, ich wäre ein Mensch ohne Gefühle. Hab wohl doch welche, dachte sie mit Selbstironie. Ein Gepolter mittschiffs lenkte sie einen Augenblick ab. Ein paar Männer ließen eines der Beiboote zu Wasser. Aus den Gesprächsfetzen hörte Juniya heraus, dass sie fischen wollten. Die Nahrungsmittelvorräte auf der Clara waren lebensbedrohlich zusammengeschmolzen. Zwei Männer stiegen mit Angelruten in das Boot und ruderten ein paar Schläge vom Rumpf der Clara fort. Dann warfen sie die Leinen mit den Ködern ins Wasser.
Jetzt klingelte es bei Juniya. Blut! Vielleicht findet mich Viverrin, wenn ich ein paar Blutstropfen ins Meer fallen lasse. Er sagte doch, dass seine Leute mich dann finden! Juniya sah sich um. Wo kriege ich nur ein Messer her? Oder einen Spieß? Dort, wo das Beiboot ins Wasser gefiert worden war, lagen ein paar Netze. Ein Matrose arbeitete daran herum. Die meisten Männer lagen träge an schattigen Plätzen auf dem Deck. Ein paar beobachteten die Angler im Boot. Bisher tat sich nicht viel. Von Captain Cliff war nichts zu sehen. Juniya schlenderte an den Mann mit dem Netz heran.
»Kann ich was helfen?«
»Hast du gelernt, Netze zu knüpfen?«, knurrte er sie an.
»Ich kann es lernen. Die anderen können es ja offensichtlich auch nicht.«
Ein missmutiger, abschätziger Blick traf sie.
»Dann setz dich. Und schau gut zu.«
Mit einem kleinen Metallhaken prüfte er das Netz. Flink wanderte der Haken zwischen den Knoten hin und her.
»Das lernt man nicht so schnell«, meinte er.
»Lass es mich doch wenigstens mal versuchen. Hast du noch so einen Haken?«
Der Mann drückte ihr ein kleineres Werkzeug in die Hand.
Juniya lachte stumm in sich hinein, als er sprachlos zusah, wie sie anfangs noch etwas langsam, von Knoten zu Knoten aber immer flinker das Netz prüfte und löcherige Stellen gekonnt zusammenknüpfte. Wie sinnvoll, dass ich mir mit meinen telepathischen Fähigkeiten alle notwendigen Informationen aus deinem Gehirn holen kann. Dieser Matrose war leicht und gefahrlos zu lesen. Nach einer Weile nahm er das Netz.
»Es reicht jetzt. Die brauchen es unten.«
Dass Juniya sich den spitzen Knüpfhaken einsteckte, bemerkte er nicht. Au! Tut mehr weh, als ich dachte. Die Spitze des Knüpfhakens riss eine kleine Wunde in Juniyas Handgelenk. Sie hielt die Hand wie zufällig über die Reling und sah hinterher, wie ein paar ihrer Blutstropfen ins Wasser fielen.
Der Netzknüpfer kletterte gerade an der Bordwand hinunter und machte sich daran, in das Boot zu steigen. Die beiden anderen waren damit beschäftigt, das Beiboot möglichst nahe an den Schiffsrumpf zu manövrieren.
Was schreit er da? Juniya hob den Kopf.
»Achtung, Jungs, da kommt was auf euch zu! Ich seh einen Schatten im Wasser. Muss ein ziemlicher Brocken sein.«
Die Männer an Bord wurden munter. Sie kamen an die Reling. Auch Juniya sah den Schatten. Ein großes Tier. Ihr Herz schlug heftig. Das könnte Viverrin sein! Ob ich gleich springen soll? Sie erhob sich schnell und lehnte sich weit über die Reling, um das Tier sehen zu können. Ein Raunen rollte über das Deck. Die Matrosen kamen neugierig heran. Auch sie hatten den Schatten bemerkt, der auf das Beiboot zuschwamm, um dann abzudrehen und es zu umrunden. Einer der Männer im Boot schnappte sich einen schweren Enterhaken und beugte den Oberkörper suchend über das Wasser.
»Komm her, Fischchen, wir haben dich gleich!«, ulkte er. »Wo ist er? Seht ihr von oben, von wo …«
Der Angriff erfolgte schnell und ohne Vorwarnung. Ein grauweißes Monster schnellte mit aufgerissenem Maul aus der Tiefe. Wasser brodelte schäumend um das kleine Boot. Entsetzt sahen alle an Bord zu, wie sich das Maul des riesigen Hais um den Oberkörper des Matrosen schloss und mehrere Reihen spitzer Zähne den Mann mittendurch hackten. Das gewaltige Tier ließ sich zurückfallen und war im Nu in der Tiefe verschwunden. Im Boot blieb nur der Unterleib des Seemanns zurück, seine Beine zappelten für einen Augenblick skurril, dann herrschte grauenvolle Stille. Wie gelähmt schauten seine Kameraden auf die Reste des Manns.
»Was zur Hölle war das?«
Captain Cliff war an der Reling aufgetaucht. »Holt das Beiboot ein, macht schon! Ihr da unten: Längsseits rudern!«, schrie er seinen Befehl nach unten, doch die beiden Matrosen im Boot waren im Schock wie gelähmt.
»Ihr müsst ein Stück ranrudern!« Die Männer wurden munter und riefen wild durcheinander. Das Entsetzen war dem Willen gewichen, die Kameraden zurück an Bord zu holen. Auch die beiden im Boot erwachten aus ihrer Schockstarre. Hektisch rudernd kamen sie näher an das Schiff heran.
Juniya warnte: »Schneller! Er kommt zurück!«
Die Matrosen blickten sich panisch um. Da schoss der Hai schon aus der Tiefe, seine riesigen Kiefer krachten in das Holz. Die Planken des Beiboots zersplitterten zwischen seinen Zähnen, als wären es Zahnstocher. Ein unmenschlicher Schmerzensschrei gellte über das Wasser. Mitsamt den Bootsplanken hatte das Monster ein Bein des Matrosen abgerissen. Er klammerte sich schreiend an das Bootswrack. Sein Blut färbte das Wasser. Der zweite Mann im Boot umklammerte kreideweiß die Ruderpinne, vor Schreck unfähig, sich zu bewegen. Einer der Männer auf der Clara kletterte an der Bordwand hinunter und warf dem Boot ein Netz zu. Mit einer Hand klammerte sich der Verletzte daran. »Wir holen dich rauf, halt aus!« Zwei weitere Männer kletterten hinunter, um zu helfen. Sie zogen das Netz an die Bordwand und hievten den Verletzten aus dem Wasser. Das zersplitterte Beiboot lief voll und begann zu sinken.
Juniya wusste es vor den anderen. Er lässt ihnen keine Chance. Wieder brodelte das Wasser. Die Männer schrien in Todesangst, blankes Entsetzen im Blick. Der Hai schoss aus der Tiefe und sprang ihnen entgegen. Der mächtige glänzende Körper schnellte aus dem Wasser. Aufgerissen drohte das blutige Maul mit Tod und Verderben. Die kleinen schwarzen Augen hatten ihr Ziel anvisiert, messerscharfe Zähne gruben sich in den Verletzten und zogen ihn mitsamt dem Netz und den Matrosen, die helfen wollten, in die Tiefe. Der letzte Mann im Boot, derjenige, dem Juniya mit dem Netz geholfen hatte, klammerte sich an die Bootsreste und zappelte panisch.
»Holt mich raus! Holt mich doch hier raus!« Kreischend schnappte seine Stimme über. Doch das rettende Tauende erreichte er nicht mehr. Aus dem blutigen Wasser schnellte die Bestie ein letztes Mal hervor und zog ihn mit den Kiefern schnappend ins Wasser. Alle konnten nur ahnen, welches Drama sich unter der rot schäumenden Wasseroberfläche abspielte.
An Bord herrschte fassungsloses Entsetzen. Das Einzige, was von den Matrosen noch zu sehen war, waren die schaurigen blutigen Schlieren im Wasser. Wie ein Spielzeugball schnellte nun ein Kopf an die Wasseroberfläche, um alle Menschen an Bord zu verhöhnen. Als grausiger Beweis für das entsetzliche Drama schaukelte er auf den Wellen vor sich hin.
Erschüttertes Schweigen hing in der Luft. Bis einer der Männer zu sich kam. »Die war das! Die Hexe hat das Monster gerufen!«
Damit hatte Juniya nicht gerechnet. Der Matrose namens Alfred packte sie an den Haaren und schleifte sie brutal vor Captain Cliff. Er zwang sie mit seinem ganzen Gewicht auf die Knie. Wie von Sinnen schrie er immer wieder: »Die Hexe hat das Monster gerufen! Ich hab es gesehen. Sie hat sich geritzt und das Monster mit ihrem Blut angelockt!«
Juniya fiel gegen eine große Taurolle. Schläge und Tritte prasselten auf sie nieder. Sein Hass riss Juniyas Seele in einen Abgrund der Angst. Todesangst. Die Bilder ihrer Ankunft stiegen in ihr auf. Hilflosigkeit. Demütigung. Gewalt. Schmerz. Und alle anderen standen herum und sahen mit wutverzerrten Gesichtern zu. In Juniyas Kopf machte es Klick. Nie wieder schlagt ihr mich. Zorn. Unbändiger heißer Zorn wallte in einer Flutwelle durch ihren Körper. Sie erinnerte sich: Ich kann mich wehren. Viverrin hat es mir beigebracht. Juniyas Handflächen begannen zu kribbeln, ihr Körper spannte sich, sie wehrte die ersten Schläge ab. Nahm mit jedem seiner Treffer den Hass des Manns in sich auf. Fühlte, wie sich eine Ladung an Energie aufbaute, die ihr ihren Mut zurückgab. Wieder schlug er mit den Fäusten nach ihr. ES REICHT! Juniyas Zorn brannte wie Feuer in ihren Adern. Sie duckte sich unter dem nächsten Schlag weg, wie Viverrin es ihr beigebracht hatte, und packte seinen Arm. Der Mann ging in die Knie und schrie wie am Spieß. Juniya stand über ihm, starrte in sein Gesicht. Als gäbe es weder Kopfhaut noch Knochen, sah sie sein Gehirn plötzlich vor sich. Es pulsierte wie sein Herz. Juniya labte sich an seinem Schmerz und seinem Hass, spürte, wie sie stärker wurde, ihn bezwang. Ich gebe dir alles zurück, was du mir antust! Energie war es, die in ihr brodelte. Reine zerstörende Energie, die nichts brauchte als ein Ventil. Juniyas Handflächen brannten. Sie ließ in ihrem Zorn ihrer Intuition freien Lauf. Die Wut floss in ihre Fingerspitzen, und von dort in den Feind. Rot war die Farbe, die Juniya wahrnahm. Rot wie das Blut im Wasser. Der Kerl vor ihr begann zu wimmern. Sie packte seinen Kopf an den Schläfen und starrte ihn an wie ein ekelhaftes Gewürm. Sein Gehirn begann sich vor ihren Augen - unsichtbar für alle anderen - zu verfärben. Die Äderchen platzten. Juniyas brennende Hände verwandelten das Organ in eine breiige blutende Masse. Ein wahnsinniges Heulen drang an ihre Ohren. Dann war der Mann endlich still.
Wie aus einem Rausch kam Juniya zu sich. Sie stand an Deck, die Männer starrten sie mit entsetzten Gesichtern an. Wie durch Watte hörte sie die heisere Stimme Captain Cliffs.
»Schluss jetzt! Auseinander!« Seine Pistole zielte auf ihren Kopf. Juniya ließ den Kopf des Matrosen los. Alfred fiel leblos vor ihr zu Boden.
»Pearly, schaff sie ins Kabelgatt. Und wenn sie sich wehrt, erschieß sie.«
Captain Cliffs Befehl ließ Juniya das Blut in den Adern gefrieren. Er sperrt mich wieder ein! Sie wollte protestieren, ihn bitten, es nicht zu tun. Doch die Männer um sie herum hatten eine Mauer gebildet.
»Sie ist eine Mörderin. Wir sollten sie an der nächsten Rah aufhängen. Jetzt gleich.« Einer sprach es voller Hass aus und viele andere nickten. Doch Cliffs Pistole wanderte von ihrem Kopf zum ersten Matrosen, der so gesprochen hatte. »Niemand entscheidet hier, außer mir.« Mit einem Klacken entsicherte er die Pistole. Der Mann, auf dessen Stirn er zielte, wurde bleich. »Hat mich jeder hier verstanden?«
»Aye, Captain!«, presste er durch die Zähne.
Juniya hörte »Komm Missy, aber schnell. Ich bring dich runter.« Es war Pearly. Er nahm ihren Arm, und Juniya ließ sich willenlos mitziehen.
Skye
Die Männer legten sich ins Zeug wie niemals zuvor. Skyes Schiff ächzte, der starke Wind legte die Fairbanks weit über, doch sie kam stampfend in die Richtung voran, die Viverrin ihnen gewiesen hatte. Jason und Skye trieben die Matrosen zu Höchstleistungen an, um die Segel in den Griff zu bekommen. Allein drei Mann standen am Steuerrad und trotzten dem gewaltigen Druck, den die Strömung auf das Ruder ausübte. Von einem Moment zum anderen, als hätten sie eine unsichtbare Barriere überquert, ließ der Wind nach. Die Wellen peitschten noch immer gegen das Schiff, doch die größte Heftigkeit des Sturms war vorüber.
»Schau mal nach achtern. Das glaubst du nicht«, brüllte Jason in Richtung Skye, denn der Wind heulte immer noch laut und brachte die Taue der Takelage zum Singen. Skye drehte sich um. Die Wolkenwalze bewegte sich weiter, nunmehr aber hinter der Fairbanks vorbei. Das Schiff war in Sicherheit.
»Holt die Royals ein! Wir können Fahrt wegnehmen. Wir sind außer Gefahr!« Zuversichtlich gab Skye seine Kommandos.
Das Schiff rollte schwer, und die Fairbanks tauchte immer noch in tiefe Wellentäler, doch mit zunehmender Wegstrecke beruhigte sich das Wasser. Gebannt starrten die Männer auf den Sturm in ihrem Rücken. Skye enterte die Wanten des Hauptmasts ein Stück auf. »Der Sturm scheint in einer Art Kanal vorwärtszuziehen. Man kann den Rand des Unwetters genau erkennen«, sprach er mehr zu sich selbst.
Jason war zu ihm heraufgekommen. »Wie kommt das nur zustande? Kein normales Wetter bewegt sich in einer so klar definierten Bahn. Und wenn, dann sind zumindest die Randbereiche diffus. Ich habe noch nie einen Sturm gesehen, der sich so linear vorwärtsbewegt. Spiralen sind normal, aber doch nicht das hier.«
Auf einer Länge von geschätzten zwei bis drei Meilen zog das Sturmband hinter der Fairbanks vorbei. »Der Sturm wird den Hafen von Helios Bay treffen. Gar nicht schlecht. So kann uns Beard so schnell nicht nachkommen«, freute sich Jason. Skye allerdings machte sich Sorgen um Admiral Parker. Er und sein schönes Flaggschiff hatten einen Sturm im Hafen nicht verdient. Aber zuerst mal muss ich mich um uns kümmern. Skye klappte energisch das Fernglas zusammen und sprang schwungvoll zurück an Deck. »Was sagt das Schiff, Mr Small?«
Der erste Maat lachte. »Die Lady gehorcht einwandfrei, der Druck auf das Ruder hat nachgelassen. Captain, sollen wir den Kurs beibehalten?« Skye bestätigte. »Halten Sie Kurs, Mr Small, bis ich mit Mr Bonney wieder an Deck bin. Komm«, eine Handbewegung lud Jason ein, ihm zu folgen. In seiner Kajüte stapfte Skye auf und ab.
»Was heckst du aus?« Jason hatte sich auf der Seekiste niedergelassen. Selbst er wurde ungeduldig und wartete darauf, dass Skye endlich anfing zu reden.
»Viverrin hatte recht«, begann er. »Er wusste, wie sich der Sturm verhält, und hat uns in Sicherheit geschickt.«
»Hm. Immerhin ist er hier der Eingeborene. Vielleicht sind diese Wetterphänomene für diesen Ozean typisch, und wir haben es nur noch nicht bemerkt?«
Skye winkte ab. »Egal, was das ist, ein bloßes Wetterphänomen kann es nicht sein. Das widerspricht sämtlichen wetterphysikalischen Erfahrungen. Viverrin war auch beunruhigt, das hab ich genau gespürt.« Skye schnappte sich einen Stift und das Lineal. »Schade, dass wir nicht auf Satellitenbilder zurückgreifen können. Ich zeichne den Sturmverlauf mal in die Karte.« Er legte das Zeichengerät an und stutzte. »Hast du vorhin hier was eingetragen?«
Jason beugte sich vor. »Nein. Was soll ich eingetragen haben?«
Skyes Finger tippten auf eine Stelle der Seekarte. Dort befand sich eine kleine Inselgruppe mit einer wild zerklüfteten Küstenlinie. Die Inseln lagen nicht allzu weit von der Hauptstadt Numinala entfernt. »Na hier. Du hast eine Bucht markiert.«
Jason beugte sich über die Stelle. »Ich war das nicht. Wir waren dort noch gar nicht.« Die beiden sahen sich an. »Ich bin sicher, vorhin war da noch keine Markierung.«
»Dann muss es Viverrin gewesen sein. Er hat vorhin als Letzter die Kajüte verlassen, als Small uns hochrief.« Skye besah sich die Markierung genauer. »Die Inselgruppe hatten wir Coral Islands getauft. Viverrin hat das durchgestrichen und Sieben Schwestern darüber geschrieben. Ein bisschen krakelig zwar, aber lesbar.«