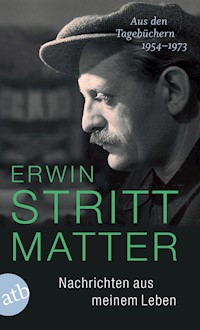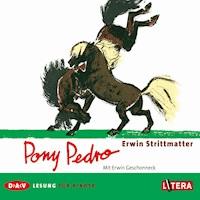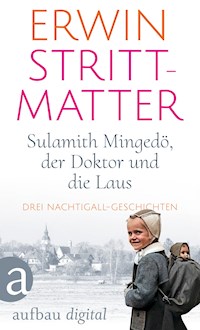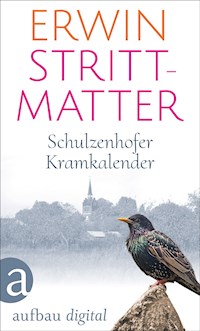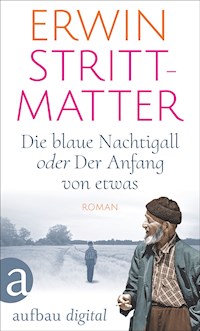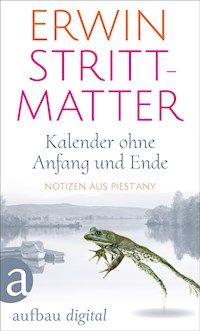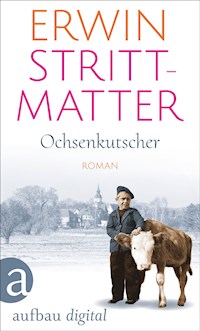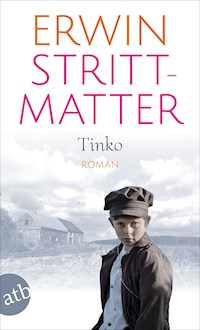7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erwin Strittmatter als Pferdeflüsterer.
Endlich steht das Pony im Stall. Ein kleiner, flinker Brandfuchs. Sein neuer Besitzer ist ein Schriftsteller, dem die Stadt zu eng wurde. Denn Pedro sollte es sein, dieses fellbespannte Bündel Energie, das die jahrelang unterdrückte Pferdeleidenschaft des Schriftstellers entzündete. Nun müssen sie sich aneinander gewöhnen, was nichts anderes heißt, als voneinander zu lernen.
Erwin Strittmatter, der sich wie kein zweiter auf Worte und Pferde versteht, "übersetzt" uns Pedros Verhalten: Es geht um Erfahrungen. So vermittelt diese wunderschöne Pferdegeschichte auch die Achtung vor allem Lebenden, eine der tiefsten Wurzeln Strittmatterscher Poesie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Erwin Strittmatter als Pferdeflüsterer.
Endlich steht das Pony im Stall. Ein kleiner, flinker Brandfuchs. Sein neuer Besitzer ist ein Schriftsteller, dem die Stadt zu eng wurde. Denn Pedro sollte es sein, dieses fellbespannte Bündel Energie, das die jahrelang unterdrückte Pferdeleidenschaft des Schriftstellers entzündete. Nun müssen sie sich aneinander gewöhnen, was nichts anderes heißt, als voneinander zu lernen.
Erwin Strittmatter, der sich wie kein zweiter auf Worte und Pferde versteht, »übersetzt« uns Pedros Verhalten: Es geht um Erfahrungen. So vermittelt diese wunderschöne Pferdegeschichte auch die Achtung vor allem Lebenden, eine der tiefsten Wurzeln Strittmatterscher Poesie.
Über Erwin Strittmatter
Erwin Strittmatter wurde 1912 in Spremberg als Sohn eines Bäckers und Kleinbauern geboren. Mit 17 Jahren verließ er das Realgymnasium, begann eine Bäckerlehre und arbeitete danach in verschiedenen Berufen. Von 1941 bis 1945 gehörte er der Ordnungspolizei an. Nach dem Kriegsende arbeitete er als Bäcker, Volkskorrespondent und Amtsvorsteher, später als Zeitungsredakteur in Senftenberg. Seit 1951 lebte er als freier Autor zunächst in Spremberg, später in Berlin, bis er seinen Hauptwohnsitz nach Schulzenhof bei Gransee verlegte. Dort starb er am 31. Januar 1994. Zu seinen bekanntesten Werken zählen sein Debüt »Ochsenkutscher« (1950), der Roman »Tinko« (1954), für den er den Nationalpreis erhielt, sowie die Trilogie »Der Laden« (1983/1987/1992).
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Erwin Strittmatter
Pony Pedro
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Die Stadt wurde mir zu eng
Kate, Quecken und Katzenpfötchen
Was der Heuduft bei mir anrichtete
Mutter Duduleits Telefon
Als ich Pedro zum ersten Mal sah
Weshalb ich ein schlechter Pferdehändler war
Wie mich der Aberglaube überfiel
Der Pferdekauf
Die Hengstparade
Rückwärts ins Dunkel
Ich werde ein Frachtstück
Der Mann mit dem Kaiserbart
Weshalb ich Blumen bezahlen musste
Traktor und Pferdefloh
Die Strickbremse
Pferdenarren
Pedro macht einen Kürbis zum Fußball
Die Ponyschule
Die naschhafte Ziege
Pedro lernt arbeiten
Pferdegespenster
Pedro verliebt sich in eine Lokomotive
Der Apfeldieb
Weshalb Pedro Nichtraucher blieb
Die Welt hat keine Risse
Die glühenden Pantoffeln
Vornehmer Besuch
Wie ich ein Zirkus wurde
Der Mondwagen
Pedro spuckt Geldstücke
Pferdeerfahrungen
Christa auf der Krippe
Das Eberholz
Das Silberpferd steht im verschneiten Wald
Das Pony-Karussell
Was mir Pedro erzählte
Galopp wider Willen
Pedro schwitzt beim Schlittern
Der Teufel auf Nachbars Hof
Das Telefon der Pferdemänner
In der Falle
Pedro wird ein Pferdebräutigam
Ein Zentaur geht durch den Wald
Das verzogene Stutenfräulein
Der Teufel dringt durch die Wand
Noch kleinere Pferde
Was ich bei einem Hengstkampf lernte
Die Pferdehochzeit
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne...
Meiner Mutter
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Die Stadt wurde mir zu eng
Kate, Quecken und Katzenpfötchen
Was der Heuduft bei mir anrichtete
Mutter Duduleits Telefon
Als ich Pedro zum ersten Mal sah
Weshalb ich ein schlechter Pferdehändler war
Wie mich der Aberglaube überfiel
Der Pferdekauf
Die Hengstparade
Rückwärts ins Dunkel
Ich werde ein Frachtstück
Der Mann mit dem Kaiserbart
Weshalb ich Blumen bezahlen musste
Traktor und Pferdefloh
Die Strickbremse
Pferdenarren
Pedro macht einen Kürbis zum Fußball
Die Ponyschule
Die naschhafte Ziege
Pedro lernt arbeiten
Pferdegespenster
Pedro verliebt sich in eine Lokomotive
Der Apfeldieb
Weshalb Pedro Nichtraucher blieb
Die Welt hat keine Risse
Die glühenden Pantoffeln
Vornehmer Besuch
Wie ich ein Zirkus wurde
Der Mondwagen
Pedro spuckt Geldstücke
Pferdeerfahrungen
Christa auf der Krippe
Das Eberholz
Das Silberpferd steht im verschneiten Wald
Das Pony-Karussell
Was mir Pedro erzählte
Galopp wider Willen
Pedro schwitzt beim Schlittern
Der Teufel auf Nachbars Hof
Das Telefon der Pferdemänner
In der Falle
Pedro wird ein Pferdebräutigam
Ein Zentaur geht durch den Wald
Das verzogene Stutenfräulein
Der Teufel dringt durch die Wand
Noch kleinere Pferde
Was ich bei einem Hengstkampf lernte
Die Pferdehochzeit
Impressum
Die Stadt wurde mir zu eng
Ich bin unter großen Waldwinden, im Sonnengedröhn hoher Sommertage, im ätzenden Feldfrost und bei verschwenderischen Frühlingen aufgewachsen. In meinen Kinderkorb guckten Kühe. Meine ersten Anzüge, die Windeln, waren in die Sprühtröpfchen schnaubender Pferde gehüllt.
Es fügte sich in meinem hartbunten Leben, dass ich mit vierzig Jahren in der modernsten Straße unserer Hauptstadt zu wohnen kam. Unten auf der breiten, zweiteiligen Straße rasselten die Autos, während ich hoch oben im sechsten Stock ein Buch über den schweren Anfang der neuen Bauern nach dem großen Kriege schrieb. Ich wurde inne, dass meine Landsehnsucht in dieses Buch floss.
Ein Schriftsteller kann nicht unausgesetzt schreiben, diskutieren und Kunst genießen. Er muss die unsichtbaren Schränke, aus denen er den Rohstoff für seine Arbeit nimmt, mit neuen Erlebnissen füllen. Bei mir kam das Verlangen nach körperlicher Arbeit hinzu. Ich schleppte Erde von den Bauplätzen in meine Stadtwohnung. Auf dieser Erde siedelte ich eine Menge Zimmerpflanzen an. Ich hielt einen Hund, eine Katze, doch die Sehnsucht nach dem Landleben nahm damit nur zu. Die großartigen Blumen- und Rasenanlagen in unserer Straße söhnten mich nicht aus. Die Stadt wurde mir zu eng. Ich fühlte den Tag kommen, an dem ich nicht mehr würde schreiben können.
Kate, Quecken und Katzenpfötchen
Als die Honorare für mein neues Buch eingingen, wähnte ich mich reich und kaufte ein Häuschen in einem abseitigen Dorf zwischen Wäldern und Seen.
Durch diesen Kauf wurde ich arm an geldlichen Mitteln, doch reich an Rohstoff für meine Schriftstellerwerkstatt. Auf dem Dorfe kennt jeder jeden. Die Lebenswege der Menschen liegen vor dir ausgebreitet. Du kannst verfolgen, ob sich deine Nachbarn vor dem, was sie Schicksal nennen, ducken oder ob sie ihr Leben in die Hände nehmen und das Scheingotteskind Schicksal entmachten.
Mein Haus auf dem Lande ist kein Landhaus. Unter uns gesagt: Es ist eine Kate. Kein Mensch im Dorf wollte sie kaufen. In den Lehmwänden dieser Kate heckten die Flöhe. Das Scheunendach war eingebaucht, das Gebälk des Dachstuhls morsch, und die Ziegel waren mürb. In den ersten Nächten, da ich auf dem Heulager schlief, konnte ich durch die Löcher des Scheunendachs siebenhundertundachtundvierzig Sterne zusammenzählen. An die Giebelwand der Scheune war ein anderes Häuschen geklebt, ein Vogelhäuschen. Die einzige Sitzgelegenheit darin hatte ein rundes Loch. In der Stadt ist sie aus Porzellan. Keramik sagt man auch dazu.
Zum Häuschen gehört etwas Land. Das Land ist schlecht. Nicht einmal den Freunden von der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, denen sonst mancherlei zugemutet wird, verdachte man es, als sie das Land nicht nehmen wollten: acht Morgen gelber Sand, drei Morgen Moorwiese, ein Morgen Garten.
Die Leute ringsum nennen das Brachland hinter meinem Häuschen – den Kiesberg. Einer meiner Vorgänger hatte den Einfall, diesen Kiesberg fuhrenweise zu verkaufen. Er erntete nichts als Gelächter. So erntete er auf dem Sand wenigstens etwas. Nur gut, dass es mit dem Kiesverkauf nicht klappte, sonst lägen jetzt hinter meinem Häuschen acht Morgen Loch. Ein Berg ist mehr als ein Loch. Für Augen mit Goldrändern gibt’s keine Armseligkeit in der Natur. Mein Kiesberg strengt sich im Frühling an wie alles hier ringsum. Im Vorsommer bringt’s der Kies sogar zu Blumen. Im Juli stehn auf meiner Brache die schönsten Katzenpfötchen. Sie sind so still und gelb, so katzenweich und so beständig. Wo ein günstiger Wind etwas Mutterboden anwehte, wächst auf meinem Kiesberg die Quecke. Sie ist mir nicht mehr so unsympathisch, seit ich weiß, dass sie imstande ist, Ähren zu tragen. In der Sowjetunion hat man sie mit Weizen gekreuzt. Wer weiß, vielleicht sind alle Unkräuter zur Nützlichkeit zu erziehen, wenn man’s richtig anpackt.
Was der Heuduft bei mir anrichtete
Wir schnitten auf unseren Moorwiesen das Grummet und trockneten es auf Reutern.
»Wat solln die kleinen Heuhäuschen nu?« fragte die Bäuerin Ziegenspeck aus dem Dorf. Ihr Mann erklärte es ihr: »Dat sin Stadtleut. Se denken, dat Heu muss hoch und vornehm upp einen Dach gedrögt werden.« Danach lachten die beiden Ziegenspecks unverschämt.
Zuletzt lachten wir. Es regnete viel diesen Spätsommer. Unser Reuter-Heu kam hellgrün, locker und zart in die Scheune. Der Heuduft erregte mich. Ich ging in den alten Pferdestall und fegte die Spinnweben von der Krippe. Eine Leidenschaft, die ich jahrelang unterdrückt hatte, packte mich.
»Ein Pferd muss her!« sagte ich.
Meine Frau ist klug. Sie behandelt mich wie einen großen Jungen. Ein kleiner Junge kann zur Not auf einem Stock reiten, schnauben, wiehern, hü und hott rufen, Pferd und Kutscher in einer Person sein. Ein großer Junge muss ein richtiges Pferd haben.
»Hol dir ein kleines, ein geschecktes Zirkuspferd«, sagte meine Frau. Ich umarmte sie.
Mutter Duduleits Telefon
Ich konnte nicht warten, bis ein Zirkus in unser Walddorf kommen würde. Hierher verirrt sich keiner. Meine Pferdeleidenschaft aber gab sich nicht mehr mit einem leisen Pochen zufrieden. Sie feuerte nach allen Seiten aus. Eines Tages las ich eine Anzeige in der Bauernzeitung.
Ich radelte ins Dorf. Den Posthalterdienst versieht Mutter Duduleit. Sie versieht ihn seit dreißig Jahren. Sie ist streng. Die Post ist gewissermaßen ihr angestammtes Eigentum. Mutter Duduleit hatte nicht die beste Laune. Es war keine Telefonierzeit. Telefonierzeit ist nur morgens und nachmittags, wenn das Postauto kommt, eine Weile. Es sei denn, deine Kuh wird krank, es brennt, oder eine Wöchnerin benötigt die Hebamme. Nichts davon war bei mir der Fall. Ich kramte all meine Freundlichkeit aus den Herztaschen.
»Bitte recht höflich ausnahmsweise um ein Telefongespräch. Es handelt sich um ein Pferd.«
Mutter Duduleit gab den Weg frei. »Is dat Peerd krank?«
»Noch nicht«, sagte ich und wählte bereits am Apparat. Es tütelte im Hörer, und die ersten fünf Minuten von der Viertelstunde, die das Amt benötigt, um sich zu melden, waren verstrichen. Mutter Duduleit kniff ein Auge zu und musterte mich ein wenig verächtlich von der Seite. »Hest du überhaupt een Peerd?«
»Es ist so gut wie unterwegs«, log ich. Mutter Duduleit wollte wieder was fragen, da meldete sich glücklicherweise das Amt. Die alte Posthalterin wagte nicht, weiterzureden. Das Postamt in der Kreisstadt ist für sie die höchste amtliche Stelle in der Republik.
Im Hörer mummelte das Fräulein vom Kreispostamt mit einem Mund voll Frühstücksbrot: Man werde mich wiederrufen, wenn die Verbindung hergestellt sei. Ich fürchtete Mutter Duduleits Fragen und behielt den Hörer am Ohr. Mutter Duduleits Blicke brannten mir Löcher ins Rückenteil der Lederjacke. Endlich bekam ich Verbindung mit dem Verkäufer des Ponys in einem mecklenburgischen Städtchen. Eine Frau sprach. Der Chef sei nicht da. Das Pony sei, soviel sie wisse, noch nicht verkauft. Ich könne ja kommen. Ansehen koste nichts.
Mutter Duduleit kassierte die Gebühren, leckte den Bleistiftstummel an, schrieb das Gespräch ein, ächzte bei jedem Buchstaben und zischte mir aus dem Mundwinkel zu: »Dat war dat letzte Mal außer der Telefonierzeit, segg ick dir!«
Und es war das erste Mal, dass ich für mein Pony log.
Als ich Pedro zum ersten Mal sah
Auf dem Hofe des Ponyverkäufers kreischte eine Kreissäge, eine Hobelmaschine seufzte dazu. Holzduft ringsum.
»Eine Tischlerei?«
»Ein Beerdigungsinstitut, Herr.«
Und da sah ich sie schon: Särge, Särge … Särge, jene kleinen Stuben für die Reise ins Unbekannte.
»Ich will den Ponyhengst sehn.«
Der Meister brachte mich in den Stall. Dort war es dunkel. In meinem Eifer rannte ich zu einem Verschlag aus schön gehobelten Kiefernbrettern. Was war das? Ich hielt mir die Nase zu. Im Verschlag lag der zottelköpfige Ziegenbock des Meisters. Das Pferd stand auf der anderen Stallseite. Was für ein kleiner, flinker Brandfuchs! Der Bocksgeruch störte mich nicht mehr. Ich betätschelte und beklopfte das Pferdchen, hob ihm die Beine hoch, befühlte die Fesseln, kratzte an den Hufen. Im Pferdemaul standen die Zähne gleichmäßig wie die Körner im Maiskolben. Ich las an ihnen den Geburtstag des Tieres ab. Auf einmal war ich kein Stadtmensch mehr. Ich war wieder der Junge, der dem Großvater auf dem Pferdemarkt ein billiges Arbeitspferd kaufen hilft. Ich war der Pferdepfleger von einst, der aus struppigen Weidefohlen ansehnliche Traber, Reit- und Wagenpferde macht.
Der kleine Hengst – wie er den Kopf hob! Wie er wissen wollte, wer ich wäre! Das war kein Struppkerl. Das war ein fellbespanntes Bündel Energie. Das war Temperament bis in die Wolken hinein.
Auf dem Hofe prüfte ich den Schritt, den Trab und den Galopp des Hengstleins, hielt ihm die Feueraugen zu, prüfte seinen muskulösen Hals, seinen Kehlgang, ließ ihn wieder in den Stall bringen und veranlasste ihn, hastig zurückzutreten. Die alten Pferdehändlerkniffe, die mich der Großvater gelehrt hatte, waren nicht vergessen. Zuletzt kroch ich dem Pferdchen zwischen die Beine, kroch unter dem Bauch durch, um seine angepriesene Tugend zu prüfen. Der Hengst gefiel mir, doch ich sagte das nicht. Ich tadelte: »Hinten ein wenig eng gestellt. Im Rücken zu weich.« Ein Pferd, das man lobt, verteuert sich von Minute zu Minute. Der Verkäufer schlägt für jedes Wort fünfzig Mark auf. Man bezahlt seine eigenen Lobsprüche; ein uraltes Gesetz beim Pferdehandel. Auf unseren staatlichen Pferdemärkten verliert es mehr und mehr an Gültigkeit, doch leider werden dort Kleinpferde nicht gehandelt.
»Ich kauf das Pferdchen trotz der Fehler, Gevatter Tischlermeister«, sagte ich. »Aber billig muss es sein!« Mein Herz pochte eine andere Sprache: Den Hengst musst du haben, den Hengst musst du kriegen … so pochte mein Herz. Der Tischlermeister schaute mich lächelnd an. »Das Pferd ist verkauft, gestern telegrafisch verkauft, Herr.«
Ich sah den kleinen Hengst an. Seine Mut-Augen blinkten unter der breiten Stirnmähne hervor.
Weshalb ich ein schlechter Pferdehändler war
Hagel fiel in meine blühenden Wünsche. Der Tischlermeister erklärte mir, weshalb er das Pferd verkauft hätte. Nach neunzehnhundertfünfundvierzig, das sei eine gute Zeit für ihn gewesen – Leichen ringsum. Särge, Särge seien gebraucht worden – ein glänzender Absatz. Dann sei der Typhus gekommen und manch andere merkwürdige Krankheit. Wieder seien Särge und nochmals Särge benötigt worden. Jetzt habe das Geschäft nachgelassen. Man müsse sich umtun nach Leichen und den Geschäftskreis erweitern.
Ein Pferd habe einen zu kleinen Radius. Ein Auto müsse her. Der ausgefranste schwarze Schlips des Tischlermeisters hing schief und traurig im Jackenausschnitt.
Mir wurde unheimlich. Da stand ein Mensch, der vergangenen Zeiten voll Tod und Krankheit nachtrauerte. Was Geschäfte aus einem Menschen machen können!
Der Tischlermeister hob seinen Trauerkopf. »Ihre Anfrage war sehr nüchtern, Herr. So amtlich, so Telefon. Der Mann, dem ich den Hengst gab, schrieb einen Brief. Er glühte vor Pferdeliebe.«
In meinem Rucksack klirrte leise das Halfterzeug. Ein trauriges Geklimper. Ich wurde beredsam wie ein