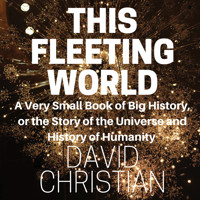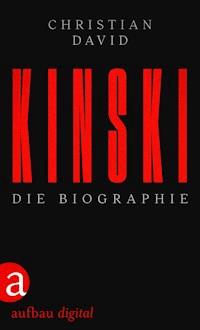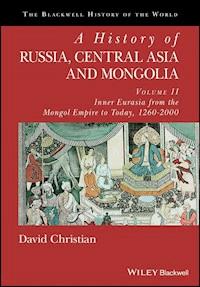Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
"German Angst" – Christian David diagnostiziert eine historisch begründete Furcht vor dem Populären und er ruft den Deutschen, aber auch dem Rest von Europa zu: No fear! Es geht ihm nicht darum, die Grenzen zwischen der sogenannten Hochkultur und der Popkultur in Bausch und Bogen einzureißen, sondern vielmehr um ein Ernstnehmen. Die Beschäftigung, auch die wissenschaftliche, mit der populären Kultur ist in allen Disziplinen wichtig, gesellschaftlich und künstlerisch. Angst verhindert neue Impulse und große Erlebnisse. Ein Plädoyer für Filmmusik, Operette und Sitcom.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian David
POP MACHT ANGST
Über Popkultur
Ich glaube, man ringt sich nur über die große Anstrengung zur Leichtigkeit durch.Ralph Benatzky, Tagebuch, 16. März 1930
Berlin, Deutschland
Zwei Erlebnisse, ein Ort, dasselbe Jahr. Ich bin zum ersten Mal in Berlin, komme direkt vom Flughafen Tegel und dessen pragmatischer Schönheit. Es ist Juli, warm, und die Straße, die ich überqueren will, ist leer. Also marschiere ich los und ziehe den Koffer hinter mir her. Mir kommen Menschen entgegen, nachdem die Fußgängerampel auf Grün gewechselt ist. In der Mitte der Fahrbahn teilt mir ein Passant freundlich, aber bestimmt mit: »Man geht bei Grün über die Straße.« Ich wundere mich über diese Bemerkung. War das ein Hinweis, eine Zurechtweisung, ein Befehl oder eine kurze Nachschulung? Warum äußert sich jemand in dieser Weise gegenüber einer völlig fremden Person?
Tags darauf in der Deutschen Kinemathek am Potsdamer Platz. Im Aufzug fahre ich hinauf, um zwei Filmwissenschaftler zu treffen. Während des Gesprächs sage ich irgendwann begeistert: »Der deutsche Film der 1950er Jahre ist großartig, da finden sich wahre Perlen, und in ihm spiegelt sich die damalige Zeit.« Zwei Augenpaare starren mich mit skeptischer Verständnislosigkeit an, als hätte ich gerade die ästhetischen Qualitäten eines Pornofilms gelobt.
Das ist Berlin, denke ich.
Das ist Deutschland, weiß ich viel später.
Die Republik der Mahner und Warner.
Angst, die alte Meisterin aus Deutschland
Die deutsche Kultur ist eine Angstkultur, und für die deutsche populäre Kultur gilt das gleichermaßen. Sogar in dem Sinn, dass es eine generelle Angst vor der populären Kultur gibt, vor ihrer Wirkung und den sich daraus ergebenden Konsequenzen. Die sogenannte German Angst ist zu einem Schlüsselbegriff geworden – vor allem in Deutschland. Während der Präsidentschaft von George W. Bush wurde darauf verwiesen, als sich die deutsche Politik dem Irak-Abenteuer verweigerte. Den Deutschen wurde pauschal unterstellt, zu feig für ein militärisches Eingreifen zu sein (in weiterer Folge wurde dies ganz Europa attestiert, zumindest jedoch dem vom damaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld als Old Europe etikettierten Teil des Kontinents). Abgesehen davon kreist vor allem das deutsche Denken um die angebliche oder tatsächliche German Angst. Es gibt zu diesem Thema sogar einen Wikipedia-Artikel – doch eben bloß in deutscher Sprache. Womöglich existiert also sogar eine deutsche Angst vor der German Angst.
Kommunikative Muster bilden immer auch dahinterliegende psychologische Mechanismen ab. Eine Sprache ist niemals nur eine Sprache, sondern es geht um Varianten und Interpretationen. Was an dem in Deutschland gesprochenen Deutsch auffällt: Wie oft hier in der Kommunikation auf Warnungen, Mahnungen und Drohungen zurückgegriffen wird. Was man alles nicht kann, nicht darf, nicht soll und auf keinen Fall tut, wird mit Vorliebe mitgeteilt. Es geht um die Information des Gegenübers, was von ihm oder ihr erwartet wird. Erklärbar ist dies nur, wenn die drängende Präsenz diverser Ängste vorausgesetzt wird.
Wesentliche Werke der deutschen Kunst und Kultur befassen sich mit der Angst. Als ein Schlüsseltext kann das Märchen Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen aus der Sammlung der Brüder Grimm gelesen werden. Hier wird jemand erst zum richtigen, ganzen, vollständig gebildeten Menschen, wenn er die Angst kennengelernt hat. Dahin muss man quasi streben, wie auch Faust dorthin strebte (der sich wiederum vor Alter, Verfall, Einsamkeit und Unwissenheit ängstigte). Die Grimm’schen Märchen zählen zu den wesentlichsten Manifestationen deutscher populärer Kultur, und das Thema Angst ist von zentraler Bedeutung. Immer geraten die Protagonisten in Situationen, die Angst bei ihnen erzeugen, ob es unheimliche Menschen, der Teufel oder die drohende Ermordung sind. Auch die Angst vor Juden ist präsent: in Der Jude im Dorn, einem Märchen, das man getrost als antisemitisch bezeichnen darf und das mit der Tötung des selbstverständlich bösen Juden endet. Dass diese Märchen bis heute als angemessene Lektüre für Kinder angesehen werden, ist erstaunlich. Selbst in geglätteten Soft-Versionen atmen diese Texte eine Pechschwärze, die selbst von oft aufgesetzt wirkenden Happyends nicht wirklich aufgeheitert wird. Deutsche Märchen sind Zeugnisse einer schier unendlichen Angstbesessenheit, was sie von den Märchen anderer Länder markant unterscheidet. Düsternis, Fatalismus und Grausamkeit blühen, und die Menschen sind einsame Wanderer durch eine deutsche Welt voll schicksalhafter Willkür, der man tatsächlich nur ängstlich gegenübertreten kann. Man kann es natürlich auch positiv sehen: Diese Texte fordern implizit dazu auf, Mut zu beweisen.
Die Romantik als eine sehr deutsche Strömung untersuchte das Thema Angst auf vielfältige Weise. Heimlich stiehlt sich die Angst auch in die fernwehtrunkenen Bilder eines Caspar David Friedrich oder in Carl Maria von Webers Oper Der Freischütz (Text: Johann Friedrich Kind): Da ist es der deutsche Wald, in dem das Böse lauert und brave Menschen zu verderben sucht. Hier wurde die deutsche Angst-Tradition künstlerisch gültig und wirksam verarbeitet. Angst zieht sich auch durch die Arbeiten von E.T.A. Hoffmann, der sogar die – bis heute präsente – Furcht vor Maschinen, also vor technischen Neuerungen thematisierte (z.B. in Die Automate oder Der Sandmann). Filmische Ausläufer solcher Tendenzen finden sich noch in Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu von 1922 und zumal in den düster dräuenden Heimatfilmen der Nazi-Ära (etwa 1940 in Die Geierwally des gnadenlos linientreuen Regisseurs Hans Steinhoff).
Die Angst jedoch: Sie wirkt immer nur, wenn sie eine Angst vor dem bereits Bekannten und Erkannten ist. Dieses Bekannte kommt aus dem Selbst, sie ist nichts Fremdes oder Oktroyiertes. Wer Angst hat, sorgt sich vor dem, was in ihm selbst schlummert und auszubrechen droht, nicht vor dem Unbekannten. Das Unbekannte birgt keinen Schrecken, sondern wird übersehen, weil es nicht gespürt wird. Die deutsche Angst ist somit wie jede Angst eine vor sich selbst und nicht vor dem Fernen, sondern vor dem in unmittelbarer Nähe Vermuteten, Befürchteten und Drohenden. Nur vor der Angst selbst hat man nicht Angst, das ist das Erstaunliche. Im Gegenteil, man fühlt sich zu ihr geradezu hingezogen wie zu einem besonders schönen Menschen oder zu einer köstlichen Droge, quasi verführt und angefixt.
Populäre Kultur und die Angst vor dem Nahen
Anderswo ist alles besser, aber daheim bei Mutti ist es letztlich am besten. Hier wird serviert, was einem schmeckt. Die dramatisch übersteigerte Sehnsucht nach dem Anderswo – erneut sei auf Caspar David Friedrich und dessen Ausblicke auf ferne Horizonte verwiesen – durchdringt, prägt und lähmt mitunter die deutsche Kultur. Sie trägt dazu bei, dass deutsche Kunst im eigenen Land oftmals Vernachlässigung oder Geringschätzung erfährt. Bis sie international rezipiert und gepriesen wird, um erst dann an ihrem Ursprungsort wirklich geschätzt und akzeptiert zu werden. Gerade in der populären Kultur kennt man diesen steinernen Weg. Erinnert sei an den aus Wien stammenden Schauspieler Christoph Waltz. Fast drei Dekaden lang mühte er sich durch eine Vielzahl deutschsprachiger TV-Produktionen, bewies darin sein Talent und seine Unverwechselbarkeit. Zu beliebten Stars, die in Talkshows geladen oder mit Interviewanfragen überhäuft wurden, mutierten indes andere, mitunter weniger Begabte. Es bedurfte eines Quentin Tarantino, dies durch die Besetzung Waltz’ in Inglourious Basterds komplett zu ändern. Ein Charakterdarsteller der zweiten Reihe avancierte binnen weniger Monate zum preisgekrönten Weltstar. Zuvor war sein Platz zwischen allen Stühlen gewesen. Die Sehnsucht nach dem Fernen befriedigte er nicht, weil er zum Nahen zählte. Zugleich eignete ihm eine Weltläufigkeit, die jedoch nur im Fernen gesucht und diesem zugestanden wurde, nicht aber dem Nahen.
In der Sehnsucht liegt Sucht verborgen. Diese Sucht nach dem Fernen, dem Fremden, dem Andersartigen ist dafür verantwortlich, dass die deutsche Populärkultur einen intensiven Drang nach Selbstverleugnung aufweist. Der allerdings wiederum von geradezu provinziellem Selbstverhaftetsein konterkariert wird. Man träumt von fernen Landen, möchte jedoch die heimische Fußgängerzone überallhin mitnehmen. Allzu fremd und ungewohnt darf es dann doch nicht sein. Es geht letztlich mehr um den Anschein als um die Realität. Denken wir an die Romane von Donna Leon oder Rosamunde Pilcher, die seit Jahrzehnten fleißig in deutsche Fernsehfilme verwandelt werden. Letzteres geschieht unter Anwendung genuin deutscher Konventionen. Deutsche Schauspieler in karierten Sakkos gaukeln scheinbar prototypische Briten vor, andere mimen mit Gel im Haar und Sonnenbrille scheinbar originalgetreue Italiener. Gedreht wird an Originalschauplätzen Britanniens oder Venedigs, aber das Ambiente verkommt durch die deutschen Lippenbewegungen zur bloßen Fassade. Nichts anderes taten prinzipiell bereits die deutschen Edgar-Wallace-Verfilmungen der 1960er, nur mit ungleich mehr Ironie. Irgendwann waren sogar ausländische Vorbilder nicht mehr nötig. Verfilmungen der angeblichen Werke einer nicht existenten schwedischen Autorin namens Inga Lindström wurden realisiert. Sichtbar wird dabei regelmäßig das unstillbare Verlangen nach dem nur scheinbar Fremden, das zugleich von der Anwesenheit des Vertrauten gezähmt wird. Das Ferne verkommt zur kostümierten Travestie des Nahen und Bekannten. Die im Hintergrund existierende Angst vor dem Fremden – die andere Medaillenseite der Sucht nach dem Fernen – wird überlistet. Die Gier nach bzw. die Lust an Angst und Beruhigung zugleich erfährt eine doppelgleisige Befriedigung. Dem Unbekannten, Ungewohnten, Gefährlichen, Drohenden muss man sich nun nicht mehr stellen. Regelmäßig wiederkehrende Ersatzbefriedigung ist angesagt. Die Angst hat gesiegt.
Solche Fernsehproduktionen sind die filmische Entsprechung zum internationalen Massentourismus. Man fährt touristisch durch das Ausland, bleibt jedoch brav in der Gruppe, speist in Lokalen, die hauptsächlich von Touristen frequentiert werden, ignoriert die Einheimischen und deren bevorzugte Orte, sitzt abends in der Hotelbar und lauscht den Erläuterungen des Touristenführers, die natürlich in der eigenen Muttersprache erfolgen. Das hat viel mit Unsicherheit zu tun, mit der Gleichzeitigkeit zweier Wünsche: Man möchte in die Ferne, um den heimatlichen Gefilden zu entfliehen; man möchte das Vertraute, weil man sich vor dem Ungewohnt-Ungeregelten ängstigt. Daraus ergeben sich permanente Konflikte, die, weil sie konträr verlaufen, niemals ganz aufgelöst werden können. In der populären Kunstästhetik erkennt man die Konsequenzen, die ebenfalls widersprüchlich sind. Es sind die beschriebenen TV-Produktionen, die jedes drohende Zuviel an fremder Authentizität beschneiden. Die Donna-Leon-Stoffe erträgt man im Gewand herkömmlicher deutscher TV-Krimis, die im Stil von Pizza-Werbung italianisiert wurden. Das wird akzeptiert, aber original italienische Fernsehkrimis mit echten Italienern und wirklich italienischen Themen – etwa die RAI-Verfilmungen der Commissario-Montalbano-Romane von Andrea Camilleri – schaffen es in keine Primetime der großen Sender.
Das Fremde muss eben in vertrauter Form präsentiert werden. So wie fremdsprachige Filme, die gnadenlos synchronisiert werden. Was Briten, Skandinavier oder Amerikaner schaffen – nämlich Untertitel zu lesen –, gilt in Deutschland als exotisches Bedürfnis snobistischer Minderheiten. Dass die Synchronisation den originalen Klang verändert und verfälscht, spielt dabei keine Rolle. Denn die Synchronisation verleiht die Gewissheit, sich doch auf vertrautem Terrain zu befinden. Es ist die Muttersprache, die lockt, verführt und Ängste vor einem Übermaß an Fremdem besänftigt. Die Mutter beschwört das neugierige und zugleich ängstliche Kind: Bleib doch hier bei mir, schau dich in der Welt um, aber komm doch wieder nach Hause, wo ich auf dich warte. Filmsynchronisation ist nichts anderes als sublimierte, deshalb in Deutschland gesellschaftlich tolerierte Xenophobie.
Sowohl die Synchronisation wie die TV-Tourismusfilme gewährleisten, dass man sich in der Mitte trifft. Im bizarren Mix aus Fernem und Nahem richtet man es sich gemütlich ein. Es ist die kunstästhetische Entsprechung zum Toast Hawaii. Dem puren Fernen wird ebenso misstrauisch begegnet wie dem puren Nahen. Letzteres hat es dennoch schwerer. Die Romantisierung, die beim Fremden möglich ist, fällt da ebenso weg wie der Reiz des Exotischen. Das Nahe wird mitunter als viel zu nahe, also auch zu wesensverwandt empfunden wird. Es kann auch als Spiegelbild fungieren und unliebsame Entdeckungen über sich selbst ermöglichen. Das verhindert man, indem man dem Nahen ausweicht. Als Rationalisierung dient die Technik der Abwertung. Indem etwa der anfangs erwähnte deutsche Spielfilm der 1950er als schlecht oder spießig oder uninteressant abqualifiziert wird, kann man der Auseinandersetzung ausweichen. Oder man ignoriert gewisse Gebiete künstlerischen Schaffens, ohne dies weiter erklären zu wollen. Man vertraut schlicht auf den unausgesprochenen Konsens in einer gewissen Community. Wird dieses Abschottungsmanagement von außen durchbrochen, bleibt nichts anderes übrig, als den Durchbrecher mit Blicken zu tadeln.
Psychologische wie physische Gründe sorgen dafür, dass man im deutschsprachigen Raum dem Nahen vielfach so misstrauisch gegenübertritt. Die Vergangenheit mit Nationalsozialismus, Krieg, Holocaust bzw. Shoa erzeugte Traumatisierungen, die auch –wissenschaftlich nachgewiesen – nachfolgende Generationen betreffen. Der Blick auf das Selbst wird vielfach als problematisch empfunden, weil dieses Selbst bewusst oder unbewusst mit Schuld und Scham assoziiert wird. Der unproblematisierte Blick auf das eigene Selbst fällt deshalb schwer, er steht im Verdacht, Negatives auszublenden. Allerdings ist der von vornherein problematische Blick auf das Selbst eben auch ein getrübter, und die Geringschätzung bzw. Ignoranz gegenüber dem Nahen und Vertrauten ist genau das, was vermieden werden soll: Verdrängung. Den deutschen Film der 1950er mangelhaft oder gar nicht zu rezipieren ist ebenso Verdrängungsarbeit wie die Nichtrezeption von Nazi-Propagandafilmen. Will man etwas über die bundesdeutsche Gesellschaft der Adenauer-Ära erfahren, gehört dazu auch die Beschäftigung mit dem (pop)kulturellen Geschehen jener Zeit. Vor diesem Hintergrund versteht man, dass man lieber einmal mehr den Neuen Deutschen Film der Generation des Oberhausener Manifests in den frühen 1960ern beleuchtet. Weil hier ganz neu und mit völlig verändertem Personal begonnen wurde. Weil ein Schlussstrich unter das gezogen wurde, was plötzlich als Opas Kino benannt wurde. Weil die politische Stunde Null von 1945 nun auch im Film eine Entsprechung erfuhr. Aber Schlussstriche politischer wie künstlerischer Art sind bequem. Eine Stunde Null kann es nicht geben, weil die Vergangenheit nachweht. Der Vergangenheit muss man sich in ihrer Gesamtheit stellen, nicht bloß fragmentarisch.