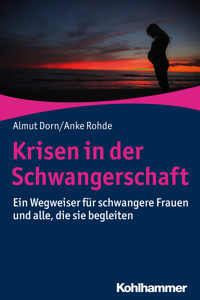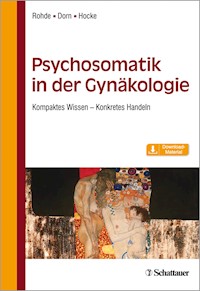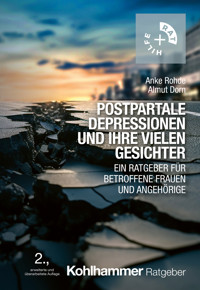
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Depressionen sind die häufigsten psychischen Probleme nach der Geburt eines Kindes, und sie stellen betroffene Frauen und ihre Angehörigen oftmals vor große Herausforderungen. Dabei gibt es "die" Wochenbettdepression bzw. "die" postpartale Depression - so der Fachbegriff - gar nicht. Vielmehr ist das ein Oberbegriff für verschiedenste Symptomkonstellationen, deren Verursachungsfaktoren und Verläufe stark variieren können. Der Ratgeber gibt Aufschluss über die vielen Gesichter der postpartalen Depression sowie deren Behandlungsmöglichkeiten. Ergänzend sind Selbsthilfestrategien und Unterstützungsmöglichkeiten dargestellt. Fallbeispiele und Erfahrungsberichte betroffener Frauen runden die neukonzipierte 2. Auflage ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Worum es in diesem Buch geht
1 Hilfreiche Erläuterungen zu Beginn
Postpartale Depressivität ist nicht gleich postpartale Depression
Die EPDS – erster Schritt zur Erkennung von Problemen
Wie werden Diagnosen gestellt?
Klärung einiger Fachbegriffe
Postpartal, postnatal, präpartal, peripartal
Störung, Erkrankung
Psychose, Neurose
Affektive Störung, manisch-depressive Erkrankung
Wochenbettdepression, Wochenbettpsychose
Krankheitsphase, Krankheitsepisode
Chronifizierung
2 Postpartale Depressionen und ihre vielen Gesichter
Babyblues
Postpartale Depression
Einzelne Episode oder Teil einer wiederkehrenden Störung?
Postpartale Depression als einzelne depressive Episode
Postpartale Depression als Teil einer wiederkehrenden Störung
Die einzelne Episode wiederholt sich doch
Angstsymptome postpartal
Zwangssymptome postpartal
Reaktionen auf Totgeburt, Frühgeburt, Geburt eines kranken Kindes
Akute Belastungsreaktion
Reaktive Depression
Besonderheiten bei der Totgeburt
Besonderheiten bei der Frühgeburt
Besonderheiten bei der Geburt eines kranken oder behinderten Kindes
Nach der traumatisch erlebten Entbindung
Postpartale Psychosen
3 Verursachungsmodelle und Einflussfaktoren
Multifaktorielle Verursachung
Individuelle Empfindlichkeit
Geburt als lebensveränderndes Ereignis
Hormonelle Umstellung
Komplikationen bei der Entbindung
Andere körperliche Aspekte
Vorbestehende psychische Erkrankungen
Psychische Störungen in der Familie
Soziale Unterstützung
Eigene Erwartungen
Psychische Probleme schon in der Schwangerschaft
4 Wie geht es weiter?
Verlauf postpartaler Depressionen
Häufig gestellte Fragen zum weiteren Verlauf
Gesund wie früher nach postpartaler Depression?
Wann weiß ich, dass ich wieder vollständig gesund bin?
Und wenn es nicht mehr aufhört? – die »Chronifizierung«
Erneute Schwangerschaft nach postpartaler Depression?
5 Behandlungsverfahren in ihrer Vielfalt
Psychotherapie
Verhaltenstherapie und kognitive Verhaltenstherapie
Analytische Psychotherapie (= Psychoanalyse)
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
Systemische Therapie
Weitere psychotherapeutische Verfahren im Überblick
Online-Psychotherapieprogramme
Nicht jede Psychotherapie ist für jeden geeignet
Medikamentöse Behandlung
Einsatz von Psychopharmaka
Antidepressiva – Mittel der ersten Wahl
Antipsychotika – oftmals eine gute Unterstützung
Beruhigungs- und Schlafmittel – nur kurzzeitig
Sind Psychopharmaka nicht gefährlich?
Bedeutet es Schwäche, wenn man Medikamente einnimmt?
Wie lange dauert es, bis die Medikamente wirken?
Wie lange müssen die Medikamente weiter genommen werden?
Nebenwirkungen sind oft nur vorübergehend
Untersuchungen vor und während der Medikamenteneinnahme
Medikamente und Stillen
Der Einsatz von Hormonen
Progesteron
Brexanolon
Östrogen
Schilddrüsenhormone
Melatonin
Weitere Therapiemöglichkeiten
Lichttherapie
Transkranielle Magnetstimulation
Elektrokrampftherapie
»Alternative Heilmethoden«
6 Unterstützung – angepasst an den Bedarf
Professionelle Hilfe – Hebammen, Stillberatung, Ärzte
Hebammen
Stillberatung
Kinderärztinnen
Gynäkologen
Selbsthilfe, Beratungsstellen, Frühe Hilfen und Co.
Selbsthilfeorganisation Schatten & Licht e. V.
Beratungsstellen
Frühe Hilfen
Schreibaby-Ambulanz
Haushaltshilfe
Elterntelefon
Jugendamt
Unterstützung in Familie und sozialem Umfeld
Elternzeit, Partnermonate und mehr
Unterstützung aus Familie und Freundeskreis
Nachbarschaft
Ehrenamtliche Hilfe
Abgestufte Möglichkeiten der Behandlung
Ambulante Behandlung, Spezialsprechstunden
Tagesklinische Behandlung mit und ohne Kind
Vollstationäre Behandlung mit und ohne Kind
Mutter-Kind-Kur
Bindungs- und Interaktionsverhalten zum Kind stärken
Feinfühligkeit kann man lernen bzw. verbessern
Fehlende Muttergefühle als Krankheitssymptom
Frühintervention und Behandlung bei Bindungsstörungen
Eltern-Kind-Kurse
»Gut genug« ist ausreichend!
7 Was können Angehörige tun?
Entgegen allen Erwartungen
Für Entlastung sorgen
Nähe und emotionale Wärme geben
Depressionen erkennen
Keinen Druck aufbauen
Verständnis statt Ratschlag
Professionelle Hilfe organisieren
Verhaltensauffälligkeiten richtig interpretieren
Lebensmüde Gedanken ernstnehmen
Selbstfürsorge nicht vergessen
8 Selbsthilfestrategien leicht anzuwenden
Entspannung auch mit Neugeborenem
Progressive Muskelentspannung (PME) nach Jacobson
Autogenes Training (AT)
Imaginationsverfahren, Fantasiereisen
Yoga, aktive Entspannung
Wichtige Hinweise zu Entspannungsverfahren
Achtsamkeit wirksam einsetzen
Body-Scan
Atem-Meditation
Depressivität entgegentreten
Das Bild der Waage
Bewegung, Luft und Licht
Kontakt und Berührung
Aktivitäten und Pausen
Selbstfürsorge
Akzeptanz
Angstsymptomen begegnen
Den Teufelskreis der Angst verstehen
Entschleunigtes Atmen
Alle fünf Sinne einsetzen
Die Angst hereinbitten
Gedankenstopp (nicht nur bei Ängsten)
Innerer Ort der Ruhe
Zwangssymptome durch Akzeptanz neutralisieren
Zwangsgedanken keine Macht geben
Zwangshandlungen verhindern
Ganz speziell: die Angst vor Infektionen
Ganz speziell: die Angst, dem Baby zu schaden
Traumatische Erinnerungen verblassen lassen
Reden hilft
Schreiben hilft auch
Tresortechnik
Innere Helfer
Mit Schlafstörungen umgehen
Schlafhygiene
Keine Angst vor Schlaflosigkeit
Wut und Aggressionen entgegenwirken
9 Fallbeispiele aus der Praxis
Achterbahn der Gefühle – Grund zur Sorge? Ein Fall von Babyblues
Ich wollte eine so gute Mutter sein – Depression nach der ersten Entbindung
Lange gequält und viel Zeit versäumt – Chronifizierte Depression nach der ersten Entbindung
Sieht so eine Mörderin aus? – Depression mit Zwangssymptomen
Kann man sich mit Behinderung anstecken? – Zwangssymptome in der Schwangerschaft
Depressiv oder »ausgesaugt«? – Die Erschöpfung nach mehrmonatigem Stillen
Wenn Stillen zum Stress wird – Depression mit Panikattacken
Ein Teufelskreis von Erwartungsdruck und Ängsten – Beziehungsprobleme nach der Geburt
Wenn zu viel zusammenkommt – Depression nach der dritten Entbindung
Wenn die Angst den Tag kontrolliert – Verschlimmerung einer Panikstörung nach der Geburt
Angst macht unfrei – Beginn einer Angststörung in der Schwangerschaft
36 Stunden Wehen und Schmerzen umsonst – Eine traumatisch erlebte Entbindung und ihre Folgen
Ich bekomme nie wieder ein Kind – Die Angst vor einer weiteren Entbindung nach traumatisch erlebter Geburt
Die Vergangenheit ist wieder da – Reaktualisierung von traumatischen Erfahrungen
Die Angst vor der Wiederholung eines Dramas – Depressive Reaktion nach Totgeburt und Wiedererleben in der Folgeschwangerschaft
Die Suche nach der eigenen Schuld – Depression nach Frühgeburt
Schwanger durch Kinderwunschbehandlung – aber die Drillinge schaffen es nicht
Wenn zusammenreißen nicht mehr hilft – Suizidversuch bei postpartaler Depression
Das Baby ist unheilbar geschädigt – Wahnhafte Depression und erweiterter Suizid
Das Baby ist ausgetauscht – Doppelgängerwahn und psychotische Depression
Euphorie und Depression im schnellen Wechsel – eine bipolare affektive Störung nach der Geburt
Das Baby wird zur Puppe – Verhaltensauffälligkeiten in der Manie
Von Himmel und Hölle – »Traumartige Erlebnisse« in der Psychose
Beobachtet und verfolgt gefühlt – bedeutet das Schizophrenie?
Nicht wieder krank werden, aber trotzdem ein Baby – Schwanger unter Medikamenten
Last but not least: Auch Väter können depressiv werden
10 Erfahrungsberichte betroffener Frauen
Warum hat es so lange gedauert, die Depression zu erkennen?
Zwangsgedanken statt Muttergefühlen – und alle leiden
Depressionen und Wutausbrüche – und noch mehr Schuldgefühle
Befürchtungen, Zweifel, Horrorvisionen – Wenn Ängste das Leben beherrschen
Wenn das Stillen zur Qual wird
Von der traumhaften Schwangerschaft zum Albtraum mit Baby
Auch körperliche Beschwerden stehen manchmal im Vordergrund
Mutter-Kind-Behandlung: Die Rettung bei Suizidgedanken
In der postpartalen Depression ganz weit unten – und doch etwas Positives
Gute Mutter, schlechte Mutter – die doppelte Buchführung
Ein weiter Weg, um Hilfe zu finden
Panik als Reaktion auf den positiven Schwangerschaftstest. Und die Geschichte eines Frauenpaares
11 Weiterführende Informationen
Auswahl bereits erschienener Ratgeber der Autorinnen
Danksagung
Seitenangaben der gedruckten Ausgabe
1
2
3
4
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Rat + Hilfe
Fundiertes Wissen für Betroffene, Eltern und Angehörige –Medizinische und psychologische Ratgeber bei Kohlhammer
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Ratgeber aus unserem Programm finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/rat+hilfe
Die Autorinnen
Prof. Dr. med. Anke RohdeFachärztin für Psychiatrie und PsychiatrieUniversitätsprofessorin für GynäkologischePsychosomatik, Universität Bonnwww.rohde-bonn.de
Dr. phil. Dipl.-Psych. Almut DornPsychologische PsychotherapeutinPraxis für Gynäkologische Psychosomatik,Hamburgwww.almutdorn.de
Anke RohdeAlmut Dorn
Postpartale Depressionen und ihre vielen Gesichter
Ein Ratgeber für betroffene Frauen und Angehörige
2., erweiterte und überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
Umschlagabbildung: FutureStock – stock.adobe.com
2., erweiterte und überarbeitete Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstraße 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-045524-5
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-045525-2epub:ISBN 978-3-17-045526-9
Worum es in diesem Buch geht
»Ich hatte eine wundervolle Schwangerschaft, war stolz auf meinen Bauch, führte eine glückliche Ehe, und dieses Kind, mit dem wir fast schon nicht mehr gerechnet hatten, war ein sogenanntes Wunschkind. Auch die Entbindung war nicht schwer. Deshalb habe ich die Welt nicht mehr verstanden, als es mir bereits 36 Stunden nach der Entbindung psychisch sehr schlecht ging.«
So begann ein Brief, den ich (A. R.) zu Beginn meiner Tätigkeit am Universitätsklinikum in Bonn von einer betroffenen Frau bekam. Über meine Berufung auf eine Forschungsprofessur und die damit verbundene Einrichtung der Abteilung »Gynäkologische Psychosomatik« war vorab in der lokalen Presse berichtet worden und auch über die Forschungsgebiete, mit denen ich mich beschäftigen würde. Die Briefeschreiberin berichtete über die schwere Depression nach ihrer ersten Entbindung und den Versuch, ihrem Leben ein Ende zu setzen, der nur mit viel Glück nicht zum Ziel geführt hatte. Wir werden diese betroffene Mutter bei den Fallbeispielen noch einmal treffen.
In den Jahren danach haben meine Mitarbeiterinnen, zu denen von Anfang an meine Mitautorin Almut Dorn gehörte, und ich in der Gynäkologischen Psychosomatik der Universitätsfrauenklinik in Bonn weit über tausend Patientinnen mit Depressionen und anderen psychischen Störungen nach der Entbindung behandelt. Ganz oft berichten sie über sehr ähnliche depressive Symptome und Erlebnisweisen, die aber wegen der Begleitsymptomatik bzw. der Gesamtgeschichte zu ganz unterschiedlichen Diagnosen führen können.
Dennoch, die daraus entstehenden Probleme in der Familie sind sich sehr ähnlich. Immer wieder hören wir von Veränderungen in der Selbstwahrnehmung, von Verunsicherung, von Problemen im sozialen Umfeld bis hin zu dauerhaften Familienkrisen. Es werden fast immer die gleichen Fragen gestellt, wie etwa nach den Ursachen, nach Behandlungsmöglichkeiten oder auch nach der Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Problematik später noch einmal auftreten kann. Diese und ähnliche Fragen zu beantworten, Hintergründe zu erhellen und damit Ängste zu nehmen, ist Ziel dieses Buches. Die Lektüre ersetzt nicht die Behandlung, wenn eine solche erforderlich ist. Vielmehr soll damit Unterstützung beim Erkennen von Art und Ausmaß bestehender psychischer Probleme geboten werden. Und es sollen Wege aufgezeigt werden, wie und wo man sich frühzeitig Hilfe holen kann.
Im Vergleich zur Vorauflage (»Postnatale Depressionen und andere psychische Probleme«) hat sich der Titel des Ratgebers geändert, weil wir bei der vollständigen Überarbeitung den Fokus noch mehr auf die postpartalen Depressionen gelegt haben. Im Mittelpunkt dieses Buches stehen also Depressionen, weil sie einerseits das häufigste psychische Problem nach der Geburt darstellen und oftmals einen erheblichen Leidensdruck erzeugen, und weil sich andererseits fast jeder etwas darunter vorstellen kann. Wir werden sie in all ihren Facetten, mit all ihren »Gesichtern« beschreiben: Als Depression ohne nachvollziehbare Ursache, sozusagen »aus heiterem Himmel« nach einer unkomplizierten Schwangerschaft und Geburt, als depressive Episode im Rahmen einer wiederkehrenden depressiven Erkrankung, als Depression, die sich wahnhaft entwickelt, als Depression, die nach einer traumatisch erlebten Geburt auftritt und als Depression nach einem belastenden Ereignis, wie etwa dem Verlust eines Kindes. Eine wichtige Botschaft findet sich schon hier: Depression ist nicht gleich Depression, und man muss genauer hinschauen, um eine verlässliche Diagnose zu stellen und die richtige Behandlung einzuleiten. Das ist üblicherweise Aufgabe eines Arztes oder einer Psychotherapeutin.
Doch Sie selbst und auch Ihre Angehörigen können bereits erste Hinweise sammeln und vor allem die Dringlichkeit der Probleme erkennen, wenn Sie sich informiert haben und auskennen. Dazu wollen wir beitragen. Sie sollen erfahren, wann auftretende depressive Symptome krankheitswertig sind, wo man sich Hilfe holen kann, wie eine Behandlung aussehen könnte und welche zusätzlichen Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Um dies weniger theoretisch und möglichst gut nachvollziehbar zu machen, haben wir nicht nur eine Reihe von Fällen aus unserer klinischen Praxis beschrieben, sondern auch verschiedene unserer Patientinnen gefragt, ob sie etwas von ihren Erfahrungen berichten können. Was hätte ihnen geholfen, wenn sie es von einer betroffenen Frau gehört oder gelesen hätten? Was ist ihre Botschaft an andere Betroffene? Möglicherweise wird es leichter, sich um Hilfe zu bemühen, wenn man sieht, wie es anderen Frauen und ihren Familien ergangen ist. Dabei kann das Wissen von Bedeutung sein, wie schnell man mit der richtigen Hilfe aus der Falle der postpartalen Depression oder sonstigen psychischen Problematik nach der Entbindung herauskommen kann. Und ebenso hilfreich kann es sein, die Schilderungen der Frauen zu lesen, die lange versucht haben, alles mit sich allein auszumachen, und die einen langen und schwierigen Weg bis zur Genesung gegangen sind. Diese Erfahrungsberichte – persönlich verfasst von den betroffenen Frauen – finden Sie am Ende des Buches.
Noch ein Wort zum »Gendern«: Wir haben uns entschlossen, auf Gendersternchen oder ähnliches zu verzichten und stattdessen die weiblichen und männlichen Berufsbezeichnungen im Wechsel zu verwenden, ohne dabei eine bestimmte Systematik einzuhalten. Bei der konsequenten Verwendung beider Formen wären die Texte oftmals unübersichtlich und schlecht lesbar geworden. Es versteht sich von selbst, dass jeweils alle Geschlechter gemeint sind.
Das gleiche trifft übrigens für die Verwendung des Begriffes »Partner« zu. Wir sind uns darüber im Klaren, dass heute Regenbogenfamilien in vielen Konstellationen existieren, und wir wissen aus der praktischen Arbeit mit gleichgeschlechtlichen Paaren, dass diese im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Entbindung unter den gleichen Problemen leiden können wie heterosexuelle. Allerdings haben wir uns – wieder im Sinne der besseren Lesbarkeit – dagegen entschieden, aus dem Partner (mit dem sowohl der Ehe- als auch der Lebenspartner gemeint ist) die Formulierung »der Partner/die Partnerin« zu machen. Doch selbstverständlich sind bei den entsprechenden Ausführungen immer auch Partnerinnen bzw. Ehefrauen gemeint.
Und noch ein letzter Hinweis: Auf ein Stichwortverzeichnis haben wir aus Gründen der Praktikabilität verzichtet. Wenn Sie jedoch nach einem speziellen Aspekt suchen, schauen Sie im ausführlichen Inhaltsverzeichnis nach. Gegebenenfalls helfen Ihnen auch die weiterführenden Informationen in ▸ Kap. 11.
Anke Rohde und Almut Dorn, Frühjahr 2025
2 Postpartale Depressionen und ihre vielen Gesichter
Darum geht es
Gerade nach Geburten können sich Depressionen sehr unterschiedlich bemerkbar machen. Hier wollen wir die verschiedenen Facetten aufzeigen und sie von verwandten Störungsbildern abgrenzen.
Wie schon an anderer Stelle aufgezeigt, kann eine postpartale depressive Symptomatik Teil einer postpartalen Depression sein, aber auch zu einer anderen psychischen Erkrankung gehören. Diese Abgrenzung ist wichtig, da nicht nur die Verursachungsmodelle unterschiedlich sein können, sondern weil das Wissen darum auch für die Auswahl der Behandlungsmethode wichtig ist.
In ▸ Tab. 2.1 sind die wichtigsten psychischen Störungen, die nach einer Entbindung auftreten können, mit ihren Charakteristika zusammengestellt.
Tab. 2.1:Die verschiedenen postpartal auftretenden Störungsbilder
Typ
Charakterisierung
»Babyblues«(»Heultage«, »Postnatal blues«, »Maternity blues«)
Betroffen sind ca. ¾ aller Frauen nach der Entbindung
Auftreten etwa 3.–5. postpartaler Tag, Dauer wenige Tage
Allgemein erhöhte Empfindlichkeit, Stimmungslabilität mit raschem Wechsel zwischen Glücklichsein und Niedergeschlagenheit, Weinen, Reizbarkeit etc.
Keine krankheitswertige Störung, vielmehr Reaktion auf die rasche Rückbildung der hohen Hormonspiegel nach der Entbindung
Postpartale Depression als einzelne Episode(»Wochenbettdepression«, »Postnatale Depression«)
Häufigkeit: 12 – 15 % depressive Symptome, Diagnose »postpartale depressive Episode« ca. 6 – 8 %
Typischerweise die erste depressive Episode überhaupt
Am häufigsten nach der ersten Entbindung, aber auch später möglich
Auftreten: Erste Tage/Wochen bis Monate nach der Entbindung
Dauer: abhängig vom Schweregrad Wochen bis Monate, im Extremfall auch länger (Chronifizierung)
Typische depressive Symptome: Niedergeschlagenheit, Weinen, Versagens- und Schuldgefühle, Grübeln, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Appetitminderung, Erschöpfung, Müdigkeit
Postpartale psychotische Depression(»wahnhafte Depression«)
Unterform einer schweren depressiven Episode, bei der u. a. depressiver Wahn auftritt (wie etwa Schuldwahn oder Verarmungswahn).
Das Thema des Wahns entsteht aus den depressiven Überzeugungen (z. B. ein schlechter Mensch zu sein oder sich schuldig gemacht zu haben). Nicht selten thematischer Bezug zum Kind
Postpartale Depression als Episode einer wiederkehrenden Störung
Nicht die erste Krankheitsphase im Leben
Typische depressive Symptome
Bei schwerem Verlauf auch psychotische Depression möglich
Gab es früher ausschließlich depressive Krankheitsepisoden, dann Zuordnung als »rezidivierende depressive Störung« (d. h. wiederkehrende Depression)
Falls auch manische Episoden vorkamen, Zuordnung als »postpartale Depression im Rahmen einer bipolaren affektiven Störung«
Depressive Reaktionnach Totgeburt, Frühgeburt, Geburt eines kranken oder behinderten Kindes
Beginn: Meist direkt nach dem Ereignis. Aber auch Wochen oder Monate später möglich.
Verlauf: abhängig von Schweregrad und klinischem Bild Dauer Wochen bis Monate
Zu Beginn meist innere Betäubung, »Schock«, Verzweiflung (= Akute Belastungsreaktion). Dann Übergang in längere depressive Reaktion möglich mit einer Vielzahl depressiver Symptome
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)nach einer traumatisch erlebten Entbindung
Auftreten: Erste Tage bis Wochen nach der Entbindung
Besonders gefährdet: Frauen mit traumatischen Vorerfahrungen (u. a. Gewalt, Missbrauch)
Diagnose PTBS frühestens 6 Wochen nach der traumatischen Erfahrung
Dauer: abhängig von Schweregrad und klinischem Bild Wochen bis Monate, im Extremfall auch länger (Chronifizierung)
Wiedererleben der Geburt in Albträumen und eindringlichen Erinnerungen (»flashbacks«), Schlafstörungen, Weinen, Gefühl innerer Taubheit, Reizbarkeit, sozialer Rückzug; nicht selten Begleitdepression
Nicht selten werden weitere Schwangerschaften vermieden
In einer weiteren Schwangerschaft Reaktualisierung möglich
Postpartale Psychose(»Wochenbettpsychose«)
Betroffen ca. 0,1 % aller Erstgebärenden
Beginn: Erste Tage bis Wochen nach der Entbindung, ca. 75 % innerhalb der ersten 2 Wochen
Verlauf: abhängig von Schweregrad und klinischem Bild Tage bis Monate, fast immer stationäre Behandlung erforderlich
Stimmung: oft Beginn mit Depressivität, dann Umschwung in Manie (ausgeprägte Euphorie). Manchmal auch direkt Beginn mit produktiv-psychotischen Symptomen (Wahn, Halluzinationen, Beeinflussungserlebnisse), dabei oftmals thematischer Bezug zum Kind
Weitere Symptome: Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Stimmungsschwankungen, Verhaltensänderungen, irreale Ängste, ungeordnetes Denken. Je nach Symptomatik Zuordnung zu einer der Kategorien psychotischer Störungen (z. B. Schizophrenie, schizoaffektive Psychose, Akute vorübergehende Psychose)
Postpartale Psychose als Episode einer wiederkehrenden psychotischen Störung
In der Vorgeschichte gab es bereits psychotische Episoden
Risiko einer erneuten Psychose nach der Entbindung 20 – 50 % (besonders hoch, wenn früher manische Symptome aufgetreten sind)
Dringende Empfehlung der postpartalen Prophylaxe (= vorbeugende Medikation)
Babyblues
Wir beginnen deshalb mit dem sogenannten »Babyblues«, weil der im Gegensatz zu den folgenden Störungsbildern nicht behandlungsbedürftig, sondern eine ganz normale Folge der sehr abrupten Hormonumstellung nach der Geburt ist. Etwa um den dritten bis fünften Tag nach der Entbindung fallen die hohen Hormonspiegel, die sich in der Schwangerschaft gebildet hatten, sehr plötzlich wieder ab. Wie alle ausgeprägten hormonellen Veränderungen können auch diese Hormonschwankungen zu vorübergehender psychischer Labilität führen, vor allem bei Frauen, die auf hormonelle Umstellungen empfindlich reagieren.
Allgemein hat sich im deutschen Sprachgebrauch – sowohl in der Fachsprache als auch in der Laiensprache – der Begriff »Babyblues« weitestgehend durchgesetzt, da Frauen den früher gebräuchlichen Begriff »Heultage« manchmal diskriminierend finden. Wie »Heultage« im Deutschen ist »Babyblues« ein umgangssprachlicher Begriff aus der englischen Sprache. Er leitet sich vom englischen Wort »blues« ab (umgangssprachlich für Melancholie; findet sich auch in der Musiksprache). Auch »maternity blues« (man könnte es mit »Mutterschaftsblues« übersetzen) wird im englischen Sprachraum verwendet. Die Tatsache, dass es auf Deutsch für die »Heultage« keine allgemein akzeptierte Fachbezeichnung gibt, zeigt schon, dass es sich hier nicht um eine Krankheit im engeren Sinne handelt.
Nur sehr selten ist ein ausgeprägter »Babyblues« zugleich der Beginn einer postpartalen Depression oder Psychose. Die Stimmungslabilität mit raschem Wechsel zwischen Glücklichsein und Weinen, erhöhter Empfindlichkeit, manchmal einhergehend mit Schlafstörungen oder sonstigen Verhaltensveränderungen, ist nicht behandlungsbedürftig. Ruhe, Abschirmung vor allzu viel Außenreizen und Verständnis und Fürsorge vonseiten der Angehörigen sind aber empfehlenswert. Wenn die Symptome länger als zwei oder drei Tage bestehen oder andere Auffälligkeiten hinzukommen, sollte allerdings an den Beginn einer Depression oder auch einer Psychose gedacht werden.
Postpartale Depression
Die Symptomatik einer postpartalen Depression kann von einer leichten depressiven Verstimmung bis hin zur schweren psychotischen Depression reichen. Alle Arten depressiver Symptome kommen vor.
Die häufigsten Symptome einer Depression nach der Entbindung sind in ▸ Tab. 2.2 zusammengefasst.
Tab. 2.2:Mögliche Symptome der postpartalen Depression
Mögliche Symptome der postpartalen Depression
Konzentration/Gedächtnis
Konzentrationsstörungen, manchmal Gedächtnisprobleme
Denken
Grübeln, Denkverlangsamung, Denkhemmung
Antrieb
Lust- und Interesselosigkeit, Antriebsminderung, Apathie, sozialer Rückzug, Bewegungsunruhe
Affektivität (Gefühlslage)
Depressivität, Versagens- und Schuldgefühle, als unzureichend empfundene Mutter-Kind-Gefühle, innere Unruhe, Gereiztheit, Aggressivität
Ängste
Unbestimmte Angst, Panikattacken
Zwang
Zwangsgedanken und -impulse (z. B. dem Kind etwas anzutun), selten Zwangshandlungen (z. B. Waschzwang)
Schlaf
Einschlaf- und Durchschlafstörungen, besonders frühes Erwachen
Suizidalität/Autoaggressivität
Lebensmüde Gedanken, Suizidgedanken, selten Suizidhandlungen, selten selbstverletzende Handlungen
Somatische (körperliche) Symptome
Müdigkeit, Appetitminderung, Gewichtsverlust, Druckgefühl in der Brust, Kloßgefühl im Hals, vielfältige andere körperliche Missempfindungen und Schmerzen
Produktiv-psychotische Symptome
Nur bei schwerer psychotischer Depression depressiver Wahn (z. B. Schuldwahn, Verarmungswahn, religiöser Wahn)
Besonders häufig leiden depressive Mütter unter dem Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein, woraus Schuld- und Versagensgefühle entstehen. Diese Symptome gehen nicht selten einher mit der Überzeugung, dass die Gefühle dem Kind gegenüber unzureichend sind, weil sie nicht den erwarteten Muttergefühlen entsprechen. Eine Störung der Mutter-Kind-Bindung ist Teil der Depression, wird aber von den betroffenen Frauen nicht als Krankheitssymptom, sondern als eigenes Versagen gewertet. In den Erfahrungsberichten am Ende des Buches werden Sie mehrfach auf dieses Problem stoßen.
Im Falle einer sehr schweren Depression können diese selbstabwertenden Gedanken zur wahnhaften Überzeugung werden und damit in die »psychotische Depression« führen. Neben den typischen depressiven Symptomen entwickelt sich dann beispielsweise ein Schuldwahn, ein Verarmungswahn oder ein religiöser Wahn.
Fast jede von schweren depressiven Symptomen betroffene Frau berichtet, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt auch zu lebensmüden und schließlich suizidalen Gedanken gekommen ist oder auch zur Überlegung, das Kind zur Adoption freizugeben. Und all das vielleicht sogar, obwohl es sich um ein Wunschkind handelt. Auch Einblick in diese tiefverzweifelten Gedanken und den Umgang damit geben uns einige der Frauen in den Erfahrungsberichten am Ende des Buches (▸ Kap. 10).
Besonders in der Möglichkeit des erweiterten Suizids bei schweren Depressionen (Selbsttötung mit vorheriger Tötung des Kindes) liegt eine Gefahr für Mutter und Kind, auch wenn solche Fälle glücklicherweise extrem selten sind.
Ebenfalls selten können bei Frauen, die in ihrer Vorgeschichte schon mit autoaggressiven (also selbstverletzenden) Handlungen zu tun hatten, entsprechende Verhaltensweisen im Rahmen der Depression wieder auftreten. Solche Selbstverletzungen dienen beispielsweise der Spannungsabfuhr oder dem Wunsch, »sich selbst wieder zu spüren«. Sie sind nicht gleichzusetzen mit lebensmüden bzw. suizidalen Gedanken, bei denen der Gedanke an den erwünschten Tod im Vordergrund steht.
Aus der Praxis lassen sich drei typische Erscheinungsbilder postpartaler Depressionen beschreiben (▸ Tab. 2.3). Am häufigsten ist der »Insuffizienztyp« mit etwa zwei Drittel der Fälle, bei dem Insuffizienzgefühle (= Versagensgefühle) im Vordergrund stehen. Deutlich seltener, aber für die Betroffenen wegen ausgeprägter Schuld- und Schamgefühle mit einem enormen Leidensdruck verbunden, ist der »Zwangstyp« (etwa 20 %). Am seltensten sind Depressionen, bei denen Panikattacken im Vordergrund stehen.
Tab. 2.3:Typen postpartaler Depressionen
Typ postpartaler Depression
Im Vordergrund stehende Symptomatik
»Insuffizienztyp«
Depressive Verstimmung steht im Vordergrund mit Insuffizienzgefühlen (= Versagensgefühlen), Schuldgefühlen, der Überzeugung, eine schlechte Mutter zu sein. Die Mutter-Kind-Gefühle sind nicht in der Art vorhanden, wie die Mutter sie erwartet, was wiederum Schuldgefühle verursacht. Zusätzliche Symptome wie Konzentrationsstörungen, Antriebsmangel, Schlafstörungen, Appetitstörungen, Tagesschwankungen, Gereiztheit, lebensmüde Gedanken bis hin zur Suizidalität
»Zwangstyp«
Depressive Verstimmung mit im Vordergrund stehender Zwangssymptomatik, z. B. dem Gedanken bzw. Impuls, dem eigenen Kind etwas anzutun, es zu verletzen, zu töten etc. Verbunden mit ausgeprägten Schuld- und Schamgefühlen, Angst vor Kontrollverlust und Vermeidungsverhalten; Situationen, in denen das Kind vermeintlich »gefährdet« ist, werden vermieden. Die Depression entwickelt sich häufig nach der Zwangssymptomatik.Selten kann auch der Gedanke, sich selbst etwas anzutun, Inhalt solcher Zwangsgedanken sein. Die betroffene Frau denkt ständig daran, sich etwas anzutun, will dies aber ganz sicher nicht und hat Angst davor, dass sie das umsetzen könnte.
»Paniktyp«
Depressive Verstimmung parallel mit dem meist erstmaligen Auftreten von Panikattacken.
Einzelne Episode oder Teil einer wiederkehrenden Störung?
Die Unterscheidung zwischen der ersten depressiven Episode und einer Depression im Rahmen einer wiederkehrenden Störung ist uns wichtig, da diese beiden Formen einer postpartalen Depression von ihrer Symptomatik her zwar sehr ähnlich bzw. vergleichbar sein können, sich aber in der Gewichtung der Verursachungsfaktoren unterscheiden. Und weil auch der unterschiedliche Verlauf von Bedeutung sein kann – beispielsweise für die Planung einer weiteren Schwangerschaft.
Postpartale Depression als einzelne depressive Episode
Hier sprechen wir von der postpartalen Depression, die für die betroffenen Frauen völlig unerwartet kommt, weil sie bisher nie mit psychischen Problemen zu tun hatten. Beispiele dafür werden Sie in den Falldarstellungen und in den Erfahrungsberichten finden. Die Schwangerschaft war unkompliziert, meist auch die Geburt, und dann wird von Tag zu Tag die Stimmung immer schlechter, es schleichen sich Sorgen ein, ob man alles richtig macht. Fehlen dann noch die erwarteten Muttergefühle, dann führt das fast immer zur Überzeugung, keine gute Mutter sein zu können.
Schaut man sich die Fälle genau an, stellt man häufig fest, dass es Frauen sind, die in der Situation nur über begrenzte Unterstützungsmöglichkeiten verfügen, weil sie beispielsweise weit weg wohnen von der Familie und auch der Partner in der ersten Zeit nur begrenzt zu Verfügung steht. Wir sprechen von »unzureichender sozialer Unterstützung« – und das ist einer der wesentlichen Faktoren bei der Entstehung einer Depression.
Auch die ausgeprägten hormonellen Umstellungen nach der Entbindung spielen eine Rolle, vor allem bei Frauen, die unter zyklusabhängigen Stimmungsveränderungen bzw. einem prämenstruellen Syndrom (PMS) oder der schwersten Form, der prämenstruellen dysphorischen Störung (PMDS), leiden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die erste Geburt, weil Frauen da besonders unter Druck stehen bzw. sich selbst sehr unter Druck setzen – sie müssen sich auf viel Neues einstellen, sind unsicher und machen sich Sorgen, ob sie alles richtig machen. Auch der Übergang von der Berufstätigkeit in die neue Mutterrolle, evtl. verbunden mit einer längeren Elternzeit, kann große Verunsicherung auslösen.
Auf diese Art der Depression beziehen sich die meisten Studien, die eine Häufigkeit von 10 bis 15 % depressiver Symptome finden und in denen etwa die Hälfte, nämlich 6 – 8 %, die Kriterien einer behandlungsbedürftigen Depression erfüllen.
Postpartale Depressionen als erste, einzelne Krankheitsepisode sind in der Regel gut behandelbar