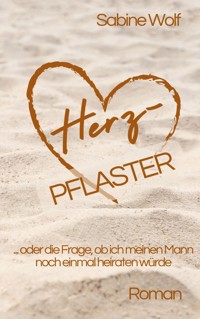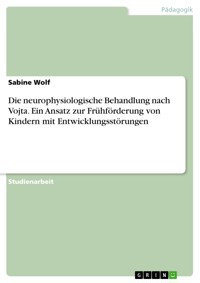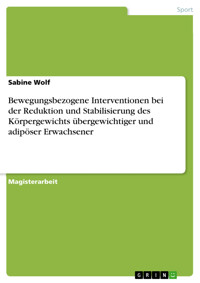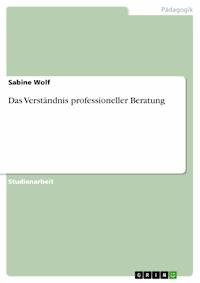Potentiale von digitalen Medien und Distance Learning Komponenten für die berufsbegleitende Weiterbildung von Führungskräften E-Book
Sabine Wolf
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,3, Technische Hochschule Rosenheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Die immer schneller werdende Veränderung der Gesellschaft und der Wirtschaft erfordert eine zunehmende und stetig anhaltende Weiterqualifizierung. Gerade Führungskräfte, die meist beruflich stark eingespannt sind, stehen vor der Frage, ob es geschickter ist, ein Weiter¬¬bildungs¬programm mit ausschließlich Präsenzanteilen zu absolvieren oder einen Fernstudiengang zu wählen und dabei auf die Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches zu verzichten. Das Konzept des Blended Learning ist die Lösung. Es ist ein integriertes Lernarrangement, in dem die heute verfüg¬baren Möglichkeiten der Vernetzung über Internet und Intranet in Verbindung mit „klassischen“ Lernmethoden optimal genutzt werden. Dabei werden Wissens¬¬vermittlung theoretischer Grundlagen online mittels Web-Based Trainings, Aus¬tausch von Erfahrungen und die Weitergaben von Spezialwissen in Präsenz¬veran¬staltungen sowie die Betreuung der Teilnehmer virtuell und individuell zielgruppengerecht mitein¬ander kombiniert. Die Erforschung der Potentiale digitaler Medien und Blended Learning Konzepten bei den Teilnehmern und den Dozenten ist praktischer Teil der Arbeit. Die Ergeb¬nisse sind durchaus positiv. Viele vorgestellte digitale Medien können sich die Befragten im Weiter¬bildungs¬bereich vorstellen und sind bereit diese zu nutzen, um die Bildung zu flexi¬bilisieren und damit ein zeit- und ortsunabhängiges Lernen zu ermöglichen. Aufbauend auf die Analyse der Potentiale werden zwei Konzepte für die Einführung von digitalen Medien im Weiter¬bildungsbereich deutlich. Noch unerfahrene Dozenten können mit der Anreicherung der Seminare durch digitale Medien erste Erkenntnisse sammeln und dieses zu einem integrierten Konzept, welches das zweite potentielle Konzept darstellt, ausbauen. Beim Integrativen Konzept werden Präsenzveranstaltungen und virtuelle Phasen miteinander verknüpft und bauen aufeinander auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
II.Inhaltsverzeichnis
I. Abstract – Schlagworte
III. Abkürzungsverzeichnis
IV. Abbildungsverzeichnis
V. Tabellenverzeichnis
Einführung
Teil A Grundlagen des Online-Lernens
1. Lerntheorien
1.1. Der Behaviorismus -Lernen als Veränderung von Verhaltensweisen
1.2. Der Kognitivismus -Lernen als aktive Informationsverarbeitung
1.3. Der Konstruktivismus -Lernen als Konstruktion von Wissen, problembasiertes Lernen
1.4. Konnektivismus -Lernen durch Netzwerkbildung
2. Theoretische Konzepte der Integration von E-Learning
2.1. E-Learning Varianten nach Back, Seufert und Kramhöller
2.2. Didaktische E-Learning Szenarien nach Dittler und Bachmann - bedarfsgerechte Gestaltung von E-Learning Angeboten
2.3. Präsenzveranstaltungen versus virtuelle Lehre
2.4. Synergien Präsens- und virtuelle Lehre
3. Blended Learning Konzepte
3.1. Kombinationsmöglichkeiten von Präsenz- und Online-Lehre
3.2. Variationsmöglichkeiten von Präsenz- und Online-Phasen
4. Wissensvermittlung beim E-Learning - Technische Voraussetzungen
4.1. Einblick in die Lernprogramme - WBT und CBT
4.2. Einblick in ein Learning-Content-Management System - LCMS
4.3. Einblick in ein Lernmanagement System - LMS
4.4. Informationstechnische Grundlagen
5. Kommunikation mit digitalen Medien
5.1. Chat
5.2. Videokonferenzen
5.3. E-Mail und Mailinglisten
5.4. Wikis
5.5. Blogs (Web-Logs)
5.6. Diskussionsforen
5.7. Podcasts - Videoaufzeichnungen
6. Erfolgreiche und nachhaltige Einführung von E-Learning
6.1. Konzeption und Gestaltung von digitalen Lernangeboten - Mediendidaktik
6.2. Entwicklung von Lernprogrammen
6.3. Evaluation von E-Learning Angeboten
6.4. Servicestelle E-Learning
7. Fazit Grundlagen des Online-Lernens
Teil B Akzeptanzstudien - Potentialanalyse
8. Akzeptanzstudie - Teilnehmer berufsbegleitender Weiterbildungsprogramme
8.1. Aufbau der Befragung
8.2. Auswertung der ersten Potentialanalyse
8.3. Fazit Auswertung Teilnehmer
9. Akzeptanzstudie - Dozenten berufsbegleitender Weiterbildungsprogrammen
9.1. Aufbau der Befragung
9.2. Auswertung der zweiten Potentialanalyse
9.3. Fazit Auswertung Dozenten
10. Zusammenfassung der Auswertungen - Dozenten und Teilnehmer
Teil C Konzept E-Learning
11. Konzept 1
12. Konzept 2
13. Zusammenfassung und Ausblick
VI. Quellen- / Literaturverzeichnis
VII. Anlagenverzeichnis
I. Abstract – Schlagworte
Die immer schneller werdende Veränderung der Gesellschaft und der Wirtschaft erfordert eine zunehmende und stetig anhaltende Weiterqualifizierung. Gerade Führungskräfte, die meist beruflich stark eingespannt sind, stehen vor der Frage, ob es geschickter ist, ein Weiterbildungsprogramm mit ausschließlich Präsenzanteilen zu absolvieren oder einen Fernstudiengang zu wählen und dabei auf die Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches zu verzichten. Das Konzept desBlended Learningist die Lösung. Es ist ein integriertes Lernarrangement, in dem die heute verfügbaren Möglichkeiten der Vernetzung über Internet und Intranet in Verbindung mit „klassischen“ Lernmethoden optimal genutzt werden. Dabei werden Wissensvermittlung theoretischer Grundlagen online mittels Web-Based Trainings, Austausch von Erfahrungen und die Weitergaben von Spezialwissen in Präsenzveranstaltungen sowie die Betreuung der Teilnehmer virtuell und individuell zielgruppengerecht miteinander kombiniert.
Die Erforschung der Potentiale digitaler Medien und Blended Learning Konzepten bei den Teilnehmern und den Dozenten ist praktischer Teil der Arbeit. Die Ergebnisse sind durchaus positiv. Viele vorgestellte digitale Medien können sich die Befragten im Weiterbildungsbereich vorstellen und sind bereit diese zu nutzen, um die Bildung zu flexibilisieren und damit ein zeit- und ortsunabhängiges Lernen zu ermöglichen. Aufbauend auf die Analyse der Potentiale werden zwei Konzepte für die Einführung von digitalen Medien im Weiterbildungsbereich deutlich. Noch unerfahrene Dozenten können mit der Anreicherung der Seminare durch digitale Medien erste Erkenntnisse sammeln und dieses zu einem integrierten Konzept, welches das zweite potentielle Konzept darstellt, ausbauen. Beim Integrativen Konzept werden Präsenzveranstaltungen und virtuelle Phasen miteinander verknüpft und bauen aufeinander auf.
Schlagworte:
Blended Learning | Digitale Medien | E-Learning | Lebenslanges Lernen | Weiterbildung
The acceleratingsocialand economic developmentsintheworkingenvironment lead to a growing necessity of advanced education programs for professionals. Especially managers, who are confronted to high time restrains, face the question whether it is smarter to complete an advanced education program implying a high physical presence, or to rather opt for a distance education program losing the opportunities to exchange experiences with participants and lecturers.
The concept of “Blended Learning” offers an attractive solution. It implies an integrated learning package, where the networking opportunities, nowadays available via the Internet and Intranet are used optimally in conjunction with traditional learning methods. It combines the knowledge transfer via online web-based training with the transfer of expertise during inclass lectures and it offers an individual virtual supervision of the participants.
The exploration of the potentials of digital media and “Blended Learning” concepts regarding the participants and the lectures of such programs represent the framework of this paper. There sulting evaluations draw a very optimistic picture. A significant number of interviewees show a high disposition to use digital media in advanced education programs in order to adapt their educational programs, time wise and location wise. Based on the analysis of potentials, two concepts for the introduction of digital media appear to be significant for the advanced education sector.
In a first step in experienced instructors use the accumulation of seminars via digital media to gain experience, which represent the first concept. In a second integrated approach the lecturers combine the in-class courses with the virtual course tools, obtaining a heterogenic mix for an individual education success.
Tags:
Blended Learning | Digitale Medien | E-Learning | Lifelong Learning | Further Education
III. Abkürzungsverzeichnis
CBT - Computer-Based Training
CMS - Content-Management System
LCMS - Learning- und Content-Management Systems
LMS - Lern-Management Systems
WBT - Web-Based Training
IV. Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Aufbau Masterarbeit
Abbildung 2 Theorien in der betrieblichen Bildung (vgl. u. a. Baumgartner, P. und Kalz, M. 2004)
Abbildung 3 Verschiedene E-Learning Varianten nach Back, Seufert und Kramhöller (in Anlehnung an Back et al., 1998)
Abbildung 4 E-Learning Szenarien nach Dittler und Bachmann
Abbildung 5 Vor- und Nachteile der Präsenzlehre und der virtuellen Lehre
Abbildung 6 Verknüpfung der Vorteile der Präsenzlehre und der virtuellen Lehre
Abbildung 7 Kombinationsformen von Präsenzlehre und Online-Lehre (in Anlehnung an Freie Universität Berlin)
Abbildung 8 Anreicherungskonzept
Abbildung 9 Integratives Konzept
Abbildung 10 Virtuelles Konzept
Abbildung 11 Beispiele der Verteilung von Online-Phasen und Präsenzphasen (in Anlehnung an Prof. Dr. Mandl, LMU, 2010)
Abbildung 12 Beispiel Didaktisches Konzept (in Anlehnung an Prof. Dr. Mandl, LMU, 2010)
Abbildung 13 Asynchrone und synchrone Kommunikationsinstrumente
Abbildung 14 Ablauf Produktion Lernprogramm
Abbildung 15 Flowchart Fragebogen Weiterbildungsteilnehmer
Abbildung 16 Flowchart Fragebogen Dozenten
Abbildung 17 Übersicht Potentiale digitale Medien (Teilnehmer / Dozenten)
Abbildung 18 Übersicht Potentiale Lehrinhalte (Teilnehmer / Dozenten)
Abbildung 19 Konzept 1
Abbildung 20 Konzept 2
Abbildung 21 Aufbau Online- und Präsenzphasen beim integrativen Konzept
Abbildung 22 Digitale Medien für den E-Learning-Anteil
V. Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Menge Fragebogenversand und Beantwortung
Tabelle 2 Frage 19: Ihre Arbeitssituation?
Tabelle 3 Frage 3: Wie hoch ist Ihre Bereitschaft E-Learning zu nutzen?
Tabelle 4 Frage 6: Sie haben die Möglichkeit, die Präsenzzeit durch Online-Lernen teilweise zu ersetzen. Wie hoch sollte für Sie maximal der Anteil am Online-Lernen sein?
Tabelle 5 Frage 10: Eine Präsenzveranstaltung (Einführung) zu Beginn des Moduls
Tabelle 6 Frage 10: Eine zusammenfassende Präsenzveranstaltung am Ende des Moduls
Tabelle 7 Frage 13: Austausch im Seminarraum
Tabelle 8 Frage 13: Austausch im Chatroom (schriftlich), z.B. Skype
Tabelle 9 Frage 13: Austausch per E-Mail
Tabelle 10 Frage 13: Austausch im Diskussionsforum (schriftlich) über den ganzen Zeitraum des Moduls (es kann immer wieder ergänzt werden)
Tabelle 11 Frage 13: Austausch per Teiefon-Zvideokonferenz
Tabelle 12 Menge Fragebogenversand und Beantwortung
Tabelle 13 Frage 7: Wie Hoch ist Ihre Bereitschaft E-Learning zu nutzen?
Tabelle 14 Frage 10: Wie attraktiv finden Sie folgende drei Konzepte für die Lehre (Konzept 1).
Tabelle 15 Frage 10: Wie attraktiv finden Sie folgende drei Konzepte für die Lehre (Konzept 2).
Tabelle 16 Frage 12: Wie hoch wäre für Sie als Dozent die ideale Aufteilung zwischen PräsenzAnteile und E-Learning Anteilen.
Einführung
Die Gesellschaft und die Wirtschaft verändern sich mit zunehmender Geschwindigkeit. Das Wirtschaften erfolgt immer globaler. Es entstehen dadurch neue Netzwerke. Die strategische Gestaltung des Unternehmens an veränderte Wettbewerbsbedingungen muss kontinuierlich angepasst werden. Dies erfordert entsprechende Kompetenzen bei den Führungskräften. Die Erstausbildung reicht in den meisten Fällen nicht mehr, um eine dreißig bis vierzig Jahre lange berufliche Laufbahn erfolgreich zu meistern. Dementsprechend hat sich der Stellenwert der Bildung in den Unternehmen verändert. Berufliche Weiterbildung und lebenslanges Lernen werden verstärkt als Erfolgsfaktor gesehen. Auch im Erwachsenenalter nach der Erstausbildung wird es stets erforderlich sein, sich neues Wissen anzueignen. Die Entwicklung zu einerInformations-und Wissensgesellschaft macht es notwendig, dass eine ständige Weiterbildung und Weiterqualifizierung des Einzelnen vorausgesetzt wird. Lernen im Erwachsenenalter stellt somit einen lebenslangen Prozess dar. Die berufliche Weiterbildung verfolgt das Ziel, berufsrelevante Kompetenzen und Qualifikationen zu vermitteln. Der Fokus des Lernens, welcher räumlich und zeitlich losgelöst vom beruflichen Alltag ist, entwickelt sich hin zu einem arbeitsplatzintegrierten Lernen. In diesem Zusammenhang gewinnt der Einsatz von E-Learning stärker an Bedeutung.[1] Sich neben dem Arbeitsfeld weiterzubilden, heißt mit einem knappen Zeitbudget durch Beruf, Familie oder andere persönliche Verpflichtungen auszukommen. Hieraus ergeben sich hohe Erwartungen an die zeitlich-räumliche Flexibilität eines Weiterbildungsangebots. Daneben ist zu berücksichtigen, dass Führungskräfte bereits berufliche Erfahrungen mitbringen und entsprechend praxisrelevante Kompetenzen ausbauen wollen. Insofern ergeben sich andere Erwartungen und Voraussetzungen als bei Teilnehmer grundständiger Ausbildungen.
Die schnelle Verbreitung von leistungsfähigen Computern und die weltweite Vernetzung durch das Internet haben für das Thema E-Learning weiterhin enorm an Bedeutung gewonnen. Die Entwicklung von digitalen Medien und Distance Learning Komponenten eröffnet neue Wege der Kommunikation und Information. Es entstehen immer wieder neue Möglichkeiten für das Lernen und somit auch für die Weiterbildung im Kontext „Lebenslanges Lernen“. Durch den Medieneinsatz können die traditionellen Lehrveranstaltungsformen (Präsenzlehre) aufgebrochen werden und Präsenzzeiten reduziert werden. Die Flexibilisierung der zeitlichen und räumlichen Organisation kann durch mediengestützte Lernangebote sinnvoll eingelöst werden. Die Grenzen zwischen dem Lernen und dem Beruf können dabei fließend ineinander übergehen. E-Learning bietet den Unternehmen die Möglichkeit, Führungskräfte berufsbegleitend weiterzubilden und zu spezialisieren. Die Unternehmen steigern so ihre Wettbewerbsfähigkeit und können dem Konkurrenzdruck entgegenwirken. Aber allein die Einführung von neuen Medien führt nicht automatisch zu Verbesserungen in der Bildung. Der Einsatz von digitalen Medien birgt aber das Potential, die Bildung zu unterstützen.
Auf dem Markt bereits vorhandene Konzepte und Lösungen zur Anreicherung herkömmlicher Präsenzveranstaltungen bis hin zu einer umfassenden Virtualisierung versprechen ein rundum Lehr- und Lernkonzept. Es lohnt sich zu hinterfragen, welche digitalen Lehr- und Lernkonzepte Potential für den Weiterbildungsbereich haben und somit das Lernen und Weiterbilden für berufstätige Führungskräfte erleichtern. Die Leistung besteht darin, digitale Medien so zu kombinieren und einzusetzen, dass Wissen und Kompetenzen nachhaltig aufgebaut werden. Des Weiteren soll durch den Einsatz digitaler Medien die Vermittlung von Wissen und Kompetenzen erleichtert und flexibilisiert werden.[2]
Zielsetzung und Gang der Untersuchung
Das Ziel dieser Masterarbeit ist die Analyse der „Potentiale von digitalen Medien undDistance LearningKomponenten für die berufsbegleitende Weiterbildung von Führungskräften“. E-Learning undDistance LearningKomponenten sind wesentliche Elemente, um die Lehre zu flexibilisieren, Präsenzzeiten bei der berufsbegleitenden Weiterbildung zu reduzieren sowie zeit- und ortsunabhängiges Lernen zu ermöglichen.
Führungskräfte, die bereits mitten im Beruf stehen, unterscheiden sich in ihrer Art zu Lernen von Studierenden grundständiger Studiengänge. Die Teilnehmer sind in unterschiedlichen Arbeitsfeldern tätig, verfügen so über unterschiedliche Berufserfahrungen und unterscheiden sich in ihrem Alter gegenüber den grundständigen Ausbildungen. Ebenso bringen sie unterschiedliche Interessen, Kompetenzen und Lernstrategien mit ein und verfolgen unterschiedliche Ziele mit der Weiterbildung. Oft zahlen die Teilnehmer hohe Gebühren und stellen somit auch hohe Erwartungen an die inhaltliche und methodisch-didaktische Qualität.[3]
Bei der Einführung von E-Learning in der berufsbegleitenden Weiterbildung ergeben sich viele Fragen:
- Was heißt E-Learning und welche E-Learning Konzepte gibt es?
- Wie kann die Präsenzlehre durch digitale Medien unterstützt und / oder ergänzt werden?
- Was sind die Vorteile der Präsenzlehre sowie der virtuellen Lehre?
- In welcher Mischung sollen Präsenz- und Online-Lernen angeboten werden?
- Welche Vor- und Nachteile haben digitale Kommunikationsmittel und wie können diese eingesetzt werden?
- Welcher Einsatz von digitalen Medien ist von Seiten der Weiterbildungsteilnehmer gewünscht?
- Wie können digitale Medien mit den gewünschten Einsatzformen seitens der Teilnehmer zu einem effizienten und erfolgreichen Weiterbildungsangebot konzipiert werden?
- Wie hoch sehen die Dozenten die Potentiale digitaler Medien für die Lehrveranstaltungen und welchen Einsatz von Distance Learning Komponenten können sie sich vorstellen?
Die Antworten auf die oben genannten Fragen werden in der Arbeit nach und nach erarbeitet.
Die folgende Grafik gibt einen Überblick über den Aufbau der Masterarbeit.
Abbildung 1 Aufbau Masterarbeit
Nach der Einführung werden im Teil A die theoretischen Grundlagen aufgeführt. Sie teilen sich in die Abschnitte Lerntheorien, Möglichkeiten der theoretischen Integration von E-Learning, Vorstellung der Blended Learning Konzepte und der technischen Wissensvermittlung bei den Online-Phasen. Die Vorstellung der digitalen Kommunikationsinstrumente und das abschließende Kapitel, wie E-Learning erfolgreich und nachhaltig eingeführt werden kann, runden die theoretischen Grundlagen ab. Aufbauend darauf werden im Teil B die Potentiale im Weiterbildungsbereich untersucht. Dazu wurden zwei Akzeptanzstudien durchgeführt. Die erste Akzeptanzstudie richtet sich an die Teilnehmer berufsbegleitender Weiterbildungsprogramme. Die zweite Akzeptanzstudie richtet sich an die Dozenten berufsbegleitender Weiterbildungsprogramme. Schlussfolgernd aus den Ergebnissen der Befragungen, werden im Teil C zweiBlended LearningKonzepte auf Basis der theoretischen Grundlagen und der Ergebnisse der Befragungen entwickelt.
Teil A Grundlagen des Online-Lernens
Die Vermittlung von Wissen und Werten ist wesentliche Voraussetzung für den Aufbau von Kompetenzen und die Weiterbildung von Führungskräften. Doch wie kann Wissen grundsätzlich vermittelt werden? Welche lernpsychologischen Voraussetzungen sind zu beachten und welche technischen Mittel gibt es dafür? Wie können digitale Medien den Aufbau von Wissen unterstützen? Welche Lernkonzepte existieren und eignen sich für die berufsbegleitende Weiterbildung? Die Grundlagen des Online-Lernens sollen Einblick in den theoretischen Hintergrund geben und aufzeigen, wie E-Learning Konzepte auf die Bedürfnisse der Teilnehmer konzipiert und umgesetzt werden. Das Lernen mit neuen Medien hat mehrere Entwicklungsphasen durchlaufen. Es gab vielfältige Versuche, neue Medien in die Bildung zu integrieren. Überwiegend wurden Insellösungen erstellt. Seit der Jahrtausendwende wurde verstärkt nach pädagogisch sinnvollen Lösungen gestrebt. Lehr- und Lernformen werden seitdem verstärkt mit Sozialformen und digitalen Medien bedarfsgerecht auf die Lernziele ausgerichtet. E-Learning Komponenten wurden zu ganzheitlichen Lernkonzepten weiterentwickelt. Die Vorteile der Präsensveranstaltungen wurden mit denen des virtuellen Lernens zum Konzept des Blended Learnings verbunden.
In den theoretischen Grundlagen wird zuerst anhand von vier Lerntheorien aufgezeigt, woran Online-Lernprogramme sich psychologisch orientieren sollten, um größtmögliche Lerneffekte zu erlangen. Es werden theoretische Modelle vorgestellt, wie E-Learning grundsätzlich in die Bildung integriert werden kann und wie die Verknüpfung und Kombination von Präsenzphasen mit den virtuellen Phasen erfolgen kann. Die Kommunikation als wesentliches Element der Bildung darf während der Online-Phasen nicht fehlen. Am Markt existierende Instrumente und deren möglicher Einsatz werden im weiteren Verlauf der Arbeit erläutert. Weitergehend wird vorgestellt, wie die Wissensvermittlung beim E-Learning erfolgt, wie Lernprogramme entwickelt und welche technischen Grundlagen zur Gestaltung von Lernprogrammen benötigt werden.
Vorab gilt es die wichtigsten Begriffe zu erklären. Weiterbildung ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer ersten Bildungsphase und nach Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Weiterbildung bezeichnet alle Lernprozesse, in denen Erwachsene ihr Wissen erweitern bzw. ihre fachlichen und beruflichen Kompetenzen verbessern oder neu ausrichten. Ganz klassisch erfolgt die Weiterbildung über Präsenzveranstaltungen. Ebenso kann sich Wissen über Distance Learning Angebote (Fernunterricht) angeeignet werden.
BeimDistance Learningsind die Lehrenden von den Lernenden getrennt. Die Kenntnisse und Fähigkeiten werden ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt vermittelt. Fernlehrgänge können durchaus Präsenzseminare umfassen, der überwiegende Teil des Lernstoffs wird im Gegensatz zum Präsenzunterricht räumlich vom Lernenden getrennt vermittelt. Dadurch ist ein individuelles Lernen, unter freier Zeiteinteilung, möglich.[4]
Seit der rasanten Entwicklung des Internets Mitte der 1990er Jahre kam es zunehmend auch in allen Bereichen des Lehrens und Lernens zu neuen Innovationen. Die Fortschritte haben den Einsatz von digitalen Medien immens verstärkt und der Begriff E-Learning hat sich etabliert. Das „E“ in E-Learning steht fürelectronicund bedeutet, dass digitale Medien in die Lehre integriert werden. Mit E-Learning werden alle Formen des Lernens beschrieben, bei denen digitale Medien für die Verbreitung und Präsentation von Lernmaterialien in Lernprozessen zum Einsatz kommen. E-Learning wird in Offline- und Online-Lernen unterschieden.
Mit Offline-Lernen wird Lernen mit digitalen Medien und Computern ohne Netzverbindung, wie z.B. Lernen per CD oder DVD bezeichnet. Dagegen werden beim Online-Lernen zusätzlich Netzwerke, vor allem das Internet, vorausgesetzt. Beim Online-Lernen werden über verschiedene Kommunikationskanäle und digitale Medien Informationen in Form von Bildern, Texten, Ton- und Videodateien versendet, heruntergeladen, gespeichert und weiterverarbeitet. Lernende können ihr Wissen z.B. durch einen schnellen Zugriff auf sämtliche Daten im Web, das Kopieren und Weiterverarbeiten von Dateien, die interaktive Kommunikation mit anderen Teilnehmern und dem Dozenten generieren. Dies ermöglicht größtenteils eine zeitliche und ortsunabhängige Erarbeitung des Wissens.[5] Online-Lernen erlaubt komplexere Lernszenarien und effiziente asynchrone und synchrone Interaktion und Kommunikation zwischen den Teilnehmern von Lernsituationen. In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe E-Learning und Online-Lernen gleichbedeutend verwendet.