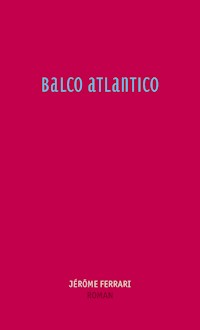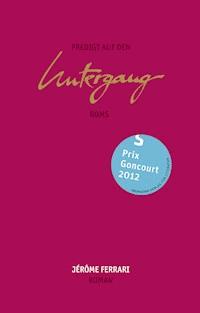
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Secession Verlag für Literatur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Der Autor gewann mit diesem in Frankreich gefeierten Titel 2012 den renommierten Prix Goncourt. Ein korsisches Dorf. Das Leben, vom Alltag bestimmte Monotonie. Sommer, Hitze, Jagd auf Wild, wiederkehrend Tag um Tag. Und dann: ein Ereignis, eine Erschütterung. Folgenreich. Wie der Flügelschlag eines Schmetterlings. Zur allgemeinen Verwunderung haben zwei Söhne des Dorfes ihr vielversprechendes Philosophiestudium auf dem Kontinent vorzeitig beendet und übernehmen die Dorfkneipe. Um ganz im Sinne der Leibnizschen Lehre in ihrem Dorf die "beste aller möglichen Welten" zu errichten. Aber: es richtet sich die Hölle selbst am Tresen ein. Und es wird eine korsische Dorfkneipe zur Weltenbühne des menschlichen Dramas. Mit prächtiger Sprache erzählt, dicht und bildkräftig, ein Wunder an Ausgewogenheit von Wucht, Weite, Tiefe und Leichtigkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PREDIGT AUF DEN
Untergang
ROMS
JÉRÔME FERRARI
PREDIGT AUF DEN
Untergang
ROMS
JÉRÔME FERRARIROMAN
Aus dem Französischen von Christian Ruzicska
Titel des französischen Originals: Le sermon sur la chute de Rome
© 2012 ACTES SUD, ARLES
Erste Auflage
© 2013 by Secession Verlag für Literatur, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Christian Ruzicska
Lektorat: Alexander Weidel
Korrektorat: Patrick Schär
Handschrift: Friederike Straub
www.secession-verlag.com
ISBN 978-3-905951-20-2eISBN 978-905951-58-5
Meinem Großonkel Antoine Vesperini
Inhalt
»Möglich, dass Rom nicht zugrunde gegangen ist, wenn die Römer nicht zugrunde gehen.«
»Empfindet also, Brüder, keine Vorbehalte gegenüber den Strafen Gottes.«
»Du, siehe, was Du bist. Denn unabwendbar kommt das Feuer.«
»Was der Mensch schafft, das zerstört der Mensch.«
»Wohin wirst Du gehen außerhalb der Welt?«
»Denn Gott hat für Dich nur eine verderbliche Welt geschaffen.«
Predigt auf den Untergang Roms
Anmerkung des Autors zur französischen Originalausgabe
Anmerkung des Übersetzers zur deutschsprachigen Ausgabe
Weitere Titel aus dem Verlagsprogramm
Du bist darüber verwundert, dass die Welt an ihr Ende kommt? Wundere Dich eher, sie ein so hohes Alter erreicht haben zu sehen. Die Welt ist wie ein Mensch: Sie wird geboren, sie wird groß und sie stirbt. (…) In seinem Greisenalter ist der Mensch mit Elend erfüllt, und die Welt in ihrem Greisenalter ist ebenfalls mit Unheil erfüllt. (…) Christus spricht zu Dir: Die Welt vergeht, die Welt ist alt, die Welt verendet, die Welt ist bereits keuchend und überaltert, fürchte jedoch nichts: Deine Jugend wird sich erneuern wie die des Adlers.
Augustinus
Sermones 81, §8, Dezember 410
»Möglich, dass Rom nicht zugrunde gegangen ist, wenn die Römer nicht zugrunde gehen.«
Als Bezeugung der Ursprünge – als Bezeugung vom Ende wäre da also diese Photographie, aufgenommen im Sommer 1918, in deren Betrachtung Marcel Antonetti sich sein Leben lang vergeblich verbissen hatte, um das Rätsel der Abwesenheit in ihr zu entschlüsseln. Man sieht seine fünf Geschwister mit seiner Mutter darauf abgebildet. Um sie herum ist alles milchig weiß, weder Wände noch Boden sind auszumachen, und sie scheinen wie Gespenster in dem merkwürdigen Nebel zu schweben, der sie bald schon verschlucken und auslöschen wird. Sie sitzt in Trauer gekleidet da, starr und alterslos, ein dunkles Tuch umhüllt ihren Kopf, die Hände ruhen flach auf den Knien, und sie blickt so intensiv auf einen Punkt jenseits des Objektivs, dass man meinen möchte, sie sei gleichgültig gegenüber allem Anwesenden um sie herum: dem Photographen samt seinen Instrumenten, dem Licht des Sommers und ihren eigenen Kindern – ihr Sohn Jean-Baptiste, mit Bommelmütze, gezwängt in einen zu eng sitzenden Matrosenanzug, wie er sich ängstlich an sie schmiegt, ihre drei älteren Töchter, in einer Reihe hinter ihr, alle steif und in Sonntagstracht, die Arme dicht an den Körper gepresst, und, allein im Vordergrund, die jüngste, Jeanne-Marie, barfüßig und in Lumpen, die ihr leichenblasses und schmollendes kleines Gesicht hinter den verwirbelten Strähnen ihres schwarzen Haars verbirgt. Und jedes Mal, wenn er den Blick seiner Mutter kreuzt, erfasst Marcel die unumstößliche Gewissheit, dass er ihm gilt und dass sie damals schon bis tief hinein in die Vorhölle nach den Augen des Sohnes Ausschau hielt, den es noch zu gebären galt und den sie nicht kannte. Denn auf dieser an einem glühend heißen Tag im Sommer 1918 im Schulhof aufgenommenen Photographie, wo ein fliegender Photograph weißes Leintuch zwischen zwei Stangen gespannt hatte, betrachtet Marcel vor allem das Schauspiel seiner eigenen Abwesenheit. All jene, die ihn bald schon mit ihrer Sorge, vielleicht mit ihrer Liebe umhegen würden, sind da, in Wahrheit aber denkt niemand an ihn und er fehlt niemandem. Sie haben ihre Festtagskleidung, die sie so gut wie nie anlegen, aus einem mit Naphthalin ausgelegten Wandschrank genommen und Jeanne-Marie dabei trösten müssen, die erst vier ist und weder ein neues Kleid besitzt noch Schuhe, bevor sie dann gemeinsam Richtung Schule gegangen sind, glücklich wahrscheinlich darüber, dass sich endlich etwas ereignet, was sie einen Augenblick lang aus der Monotonie und Einsamkeit ihrer Kriegsjahre reißt. Der Schulhof ist voller Menschen. Den ganzen Tag über hat der Photograph in der glühenden Hitze des Sommers 1918 Frauen und Kinder porträtiert, Behinderte, Greise und Priester, die alle der Reihe nach vor sein Objektiv traten, auf dass auch sie so eine Atempause fänden, und Marcels Mutter und seine Geschwister hatten geduldig gewartet, bis sie an der Reihe waren, und unterdessen immer wieder einmal Jeanne-Maries Tränen getrocknet, die sich ihres zerlöcherten Kleides und ihrer nackten Füße schämte. Im Moment der Aufnahme weigerte sie sich, mit den anderen zu posieren, und so musste hingenommen werden, dass sie in vorderster Reihe aufrecht blieb, ganz allein, im Schutz ihres strubbeligen Haars. Sie sind vereint und Marcel ist nicht da. Und doch, aufgrund der Hexerei einer unbegreifbaren Symmetrie, jetzt, da er einen nach dem anderen zu Grabe getragen, existieren sie nur noch dank seiner und der Hartnäckigkeit seines treuen Blickes, er, an den sie noch nicht einmal dachten, als sie ihren Atem anhielten und der Photograph den Auslöser seines Apparates bediente, er, der nun ihr einziger, fragiler Schutzwall ist gegen das Nichts, und genau deshalb nimmt er dieses Photo auch wieder aus der Schublade, in der er es sorgfältig aufbewahrt, obgleich er es verachtet, wie er es im Grunde genommen immer schon verachtet hat, denn sollte er eines Tages versäumen, dies zu tun, nichts bliebe von ihnen, das Photo würde wieder zu einer bewegungslosen Anordnung schwarzer und grauer Flecke und Jeanne-Marie für immer aufhören, ein kleines, vierjähriges Mädchen zu sein. Er mustert sie manchmal zornig, möchte ihnen ihren Mangel an Hellsichtigkeit vorwerfen, ihre Undankbarkeit, ihre Gleichgültigkeit, aber er trifft auf die Augen seiner Mutter und stellt sich vor, dass sie ihn wahrnimmt, bis tief hinein in die Vorhölle, die noch zu gebärende Kinder gefangen hält, und dass sie auf ihn wartet, selbst wenn Marcel es in Wahrheit nicht ist und es auch nie war, den sie verzweifelt mit Blicken sucht. Denn weit jenseits des Objektivs sucht sie den, der sich aufrecht halten sollte an ihrer Seite und dessen Abwesenheit so gleißend ist, dass man meinen möchte, diese Photographie sei im Sommer 1918 nur aufgenommen worden, um sie greifbar zu machen und eine Spur von ihr zu erhalten. Marcels Vater wurde in den Ardennen während der ersten Kämpfe gefangen gesetzt und arbeitet seit Kriegsbeginn in einem Salzbergwerk in Niederschlesien. Alle zwei Monate schickt er einen Brief, den er von einem seiner Kameraden schreiben lässt und den die Kinder lesen, bevor sie ihn laut der Mutter übersetzen. Die Briefe benötigen so viel Zeit, zu ihnen zu gelangen, dass sie stets Angst haben, nur noch das Echo der Stimme eines Toten zu vernehmen, getragen von unbekannter Schrift. Aber er ist nicht tot und er kommt im Februar 1919 zurück ins Dorf, damit Marcel das Licht der Welt erblicken kann. Seine Wimpern sind verbrannt, seine Fingernägel von der Säure wie abgefressen und an seinen spröden Lippen sieht man weiße Spuren toter Haut, die er nie mehr loswerden sollte. Er hat wahrscheinlich seine Kinder angeblickt, ohne sie wiederzuerkennen, seine Frau aber hatte sich nicht verändert, strahlte sie doch nie den Eindruck von Jugend oder Frische aus, und er hatte sie an sich gepresst, wobei Marcel nie verstanden hatte, was den einen ihrer beiden vertrockneten und zerschundenen Körper sich hatte an den anderen pressen lassen, Begehren konnte das nicht gewesen sein, nicht einmal ein animalischer Instinkt, vielleicht geschah es nur, da Marcel ihrer Umklammerung bedurfte, um die Vorhölle zu verlassen, aus deren Tiefen er, die Geburt erwartend, schon so lange hervorlugte, und es passierte also als Antwort auf seinen schweigsamen Ruf, dass sie einer auf den anderen krochen in dieser Nacht im Dunkel ihres Zimmers, ohne Lärm zu machen, um Jean-Baptiste und Jeanne-Marie nicht zu alarmieren, die zu schlafen vorgaben, ausgestreckt auf ihren Matratzen in einer Ecke des Raumes, mit klopfendem Herzen angesichts des Rätsels an Ächzern und heiseren Seufzern, die sie verstanden, ohne sie benennen zu können, vom Schwindel gepackt angesichts der Wucht des Geheimnisses, das so nah bei ihnen der Intimität Gewalt beimengte, während ihre Eltern bestialisch sich darin erschöpften, ihre Körper aneinander zu reiben und die Trockenheiten ihres eigenen Fleisches auswrangen und sondierten, um deren alte, von Traurigkeit, Trauer und Salz zum Versiegen gebrachten Quellen wiederzubeleben und aus den Tiefen ihrer Bäuche emporzuschöpfen, was noch verblieben war an Sekreten und Schleim, und wäre es auch nur eine Spur Feuchtigkeit, ein Hauch Flüssigkeit, die dem Leben als Blütenboden dient, ein einziger Tropfen, und sie hatten sich derart angestrengt, dass dieser singuläre Tropfen schließlich hervorgequollen kam und sich zwischen ihnen verflüssigte und das Leben weitergab, obgleich sie selbst ja kaum mehr lebendig waren. Marcel hatte sich immer vorgestellt – er hatte immer befürchtet, nicht gewollt, sondern nur auferlegt worden zu sein von einer undurchdringlichen kosmischen Notwendigkeit, die es ihm erlaubt hatte, im trockenen und feindseligen Bauch seiner Mutter zu gedeihen, während ein übel riechender Wind sich erhob und von der See kommend über die modrigen Ebenen die Ausdünstungen einer tödlichen Grippe mit sich trug und durch die Dörfer fegte und dutzendweise jene in hastig ausgehobene Gräben warf, die den Krieg überlebt hatten, ohne dass ihn irgendetwas hätte aufhalten können, der Giftfliege aus den alten Sagen gleich, diese aus der Verwesung eines unheilvollen Schädels geborene Fliege, die eines Morgens plötzlich aus dem Nichts seiner Augenhöhlen hervorgekrochen war, um ihren giftigen Odem auszudünsten und sich am Leben der Menschen zu nähren, bis sie so monströs groß geworden war und ihr Schatten ganze Dörfer in dunkle Nacht warf, dass allein der Speer des Erzengels sie endlich niederstrecken konnte. Der Erzengel aber hatte seit Langem schon seinen himmlischen Aufenthalt wieder eingenommen, wo er taub blieb gegen die Gebete und Prozessionen, er hatte sich abgewandt von denen, die da starben, angefangen bei den Schwächsten, den Kindern, den Alten, den schwangeren Frauen, Marcels Mutter aber blieb aufrecht, unerschütterlich und traurig, und der Wind, der unablässig um sie herum blies, verschonte ihren Herd. Er legte sich schließlich, einige Wochen vor Marcels Geburt, und übergab den Raum der Stille, die sich auf die mit Brombeeren und Unkraut überwucherten Felder senkte, auf die zusammengesackten Steinmauern, auf die verlassenen Schafställe und die Gräber. Als man ihn aus dem Bauch seiner Mutter zog, blieb Marcel lange Sekunden reglos und still, bevor er kurz einen schwachen Schrei ausstieß, und man musste sich seinen Lippen nähern, um die Wärme einer verschwindend geringen Atmung wahrzunehmen, die auf den Spiegeln keine Kondensspur bildete. Seine Eltern ließen ihn noch in gleicher Stunde taufen. Sie setzten sich nah an seine Wiege und blickten auf ihn voller Nostalgie, als hätten sie ihn schon verloren, und so blickten sie ihn dann auch seine gesamte Kindheit über an. Beim harmlosesten Fieber, bei jeder Übelkeit, bei jedem Hustenanfall wachten sie über ihn wie über einen Sterbenden und nahmen jede Genesung wie ein Wunder auf, von dem nicht erwartet werden durfte, dass es sich wiederhole, denn nichts erschöpft sich schneller als die unwahrscheinliche Barmherzigkeit Gottes. Aber Marcel hörte nicht auf zu genesen und er lebte, und zwar ebenso hartnäckig, wie er zerbrechlich war, als hätte er in der dunklen Trockenheit des Bauches seiner Mutter in einem Grade gelernt, all seine schwachen Kräfte so konzentriert der erschöpfenden Schinderei des Überlebens zu widmen, dass ihn dies schließlich unverwundbar hatte werden lassen. Ein Dämon, vor dessen Sieg es den Eltern graute, schlich unaufhörlich um ihn herum, aber Marcel wusste, dass er nicht obsiegen würde, er hatte ihn noch so sehr entkräftet tief in die Kissen seines Bettes werfen, ihn mit Durchfällen und Kopfschmerzen ausmergeln können, er obsiegte nicht, er hatte sich sogar in ihm niederlassen können, um die Feuer des Geschwürs anzuheizen und ihn Blut spucken zu lassen, mit solcher Gewalt, dass Marcel ein ganzes Jahr lang der Schule fernbleiben musste, er obsiegte nicht, Marcel stand schließlich immer wieder auf, wenn er auch in seinem Magen beständig die Anwesenheit einer auf der Lauer liegenden Hand fühlte, die darauf wartete, ihm die zarten Schleimhäute mit den Enden ihrer schneidend scharfen Finger auszureißen, denn dergestalt musste das Leben sein, das ihm gegeben worden war, stets bedroht und stets triumphierend. Er sparte mit seinen Kräften, seinen Empfindungen, seinen Freuden, sein Herz sprang nicht in die Luft, als Jeanne-Marie schreiend nach ihm suchte, Marcel, komm schnell, da vorn fliegt ein Mann vor dem Brunnen, und seine Augen funkelten nicht, als er den ersten Radfahrer erblickte, den man je durchs Dorf hatte fahren sehen und der den Weg so schnell hinunterraste, dass seine Rockschöße hinter ihm wie die Flügel eines Stelzvogels aufflatterten, und ohne innere Regung sah er seinen Vater sich bei Morgengrauen erheben, um Felder zu bestellen, die nicht sein Eigen waren, und sich um Tiere zu kümmern, die nicht ihm gehörten, während allerorts die Kriegerdenkmäler erstanden, auf denen Frauen aus Bronze, die seiner Mutter ähnelten, mit erhabener und entschiedener Geste das Kind, das sie dem Vaterland zu opfern billigten, den Soldaten zur Seite gaben, die offenen Mundes mit geschwenkter Flagge fielen, als müsste einer verschwundenen Welt, nachdem ihr der Preis für Fleisch und Blut entrichtet worden war, jetzt auch der Tribut an Symbolen gezollt werden, den sie einforderte, um definitiv zu verschwinden und endlich einer neuen Welt ihren Platz zu überlassen. Aber nichts geschah, eine Welt war in der Tat verschwunden, ohne dass eine neue sie ersetzt hätte, die Menschen, verlassen, der Welt beraubt, vollzogen weiterhin die Komödie der Generationen und des Todes, Marcels ältere Schwestern heirateten, eine nach der anderen, man aß altbackene Krapfen unter erbarmungslos sengender Sonne und trank schlechten Wein und zwang sich zu lächeln, als würde schon bald sich etwas ereignen, als müssten die Frauen mit ihren Kindern die neue Welt selbst hervorbringen, aber es passierte nichts, die Zeit fügte nichts anderes hinzu als den monotonen Ablauf der Jahreszeiten, die alle einander ähnelten und nichts anderes verhießen als den Fluch ihrer Dauer, der Himmel, die Berge und das Meer erstarrten im Abgrund des Blicks der Tiere, die ihre mageren Körper im Staub oder Schlamm entlang der Flussufer endlos umherschleppten, und drinnen, in den Häusern, im Schein der Kerzen, warfen sämtliche Spiegel ähnliche Blicke zurück, dieselben hohlen Abgründe, in Gesichtern aus Wachs. Als es Nacht wurde, spürte Marcel, tief in die Kissen seines Bettes gekrümmt, wie sein Herz sich vor Todesangst zusammenzog, denn er wusste, dass diese tiefe und schweigende Nacht nicht die natürliche und vorübergehende Verlängerung des Tages war, sondern etwas Schreckenerregendes, ein fundamentaler Zustand nach einer erschöpfenden, zwölfstündigen Anstrengung, in den die Erde zurückfiel und aus dem sie nie mehr entkommen würde. Die Morgendämmerung kündete nur einen erneuten Aufschub an und Marcel ging zur Schule, musste manchmal auf seinem Weg anhalten, um Blut zu erbrechen, wobei er sich selbst das Versprechen abnahm, nichts davon seiner Mutter zu sagen, die ihn nötigen würde, sich hinzulegen, um dann kniend an seiner Seite zu beten und kochend heiße Kompressen auf seinen Bauch zu legen, er wollte es nicht mehr zulassen, dass sein Dämon ihm die einzigen Dinge, die ihm Freude bereiteten, entzog, die Lektionen des Schulmeisters, die kolorierten Geographiekarten und die Majestät der Geschichte, die Erfinder und Wissenschaftler, die vor der Tollwut geretteten Kinder, die Dauphins und die Könige, alles, was ihm erlaubte zu glauben, dass es auf der anderen Seite des Meeres eine Welt gab, eine vor Leben nur so sprudelnde Welt, in der die Menschen noch andere Dinge zu tun verstanden, als ihre Existenz in Leid und Hoffnungslosigkeit weiterzuführen, eine Welt, die andere Wünsche aufkommen ließ als denjenigen, sie so schnell wie möglich zu verlassen, denn auf der anderen Seite des Meeres, da war er sich gewiss, feierte man seit Jahren die Thronbesteigung einer neuen Welt, derjenigen, der sich Jean-Baptiste 1926 anschloss und dabei lügen musste in Bezug auf sein Alter, um sich verpflichten, um das Meer überbrücken zu können und um endlich in Begleitung junger Männer, die zu Hunderten mit ihm flohen, ohne dass ihre schicksalsergebenen Eltern bei allem herzzerreißenden Abschiedsschmerz auch nur einen Grund gefunden hätten, sie zurückzuhalten, herauszufinden, was das eigentlich sein konnte, eine Welt. Zu Tisch, nah bei Jeanne-Marie, aß Marcel mit geschlossenen Augen, um Jean-Baptiste auf sagenhafte Ozeane zu folgen, dorthin, wo die Piratendschunken vor sich hin glitten, in heidnische Städte voller Gesang, Rauch und Geschrei, in duftende Wälder, die bevölkert waren von wilden Tieren und furchterregenden Ureinwohnern, die seinen Bruder mit Angst und Schrecken anblickten, als wäre er der unbezwingbare Erzengel, der Zerstörer der Plagen, erneut dem Wohl der Menschen ergeben, und beim Katechismus vernahm er, ohne etwas zu erwidern, die Lügen der Evangelisten, denn er wusste, was das war, eine Apokalypse, und er wusste, dass beim Weltuntergang sich der Himmel nicht öffnete, dass es da weder Reiter gab noch Trompeten noch die Zahl des Tieres, kein einziges Monster, sondern nur Ruhe, so still, dass man meinen mochte, es sei nichts passiert. Nein, nichts war passiert, die Jahre glitten dahin wie Sand und noch immer passierte nichts, und dieses Nichts breitete über alle Dinge die Macht seiner blinden Herrschaft aus, einer tödlichen und ungeteilten Herrschaft, von der niemand mehr sagen konnte, wann sie angefangen haben mochte. Denn die Welt war bereits in jenem Moment verschwunden, als diese Photographie im Sommer 1918 aufgenommen worden war, damit etwas bliebe, die Ursprünge zu bezeugen und auch das Ende, sie war verschwunden, ohne dass es jemand bemerkt hätte, und es ist vor allem seine eigene, unter allen an diesem Tag mittels Silberchlorid aufs Papier gebannten Abwesenheiten die rätselhafteste und furchtbarste, die Marcel sein ganzes Leben lang betrachtet hat und dabei immer wieder die Spur verfolgte im milchigen Weiß der Abschattierungen auf den Gesichtern seiner Mutter, seines Bruders und seiner Schwestern, auf Jeanne-Maries schmollender Schnute, in der Bedeutungslosigkeit ihrer armseligen menschlichen Anwesenheit, während der Boden unter ihren Füßen schwindet und sie Gespenstern gleich zu schweben zwingt in einem abstrakten und unendlichen Raum, der weder Ausweg kennt noch Richtungen, ein Raum, in dem sogar die Liebe, die sie miteinander verband, niemanden von ihnen retten konnte, denn wo die Welt abwesend, da ist die Liebe selbst machtlos. In Wahrheit wissen wir nicht, was die Welten sind noch wovon ihre Existenz abhängt. Irgendwo im Universum ist vielleicht das rätselhafte Gesetz eingeschrieben, das ihre Entstehung lenkt, ihr Wachstum und ihr Ende. Aber wir wissen dies: Damit eine neue Welt entsteht, muss eine alte erst zugrunde gehen. Und wir wissen auch, dass das Intervall, das sie trennt, unendlich kurz oder aber so lang sein kann, dass die Menschen jahrzehntelang lernen müssen, in Trostlosigkeit zu leben, um unfehlbar zu entdecken, dass sie es nicht können und dass sie letztendlich nicht gelebt haben. Vielleicht können wir selbst die beinahe unmerklichen Zeichen wahrnehmen, die verkünden, dass eine Welt grade verschwunden ist, nicht gemeint das Zischen von Granaten über den aufgewühlten Ebenen des Nordens, sondern der Auslösemechanismus einer Blende, die das gleißende Sommerlicht kaum trübt, die feine und ramponierte Hand einer jungen Frau, die ganz sanft, inmitten der Nacht, eine Türe schließt hinter dem, was nicht hätte ihr Leben sein sollen, oder das rechteckige Segel eines Schiffs, das vor den Küsten Hippo Regius’ über die blauen Wasser des Mittelmeers zieht und von Rom her die unerhörte Nachricht bringt, dass Menschen zwar noch immer existieren, ihre Welt aber nicht mehr ist.
»Empfindet also, Brüder, keine Vorbehalte gegenüber den Strafen Gottes.«
Inmitten der Nacht und sorgfältig darauf bedacht, keinen Lärm zu machen, gleichwohl niemand sie hören konnte, verschloss Hayet die Tür ihrer kleinen Wohnung, die sie acht Jahre lang oberhalb der Bar, in der sie als Kellnerin arbeitete, bewohnt hatte, und dann verschwand sie. Gegen zehn Uhr morgens kehrten die Jäger von der Treibjagd zurück. Auf der Pritsche der Pick-ups drückten sich die vom Hetzlauf und Blutgeruch noch immer berauschten Hunde eng gegeneinander, wedelten hektisch mit den Schwänzen, heulten und stießen hysterisches Gekläff in die Luft, auf welches die Männer, beinahe ebenso vergnügt und übererregt wie sie, mit Beschimpfungen und Verwünschungen reagierten, und Virgile Ordionis wuchtiger Leib wurde von unterdrückten Lachern erschüttert, während die anderen ihm anerkennend auf die Schulter klopften, da er allein drei der fünf Keiler des Vormittags getötet hatte, und Virgile errötete und lachte, während Vincent Leandri, der einen fetten Eber auf nicht einmal dreißig Meter Entfernung jämmerlich verfehlt hatte, sich darüber beklagte, zu nichts mehr zu taugen, und sagte, der einzige Grund, warum er an den Treibjagden festhalte, sei der Aperitif im Anschluss, und da schrie jemand, dass die Bar zu sei. Hayet war stets ebenso pünktlich und zuverlässig gewesen wie der Lauf der Sterne und Vincent dachte sofort, ihr sei Unheil widerfahren. Er stieg eilig hoch zur Wohnung, klopfte erst sanft an die Tür, bevor er dann mehrmals vergeblich auf sie eintrommelte, »Hayet! Hayet!« rufend, »Ist alles in Ordnung? Antworte bitte!«, und dann kündigte er an, dass er die Tür aufbrechen werde. Irgendjemand legte Vincent nahe, sich zu beruhigen, Hayet könnte doch gut fortgegangen sein, um einen dringlichen Einkauf zu erledigen, obschon es äußerst schwierig, ja beinahe unmöglich war, sich vorzustellen, im Dorf zu Herbstbeginn und obendrein noch an einem Sonntag einen wenn auch nur sehr geringen Einkauf zu tätigen, der dann aber auch noch so dringlich gewesen wäre, dass die Bar zu schließen gerechtfertigt war, aber wer wisse das schon?, und Hayet werde ganz sicher wiederkommen, aber sie kam nicht wieder und Vincent wiederholte, dass er jetzt die Tür wirklich einschlagen werde, es wurde zunehmend schwieriger, ihn zu bändigen, und schließlich einigte man sich darauf, die vernünftigste Lösung wäre, Marie-Angèle Susini darüber in Kenntnis zu setzen, dass ihre Kellnerin, so unwahrscheinlich es auch erscheinen mochte, weg war. Marie-Angèle empfing sie argwöhnisch und unterstellte ihnen gar, sie wären schon besoffen und würden ihr eine zweifelhafte Posse vorgaukeln, aber mit Ausnahme von Virgile, der, ohne zu wissen warum, noch immer ab und an lachte, wirkten sie alle erschöpft und müde, vollkommen nüchtern und auch seltsam unruhig, und Vincent Leandri schien sogar richtiggehend verstört, sodass Marie-Angèle sich den Zweitschlüssel von Bar und Wohnung schnappte und ihnen folgte, immer unruhiger nun auch sie, und hinaufstieg und Hayets Wohnung öffnete. Der Haushalt war peinlich sauber, nicht ein Körnchen Staub war da, das Steingut und die Armaturen glänzten, die Wandschränke und Schubladen waren leer, die Betttücher und Kopfkissenbezüge gewechselt, es war nichts von Hayet geblieben, nicht ein Ohrring, der hinter ein Möbelstück gerutscht wäre, keine einzige in irgendeinem Winkel des Badezimmers vergessene Haarspange, kein Papierfitzel, nicht einmal ein einzelnes Haar, und Marie-Angèle war überrascht, ausschließlich den Geruch von Reinigungsmitteln wahrzunehmen, als hätte hier seit Jahren kein menschliches Wesen gelebt. Sie betrachtete die tote Wohnung, sie verstand nicht, warum Hayet einfach so verschwunden war, ohne Abschiedsgruß, aber sie wusste, dass sie nicht mehr wiederkommen würde und sie einander nicht mehr sehen sollten. Sie hörte eine Stimme sagen: »Wir sollten besser die Bullen informieren«, aber sie schüttelte traurig den Kopf und niemand insistierte, denn es war klar, dass die lautlose Tragödie, die sich hier abgespielt hatte, nachts zu unbekannter Stunde, nur eine einzige in den Abgründen ihres einsamen Herzens, dem die Gesellschaft der Menschen keine Gerechtigkeit mehr widerfahren lassen konnte, tief verletzte Person betraf. Sie schwiegen eine Zeit lang und dann sagte jemand schüchtern: »Da du schon mal da bist, Marie-Angèle, könntest du sie auch aufschließen, die Bar, damit wir wenigstens unseren Aperitif trinken können«, und Marie-Angèle stimmte stillschweigend zu. Ein befriedigtes Murmeln drang durch die Gruppe der Jäger, Virgile fing sehr laut an zu lachen, und sie gingen auf die Bar zu, während die Hunde unter der Sonne jammerten und kläfften und Vincent Leandri vor sich hin murmelte: »Ihr seid eine Bande von Säufern und Arschlöchern«, und ihnen in die Bar folgte. Marie-Angèle, jetzt hinterm Tresen, machte die Handgriffe, die sie so gut kannte und so gern hätte vergessen wollen, sie betätigte sich geschickt zwischen den Gläsern und Eisbehältern, merkte sich im Kopf der Reihe nach und ohne den geringsten Fehler die mit dröhnenden und zunehmend unsicheren Stimmen in höllischem Rhythmus gebrüllten Bestellungen, sie lauschte den zerfahrenen Unterhaltungen, den immer gleichen, hundertfach erzählten Geschichten mit ihren Varianten und unwahrscheinlichen Übertreibungen, der Art, wie Virgile Ordioni niemals vergaß, aus den noch dampfenden Eingeweiden des toten Keilers feine Streifen Leber herauszuschneiden, die er so aß, ganz warm und roh, mit der Sanftheit eines prähistorischen Menschen, trotz aller Ekelbekundungen, auf die hin er seinen armen Vater in Erinnerung rief, der ihn stets gelehrt hatte, dass es nichts Besseres gäbe für die Gesundheit, und durch die Bar schallten nun die nämlichen Ekelbekundungen, geballte Fäuste schlugen auf den von Pastis feuchten Zink des Tresens und Lacher waren noch immer zu vernehmen und es wurde gesagt, Virgile sei ein Tier, aber ein verdammt guter Schütze, und in seinem Winkel starrte Vincent Leandri ganz allein sein Glas mit hoffnungsleeren Augen an. Je mehr Zeit verging, umso klarer wurde Marie-Angèle, dass sie nicht bereit war, diese Arbeit wieder aufzunehmen, die ihr noch unerträglicher vorkam, als sie gedacht hatte. Jahrelang hatte sie sich auf Hayet verlassen, ihr mehr und mehr die Leitung der Bar überantwortet, im vollsten Vertrauen, als wäre sie Teil der Familie, und Marie-Angèle fühlte ihr Herz sich zusammenziehen, als sie darüber nachsann, dass sie hatte verschwinden können, ohne auf eine Umarmung zum Abschied vorbeigeschaut oder auch nur einen Gruß geschrieben zu haben, ein paar Zeilen zumindest, die ihr bewiesen hätten, dass sich hier etwas zugetragen hatte, etwas, das von Gewicht war, aber dies, Marie-Angèle verstand es, war genau das, was Hayet unmöglich hatte tun können, denn es war deutlich, dass sie nicht nur verschwinden, sondern sämtliche ihrer hier verbrachten Jahre auslöschen und nichts anderes von ihnen bewahren hatte wollen als ihre schönen, frühzeitig ramponierten Hände, die sie möglicherweise hätte abhacken und zurücklassen mögen, wäre dies nur möglich gewesen, und die manische und wütende Art, mit der sie den Haushalt gereinigt hatte, war nichts als das Zeichen eines unbeugsamen Willens zur Auslöschung und des Glaubens daran, dass kraft des Willens man aus seinem Leben all jene Jahre wischen konnte, die man nicht hatte erleben wollen, selbst wenn es dafür nötig war, alles bis hin zur Erinnerung an jene, die uns liebten, wegzuwischen. Und als sie eine weitere Runde Pastis in so voll gefüllten Gläsern servierte, dass kein Wasser mehr in ihnen Platz fand, ertappte sich Marie-Angèle bei der Hoffnung, dass Hayet, egal wo sie war und auf welches Ziel sie wohl zusteuerte, sich, wenn auch nicht grade glücklich, so doch zumindest befreit fühlen möge, und Marie-Angèle versammelte sämtliche Kräfte ihrer Liebe, um sie zu segnen und ziehen zu lassen, ohne ihr Fortgehen mit Groll zu beschmutzen. So entfernte sich Hayet, den Segnungen gegenüber ebenso gleichgültig wie dem Groll, ohne zu ahnen, dass ihr Verschwinden bereits eine Welt zum Umsturz gebracht hatte, an die sie schon gar nicht mehr dachte, denn Marie-Angèle wusste inzwischen mit Gewissheit, dass sie die Bar nicht wieder eröffnen würde, sie würde sich kein einziges Mal mehr das Schauspiel der widerlich gelblich auskristallisierenden Suppe in den gebrauchten Gläsern antun, den Geruch von nach Anis riechendem Atem nicht, nicht den Aufschrei der Stimmen der Kartenspieler inmitten nie enden wollender Winter, deren aufkommende Erinnerung ihr Schwindel bereitete, und nicht die unentwegten Streitereien mit ihrem Ritual der nie in die Tat umgesetzten Drohungen, denen jedes Mal weinerliche und der Ewigkeit geschworene Versöhnungen folgten. Sie wusste, dass sie das nicht konnte. Virginie, ihre Tochter, hätte akzeptieren müssen, sich an ihrer Stelle um die Bar zu kümmern, bis sie eine neue Kellnerin eingestellt haben würde, aber diese Lösung war von keinem Standpunkt aus in Betracht zu ziehen. Virginie hatte in ihrem Leben nichts getan, was auch nur im Entferntesten an eine Art Arbeit erinnern konnte, sie hatte stets das unendliche Feld der Untätigkeit und Nachlässigkeit erforscht und sie schien entschieden, bis ans Ende ihrer Berufung gehen zu wollen, aber wäre sie auch ein wahres Arbeitstier gewesen, ihre missmutige Laune und ihr Gehabe einer Infantin machten sie vollkommen ungeeignet, eine Aufgabe zu erfüllen, zu der es gehörte, regelmäßigen Kontakt mit anderen menschlichen Wesen zu pflegen, und waren sie auch so ungeschliffen wie die täglichen Gäste der Bar. Marie-Angèle würde sicherlich eine Kellnerin finden, aber sie fühlte sich nicht in der Lage, noch einmal als Chefin aufzutreten, sie weigerte sich, die Öffnungszeiten zu überwachen und jeden Abend die Kasse zu machen, um zu prüfen, ob die Abrechnungen stimmten, sie wollte die Komödie der Autorität und der Verdächtigungen nicht mehr spielen, die Hayet so lange schon hatte völlig überflüssig werden lassen, vor allem aber wollte sie sich nicht eingestehen, dass Hayet letztlich vielleicht ersetzbar war. Sie sah Virgile Ordioni schwankend in Richtung Toilette gehen, sie dachte voller Fatalismus an das traurige Schicksal, das die tadellos gechlorte Klobrille ereilen würde, ganz zu schweigen vom Boden und den Wänden, sie sah sich schon den ganzen Sonntagnachmittag über mit dem Schwamm in der Hand gegen diese Wilden anschimpfen, und sie fasste den Entschluss, eine Anzeige aufzusetzen, um die Bar einem Pächter anzuvertrauen.