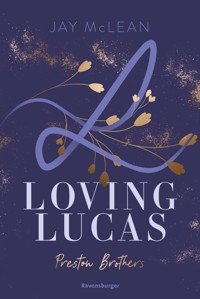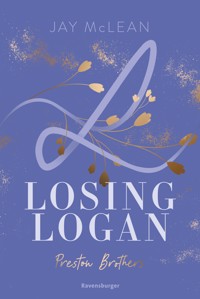11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Preston Brothers
- Sprache: Deutsch
Diesen Brüdern kann niemand widerstehen. LEO PRESTON ist der Stille der Geschwister. Er vertraut nur wenigen Leuten, daher hat er auch niemandem von seinen Gefühlen für Mia erzählt. Mia, die Tochter der Nanny, die zu den Preston-Kindern kam, nachdem ihre Mutter gestorben war. Nichts genoss MIA KOVÁCS mehr als die gemeinsame Stille mit Leo – bis ein Moment verheerenden Schweigens alles zerstörte. Tief verletzt verließ Mia Winbury ohne Abschied und ist seitdem nie zurückgekehrt. Jahre später treffen Mia und Leo unerwartet aufeinander. Sexy, berührend, herzzerreißend: die New Adult Romances von Jay McLean! Preston-Brothers-Trilogie Loving Lucas Losing Logan Leaving Leo First & Forever-Dilogie Be My First Be My Forever
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 902
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Triggerwarnung
Liebe*r Leser*in,
dieser Roman enthält Themen, die potenziell emotional belasten oder triggern können. Auf dieser Seite befindet sich ein Hinweis zu den Themen.
ACHTUNG: Dieser enthält Spoiler für die gesamte Handlung.
Als Ravensburger E-Book erschienen 2025 Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg
© 2025 Ravensburger Verlag GmbH Deutsche Erstausgabe Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2020 unter dem Titel »Leo – A Preston Brothers Novel« Copyright © by Jay McLean Covergestaltung: Andrea Janas unter Verwendung von Motiven von © imaizo (Shutterstock) Übersetzung: Sarah Heidelberger (www.sarah-heidelberger.de) Lektorat: Nina Schnackenbeck Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-473-51231-7
ravensburger.com/service
Für Tata Istvan
Prolog
MIA
Ich will hier nicht sein.
Das ist mein einziger Gedanke, und er erfüllt mich mit einer nervösen Energie, die an Panik grenzt.
Es ist dasselbe Gefühl, das ich schon vor über zehn Jahren hatte. Nur dass mir die Person, die neben mir hinterm Steuer sitzt und nicht den Hauch einer Ahnung hat, was gerade in mir vor sich geht, damals versicherte, wie glücklich ich hier sein würde. Wie schön ich es finden würde. Was allerdings reine Spekulation gewesen sein dürfte, da sie das zwölfjährige Mädchen neben sich kaum kannte. Und heute? Heute weiß sie noch weniger über mich, denn wir sind uns inzwischen vollkommen fremd. Was sicher seltsam klingt, wo sie doch meine Mutter ist.
Als sie um die letzte Kurve auf dem Weg zum Haus der Prestons fährt, sitzt sie kerzengerade und überprüft unauffällig ihr Aussehen im Spiegel. Genauso wie in all den Sommern, die ich mit ihr verbracht habe. Und auch heute noch scheint sie darauf zu hoffen, dass Tom Preston sie eines Tages in einem anderen Licht sieht.
Nur dass dieser Tag nie kommen wird.
Ich verkneife mir ein Augenrollen und atme stattdessen tief durch. Atmen.Einfachnuratmen.Dann wische ich mir an dem abgenutzten Sitzbezug den Angstschweiß von den Händen, lehne mich gegen die Kopfstütze und versuche, meinen Puls zu beruhigen, indem ich aus dem Fenster sehe. Die Straße wird von Bäumen gesäumt, hier und da bricht das Sonnenlicht durch das dichte Blätterdach über uns. Der niedrige Holzzaun hinter den Bäumen macht deutlich, dass es sich um Privatgelände handelt, auch wenn man von der Straße aus kein Haus sehen kann. Kies prasselt gegen den Unterboden, und als ich das Fenster einen Spaltbreit öffne, steigt mir kühle, frische Luft in die Nase.
Als ich zum ersten Mal hier war, hatte ich das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein.
Allerdings dauerte es nicht lange, bis sich dieses Gefühl wieder legte.
Mom biegt in die Einfahrt der Prestons ab und fährt langsamer weiter. Mir stockt der Atem, und ich beiße mir so heftig auf die Unterlippe, dass mich ein stechender Schmerz durchfährt.
Ich versuche, die Erinnerungen von mir fernzuhalten.
Meine Tränen herunterzuschlucken.
Nichts hat sich geändert.
Nur dass jetzt alles anders ist.
Ich will hier nicht sein.
Nicht schon wieder.
LEO
Manchmal hab ich diese Blackouts. Körperlich bin ich noch da. Aber im Kopf bin ich ganz weit weg. Wobei »Blackouts« es vermutlich nicht richtig trifft. Es ist eher so, dass ich mich komplett ausklinke.
Als Mias Name fällt, spüre ich einen dieser Momente kommen.
Die Therapeutinnen und Therapeuten, zu denen Mom mich als Kind geschleppt hat, wollten ihr einreden, das wäre ein ADHS-Symptom. Dabei war ich das bei Weitem am wenigsten hyperaktive unter ihren Kindern. Und ja, es fiel mir schwer, mich auf langweiliges Zeugs zu konzentrieren. Aber wem geht das bitte nicht so? Ansonsten konnte ich mich sehr wohl konzentrieren, extrem gut sogar … nur eben auf Dinge, die für andere nicht so wichtig waren. Ich konnte stundenlang eine Fliege an der Wand beobachten oder eine Blume ansehen, die sich aus dem Dreck schob, und grübeln. Wie ist sie dahin gekommen? Sie hatte dort nichts zu suchen, und trotzdem war sie da und wirkte ganz und gar richtig am Platz.
Als Mom zu krank wurde, um mich zu begleiten, wurden die Therapietermine seltener, und nach ihrem Tod hörten sie ganz auf. So lange wie in den Monaten nach ihrem Tod habe ich mich nie wieder ausgeklinkt.
Bis Laney fast gestorben wäre.
Mir ist klar, dass bei mir vermutlich einiges im Argen liegt, was nie diagnostiziert wurde.
Und mir ist klar, dass meine Familie immer noch über Mia redet. Ich bekomme nur nicht so richtig mit, was genau sie sagen. Wir drängen uns alle hundertundelfzig im Schlafzimmer meiner Eltern, und ich habe keine Ahnung mehr, wie wir hergekommen sind.
»Mia ist Virginias Tochter«, erklärt Logan seiner Freundin Red. »Und sie war bis über beide Ohren verliebt in Leo.«
Unter meinem Auge zuckt ein Nerv.
»Verliebt?«, fragt Lucy. »Vollkommen vernarrt trifft es eher!«
Ich versuche mich an einem abfälligen Schnauben, aber es kommt nur ein nervöser, verängstigter Lacher heraus.
Mia war nie in mich verliebt. Und falls doch, dann wäre es tausendmal besser für sie gewesen, sie hätte es bleiben lassen.
Ich wende mich an meine einzige Schwester. »Wie lange muss ich auf der Party bleiben?«
Aber Lucy lacht nur. Sie hat keine Ahnung, was für innere Kämpfe ich gerade ausfechte.
Niemand hier weiß das.
Danach bekomme ich nicht mehr mit, wie viel Zeit vergeht oder wer was sagt, bis Lucy verkündet: »Wir sind der fieseste, verlästertste Haufen Arschgeigen auf diesem Planeten!«
Daraufhin verstummen alle. Stille ist an sich mein Lieblingsgeräusch. Aber heute nicht. Denn heute bietet mir die Stille Raum für Erinnerungen.
Ich muss wieder an den Ausdruck auf Mias Gesicht denken, als ich sie zuletzt gesehen habe. Die Mischung aus Traurigkeit, Wut und tiefem Schmerz in ihren Augen. Die zerstörerische Kraft hinter den Worten, die sie an mich richtete.
»Das mag sein«, murmle ich im Hier und Jetzt, »… aber trotzdem wäre ich euch echt dankbar, wenn ihr sie mir heute vom Leib halten könntet.«
Inzwischen ertrinke ich fast in meinen Erinnerungen an all die emotionalen Tiefschläge, die Tritte in die Magengrube. An all die Wahrheiten, die ich seit Jahren zu leugnen, zu verbergen versuche.
Weiche Finger tasten nach meinem Unterarm, und als ich nach unten blicke, sehe ich, dass Lucy nach meiner Hand greift. Ich lasse es zu und wage einen kurzen Blick in ihr Gesicht. Sie sieht mir in die Augen, scheint etwas darin zu suchen. Sie versucht, das zu finden, wonach auch unsere Mutter mein Leben lang gesucht hat. Irgendetwas, ganz gleich was,womit sie sich verbinden kann. Denn da muss doch etwas sein. Da muss doch mehr sein.
Für die anderen bin ich nicht mehr als ein Gefäß.
Innen leer.
Ich lasse Lucys Hand los, will ihr sagen, dass sie mich ziehen lassen soll, weg aus dieser Realität, zurück zu meinen Erinnerungen an Mia. Weil ich weiß, dass es zwischen all dem Schmerz und Leid auch Gutes gab.
Dass ich auch Gutes getan habe.
»Alles in Ordnung?«, formt Lucy lautlos mit den Lippen und mustert mich besorgt.
Ich nicke.
Was gelogen ist.
Nichts ist in Ordnung.
Und ich will hier nicht sein.
Aber vor allem will ich nicht, dass sie hier ist.
Was zum Teufel noch mal will sie hier?
TEIL I
Kapitel 1
MIA
Zwölf Jahre
Es fängt alles mit einem Prank an.
Einem bescheuerten, armseligen Prank.
»Chaos-Aktionen« nennen sie das.
Und der größte Witz ist, dass er nicht mal gegen mich gerichtet ist.
Bisher ist der Sommer, den ich bei den Prestons verbringe … einsam. Ein anderes Wort fällt mir dafür nicht ein. Und das soll was heißen, schließlich bin ich Einzelkind und bei meinem Großvater aufgewachsen, der auf einer alten Farm in einem Dorf mit nicht einmal zweihundert Einwohnern lebt.
Abgesehen von meinem Grandpa gibt es dort nur zwei Menschen, mit denen ich regelmäßig rede, und das sind mein bester Freund Holden und seine Mom. Holden und ich haben uns immer auf die Sommerferien gefreut und dann jede wache Sekunde miteinander verbracht. Früher war uns dabei nie langweilig, ständig haben wir was Neues ausprobiert. Aber je älter wir wurden, desto schwieriger wurde es. Und je länger wir mitten im Nirgendwo von North Carolina festsaßen, desto dringender wollten wir da weg. Na ja, Holden zumindest. Ich für meinen Teil wäre dort vermutlich glücklich gewesen, wenn ich nur irgendeine Perspektive gehabt hätte. Im Sommer zuvor hatte mir Holden versprochen, dass er eine Möglichkeit finden würde, die Gegend zu verlassen. Und dass er mich dann mitnehmen würde. »Eines Tages, Mia Mac«, hatte er gesagt, während er vor mir kauerte und die Mischung aus Blut und Dreck von meinem aufgeschürften Knie tupfte, »eines Tages werden wir dieses beschissene Dreckskaff hier hinter uns lassen.«
»Holden!« Ich wand mich und rieb mir ruppig die Schweißperlen aus dem Nacken. Wir waren gerannt, keine Ahnung, wieso. Holden hatte plötzlich gerufen, dass wir rennen müssten, also rannten wir. Wir rannten durchs Unterholz, tiefhängende Äste schlugen uns ins Gesicht, und ich wusste zwar nicht, wovor wir davonliefen, aber es machte mir eine solche Angst, dass ich die riesige Wurzel übersah, die aus dem Boden ragte. Ich stolperte, landete auf allen vieren – und da saß ich nun: auf dem Hintern und an beiden Knien sowie tief in meinem ohnehin schon mäßig ausgeprägten Stolz verletzt. Holden sah mich abwartend an, und mir kroch die Hitze in die Wangen.
»Hör auf mit den Schimpfwörtern«, murmelte ich, auch wenn ich genau wusste, dass er es darauf angelegt hatte, dass ich das sagte. Ich mochte es generell nicht, wenn jemand Schimpfwörter benutzte, und bei ihm fand ich es am schlimmsten. Außerdem waren wir erst elf. Es kam mir einfach falsch vor, dass er solche Wörter in den Mund nahm.
Ich beobachtete, wie er sich ein Lachen verkniff, und dann beugte er sich zu mir vor. Sein Mund kam näher und näher, und einen Augenblick lang – nur einen Sekundenbruchteil – dachte ich: Wenn er es wagt, mich jetzt zu küssen, dann hau ich ihm eins auf die Nase.
Aber er hatte nicht vor, mich zu küssen. Stattdessen flüsterte er: »Arschfickentittenscheiß.«
Ich boxte ihm gegen den Arm.
»Fuck, Mia, das hat wehgetan!«, rief er und rieb sich die Stelle, an der ich ihn getroffen hatte.
»Dann leg dich eben nicht mit mir an!«
»Große Worte … für ein kleines Mädchen.«
Ich funkelte ihn wütend an. »Soll ich dir gleich noch eine verpassen?«
Sein Grinsen versiegte, und er musterte mich kopfschüttelnd und mit großen Augen. »Dein Grandpa hat dir wohl ein paar Tricks beigebracht, was?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Es ist ihm eben wichtig, dass ich mich verteidigen kann.«
»Vor was denn?« Er lachte. »Den Riesenzikaden auf eurer Veranda? Sonst gibt es hier nämlich nichts, wovor man Angst haben müsste.« Sein Blick fiel auf den Boden, und er fügte zögernd hinzu: »Na ja, abgesehen natürlich von deinen Eltern.«
Ich hätte erneut zugeschlagen. Wenn er nicht einfach recht gehabt hätte.
Die Erinnerung bringt meine Mundwinkel zum Zucken. Ich sitze auf dem Steg am Privatsee der Prestons, und meine nackten Füße schwingen durchs Wasser. Ich halte das Telefon fest in der Hand. Mein Grandpa hat es mir gegeben, damit ich während der Sommerferien mit ihm in Kontakt bleiben kann. Es sind nur zwei Nummern eingespeichert, seine und die von Holdens Mom. Meine Anrufliste besteht praktisch aus meinen Anrufen bei ihr. Ich fühle mich wohler damit, mich bei meinem Freund auszukotzen als bei meinem Grandpa. Nicht, weil mein Tata – das ist kurz für Nagytata, das ungarische Wort für »Großvater« – mir nicht zuhören würde, sondern weil ich weiß, wie viel er sich von meinem Aufenthalt hier erhofft. Ich will ihm nicht die Wahrheit sagen – dass ich nämlich keine Freunde finde und bisher kaum ein Wort mit jemand anders als Mr Preston gewechselt habe, oder Tom, wie ich ihn nennen soll. Er tut, was er kann, damit ich mich hier wohl und willkommen fühle. Mit meiner Mutter rede ich abgesehen von einem flüchtigen »Guten Morgen« und »Gute Nacht« ebenfalls kaum. Wenn sie arbeitet, bin ich sowieso … vergessen.
So wie immer.
Ich verstehe nicht, wieso es ihr so wichtig war, dass ich den Sommer über mit hierherkomme. Sie ist die Nanny der Familie und wohnt in einem Zwei-Zimmer-Apartment über der Garage. Ich schlafe auf dem Sofa. Weil es in ihrer Wohnung genauso wenig Platz für mich gibt wie in ihrem Herzen.
Aber eins muss ich ihr lassen: Sie ist eine tolle Nanny. Man merkt deutlich, wie sehr sie die Prestonkinder liebt. Nur ihr eigenes Kind liebt sie nicht.
Ich entsperre das Handy und lese noch einmal die letzte Nachricht, die mir Holden vom Handy seiner Mutter geschickt hat:
Tammy: Noch drei Tage, Mia Mac. Du schaffst das. Mama sagt, sobald du wieder da bist, geht sie mit uns Eis essen. Triple-Schoko-Fudge mit Erdbeeren. Tut uns leid, dass du es so scheiße hast. Wir vermissen dich. Und sie sagt, sie hat dich lieb. Ich nicht. Weil das voll schräg wär. Du kannst mich immer anrufen, Stinkepo.
Die Nachricht kam gestern, und mir fiel nur eine Antwort ein, die ich ihm unter Tränen schicken konnte.
Mia: Hör auf mit den Schimpfwörtern.
Meine Fingerspitzen hinterlassen eine schwitzige Spur auf dem Display, als ich Grandpas Kontakt heraussuche. Inzwischen brennt die Sonne. Es ist kurz vor drei, und meine blasse Haut verfärbt sich schon rot, besonders an den Oberschenkeln, wo sich die Nähte meiner Shorts in meine Haut graben. Aber mein Kopf mit den dicken, beinah schwarzen Locken bekommt am meisten ab, und ich bereue es schon, so lange hier draußen gewesen zu sein. Am Pulsieren dicht über meinem Nacken merke ich schon, dass ich bald Kopfschmerzen bekommen werde.
Mit einem tiefen Seufzer drücke ich auf den Hörer. Aber da dringt Stimmengewirr zwischen den Bäumen hindurch, die den See vom restlichen Grundstück der Prestons trennen, gefolgt von Schritten und Gelächter. Die Jungs kommen. Panik schießt in mir hoch, und mein Herzschlag setzt kurz aus und hämmert danach in doppeltem Tempo weiter. Hastig lege ich auf und streife meine Flip-Flops über. Hoffentlich kann ich verschwinden, ehe sie hier sind. Aber es ist zwecklos, sie rennen schon auf den Steg zu. Auf mich. Sie sind zu viert, die drei Ältesten und einer ihrer Freunde. Noch haben sie mich nicht bemerkt. Dafür sind sie zu beschäftigt damit, den Jungen, der ganz vorn läuft, zu beschimpfen – Leo. Die anderen jagen ihn und benutzen dabei Worte, die ich nicht mal in Gedanken wiederholen mag. Meine Füße sind wie festgeklebt, aus den alten Holzbohlen steigt Wärme auf. Ich weiß nicht, wohin ich gehen, wohin ich schauen soll.
Noch drei Sekunden, dann sind sie bei mir.
Drei.
Zwei.
»Schnappt ihn euch!«, brüllt Logan, und Leo ruft ihm ein Schimpfwort zu.
Eins.
Leo scheint zu ahnen, was gleich kommt, denn er besitzt die Voraussicht, den Inhalt seiner Hosentaschen auf den Steg zu werfen. Ich blinzle, und Leo schwebt schon horizontal in der Luft, weil ihn die drei anderen Jungs an Armen und Beinen gepackt haben. Dann fliegt er mit rudernden Armen vom Ende des Stegs, während die anderen lachend mit dem Finger auf ihn zeigen. Er landet mit einem lauten Platscher im Wasser, und ich schaue runter zu meinen Füßen, auf das lose Kleingeld, das vor ein paar Sekunden dort gelandet ist. Ich sammle es auf, damit Leo es leichter hat, wenn er aus dem Wasser kommt. Sein Geldbeutel liegt am Stegrand. Ein, zwei Zentimeter weiter, und er wäre in den See gefallen. Bei der Landung ist er aufgeklappt, und das Sonnenlicht reflektiert von der durchsichtigen Plastikfolie, hinter der normalerweise der Ausweis steckt. Mit zusammengekniffenen Augen will ich den Geldbeutel in Sicherheit kicken – da bemerke ich es: Hinter der dünnen Schutzfolie steckt ein Foto … ein Foto von mir.
Von mir!
Mir stockt der Atem, und von einer Sekunde auf die andere steht meine Seele in Flammen.
Im Schutz meiner Wimpern blicke ich auf, nur ein winziges bisschen, sodass ich sehen kann, wie Leo sich auf den Steg stützt und aus dem Wasser klettert.
Dann renne ich los.
Renne schneller als je zuvor in meinem Leben.
Es hat über vierzig Grad, und doch renne ich den ganzen Weg bis zu der Wohnung über der Garage.
Schließe die Tür hinter mir.
Sperre sie zu.
Spüre meine Muskeln krampfen.
Atme tief durch.
Und noch mal und noch mal.
Versuche, meine Gedanken zu ordnen.
Das ergibt doch alles keinen Sinn!
Als Grandpa am Abend anruft und fragt, wie es läuft, stelle ich fest, dass ich lächle.
Die nächsten beiden Tage vergehen wie im Flug, und ich bin selbst überrascht, wie traurig ich plötzlich bin, als wir abreisen. Aber nicht halb so überrascht wie über meine Antwort, als Grandpa auf der Heimfahrt fragt, ob ich nächsten Sommer wieder zu den Prestons möchte.
»Ja«, antworte ich wie aus der Pistole geschossen. Und ich kann nichts dagegen tun, dass ich dabei rot werde und grinsen muss.
Leo Preston läuft mit einem Bild von mir in der Tasche herum. Und ich will wissen, wieso.
Kapitel 2
MIA
Keine Ahnung, wieso ich dachte, dass es im darauffolgenden Sommer besser laufen würde. Denn mein zweiter Aufenthalt bei den Prestons ist eine exakte Kopie des Vorjahrs. Der einzige Mensch, mit dem ich überhaupt je ein richtiges Gespräch führe, ist Tom. Er arbeitet viel, deswegen ist er selten zu Hause. Aber wenn er da ist, dann unterhält er sich mit mir über mein Leben, mein Zuhause, meine Hobbys. Manchmal sind auch seine Söhne dabei, aber sie achten nicht weiter auf mich. Sie sind nie grausam oder gemein zu mir, machen jedoch auch keinerlei Anstalten, sich mit mir anzufreunden. Und meine Mom gibt mir ständig das Gefühl, ihr im Weg zu sein, weswegen ich mich auch in diesem Jahr wieder frage, warum sie mich überhaupt hier bei sich haben will.
Ich bereue meine Zusage, kaum dass ich einen Fuß ins Haus gesetzt habe. Ich entdecke Leo sofort und lächle ihm zu, wobei ich hoffe, nicht allzu offensichtlich rot zu werden. Die vergangenen zwölf Monate war ich im Traumland unterwegs und habe mir Tausende von Gründen ausgemalt, aus denen er ein Foto von mir mit sich herumtragen könnte. Doch schon bei meiner Ankunft erweisen sich all meine detaillierten Fantasien als genau das: Fantasien. Denn Leo sitzt auf der Couch, liest ein Buch, und dann steht er auf und verlässt den Raum, ohne mich eines Blickes zu würdigen. Ohne ein Wort zu sagen. Nicht mal »Hi«.
Und mein kleines dreizehnjähriges Herz zerspringt in eine Million Scherben.
Die erste Sommerhälfte verbringe ich allein, spaziere auf dem Grundstück herum und bemühe mich, meiner Mutter aus dem Weg zu gehen. Die älteren Jungs scheinen immer irgendeine Beschäftigung zu finden. Aber sie fragen mich nie, ob ich mitmachen will. Das einzige Preston-Mädchen ist gleichzeitig auch das Älteste der Kinder und wohnt schon nicht mehr im Haupthaus. Wenn sie doch mal dort ist, was selten vorkommt, unterhält sie sich mit mir. Aber so, als wäre ich noch ein Kind, dabei fühle ich mich gar nicht mehr so. Ich bezweifle, dass sie eine Ahnung hat, wie alt ich bin. Und ich glaube auch nicht, dass es sie interessiert. So wie sich niemand hier für mich interessiert.
Als ich mit Grandpa telefoniere, verschweige ich ihm das alles und erzähle ihm stattdessen, was für einen Mordsspaß ich bei den Prestons hätte. Ich habe zwar ein entsetzlich schlechtes Gewissen deswegen, aber ich bin mir gleichzeitig sicher, dass ihm die Wahrheit wehtun würde.
Meine Mom steht in der Küche der Garagenwohnung, während ich mit dem Telefon am Ohr auf dem Sofa liege und versuche, mir nichts anmerken zu lassen.
»Wie schön, dass du dich amüsierst,Baba«, dröhnt er mit seiner tiefen Stimme, und ich muss lächeln. Ich vermisse ihn. Ich vermisse diese Stimme, seinen starken ungarischen Akzent und seinen Kosenamen für mich, der so viel bedeutet wie »Kleine«. Ich bin sein einziges Enkelkind, und tief in meinem Herzen glaube ich, dass ich sein Ein und Alles bin. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, wie er auf dem Fernsehsessel in unserem Wohnzimmer sitzt. Der Fernseher ist auf stumm gestellt, und seine runzligen Hände, mit denen er sich das Telefon ans Ohr hält, zittern. Er vermisst mich sicherlich genauso wie ich ihn, aber er hat mich ermutigt, herzukommen, damit ich mehr von der »Welt« sehe, als er mir bieten kann. Er will, dass ich noch zu anderen Kindern als Holden Kontakt habe. »So findet man Freunde«, hat er zu mir gesagt.
Wir befinden uns im selben Bundesstaat, nur drei Stunden Autofahrt voneinander entfernt, aber er hat recht. Das hier ist eine andere Welt.
»Ich hab überlegt, wenn ich wieder zu Hause bin, könnten wir …«, setze ich an, aber Mom unterbricht mich mitten im Satz.
»Mia, bring das bitte rüber ins Haupthaus zu Tom. Es ist für morgen.« Sie stellt eine Auflaufform auf die Arbeitsfläche.
»Ich telefoniere gerade«, antworte ich, obwohl sie das bereits weiß. Sie reagiert nicht, sondern schiebt mir nur kommentarlos die Form hin, ehe sie im Schlafzimmer verschwindet und die Tür hinter sich schließt. Wenig später höre ich die Dusche rauschen.
Seufzend stehe ich von meinem provisorischen Bett auf und sage ins Telefon: »Ich muss jetzt auflegen. Ich ruf dich morgen wieder an, okay?«
»Okay, Baba. Szeretlek.«
»Ich hab dich auch lieb, Tata.« Ich beende das Gespräch und schiebe das Telefon in meine Jogginghosentasche. Dann wickele ich mir das Geschirrtuch als Schutz um meine Hände, greife die dampfende Auflaufform, schlüpfe in meine Schuhe und gehe die Treppe nach unten.
Die Verandalichter am Haupthaus sind noch an, und Tom sitzt mit einem seiner Söhne draußen am Tisch. Der Junge wendet mir den Rücken zu, deswegen kann ich nicht erkennen, welcher es ist. Keiner von beiden sieht mich kommen, bis die Verandatreppe unter meinen Schritten knarrt und sie sich zeitgleich dem Geräusch zuwenden.
Tom lächelt.
Leo nicht.
»Tut mir leid, dass ich störe«, krächze ich. »Mom meinte, ich soll das hier rüberbringen. Möchten Sie, dass ich es in den Kühlschrank stelle?«
Tom steht auf, nimmt mir vorsichtig die Form ab und setzt sie auf dem Tisch ab. »Das kann warten«, sagt er immer noch lächelnd. »Setz dich doch ein bisschen zu uns.«
Ich schüttle schnell und heftig den Kopf. »Nein, nein, schon gut, ich … ich …«
Aber er ist schon dabei, mir einen Stuhl hinzuschieben.
Da ich schlecht einfach Nein sagen kann, setze ich mich. Die Schamesröte steigt in meine Wangen. Ich war Leo noch nie so nah. Normalerweise geht er immer, wenn ich den Raum betreten, oder ignoriert zumindest meine Anwesenheit. Jetzt aber sitzt er mir direkt gegenüber und hat nicht mehr die Möglichkeit, so zu tun, als wäre ich nicht da. Aber er steckt die Nase in ein Buch, das sein ganzes Gesicht bedeckt. Vielleicht gelingt es ihm also doch. Um ehrlich zu sein, überrascht es mich, dass er nicht einfach aufsteht und geht.
»Und, wie war der Sommer bisher für dich?«, fragt Tom und trinkt einen Schluck aus einer Tasse, die vermutlich Kaffee enthält.
»In Ordnung. Also, ich meine natürlich, gut. Es war ein schöner Sommer, ja.« Ich bin ein nervliches Wrack, und das ohne jeden Grund.
Tom räuspert sich. »Ich gehe mal davon aus, dass meine Jungs dich ordentlich auf Trab halten. Oder zumindest dafür sorgen, dass du dich nicht langweilst? Hier gibt es immer was zu erleben.«
Ich lächle, auch wenn es schmerzt. Lüge, auch wenn es wehtut. »Klar, sicher.«
Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Leo das Buch ein wenig sinken lässt. Und dann noch ein wenig mehr. Seine Augenbrauen ziehen sich zusammen, während er mir einen durchdringenden Blick zuwirft und seine sonst so strahlend blauen Augen einen düsteren Ausdruck annehmen, auf den ich mir keinen Reim machen kann. Er sagt kein Wort.
»Wenn die Jungs dir zu viel werden«, fährt Tom fort, »sag einfach Laney Bescheid, und sie hält ihnen eine Standpauke.«
Ich reiße meinen Blick von Leo weg und konzentriere mich auf das, was Tom gerade gesagt hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist diese Laney eigentlich nur Lucas’ beste Freundin. Aber alle hier behandeln sie wie ein Familienmitglied. Lucas und Laney sind bloß ein paar Jahre älter als ich, aber sie wirken viel reifer. Viel … lebenserfahrener.
»Okay, mach ich«, murmle ich. Alles in mir drängt mich zu gehen, in die Bequemlichkeit meiner Einsamkeit zurückzukehren.
Toms Telefon vibriert auf der gläsernen Tischplatte, und ich bin dankbar, dass sich für mich dadurch eine Gelegenheit zur Flucht ergibt. Kaum ist er aufgestanden und hat den Anruf entgegengenommen, da springe ich schon auf. Doch er legt ganz sachte seine große, schwere Hand auf meine Schulter, um mich aufzuhalten. »Bleib doch noch.« Sein Tonfall ist sanft. »Ich würde mich gern noch ein bisschen mit dir unterhalten.«
Ich nicke und muss dabei den Hals recken, um überhaupt in sein Gesicht sehen zu können. Er ist groß, an die eins neunzig, würde ich sagen, und mir schießt die Frage durch den Kopf, welcher seiner Söhne am Ende wohl am größten wird. Mein Blick folgt ihm ins Haus, wo er in seinem Büro verschwindet. Seine Stimme ist nur noch ein fernes Murmeln. Jetzt, wo mein Puffer weg ist, atme ich tief ein und halte den Blick starr auf die Auflaufform gerichtet. Eine Minute verstreicht, dann noch eine. Ich beiße so fest die Zähne zusammen, dass mein Kiefer schon wehtut. Als ich mich gerade ein bisschen entspanne, räuspert sich Leo. Ruckartig sehe ich auf. Er hat sein Buch aufgeschlagen auf den Tisch gelegt. »Dad meinte, du wohnst auf einer Farm?«
Beim Klang seiner Stimme, der Worte, die er direkt an mich richtet, schießt mein Puls in die Höhe.
Ich nicke, presse aber weiter die Lippen zusammen und versuche, ihn nicht anzusehen. Zumindest nicht in seine Augen, die gleichzeitig zu viel zu verraten und nichts zu enthüllen scheinen.
Er lehnt sich entspannt zurück, und sein schlichtes weißes T-Shirt spannt sich bei der Bewegung. »Wie ist das so?«
Achselzuckend gebe ich die einzige Antwort, die mir in diesem Moment einfällt: »Ruhig.«
Er wirft mir ein schiefes Lächeln zu. »Muss schön sein.«
Meine Schultern entspannen sich. »Die Ruhe?«
Jetzt ist er es, der wortlos nickt.
»Ja, ist es wohl.« Ich zucke mit den Achseln. »Aber manchmal ist es auch ganz schön einsam.«
»Hm.«
»Ich wette, das Problem habt ihr hier nie.« Ich kichere nervös.
Er atmet tief durch, seufzt. »Sag das nicht.«
Da ich nicht weiß, was ich darauf antworten soll, sage ich einfach gar nichts.
»Dad hat auch erzählt, dass du zu Hause unterrichtet wirst.«
»Jepp.«
»Und ist das auch manchmal einsam?«
Ich weiß nicht, ob er das alles fragt, weil er einfach neugierig ist oder weil er es wirklich wissen will. Was letztlich aber auch egal ist, solange ich nur jemanden zum Reden habe. »Die meisten Kinder bei uns im Ort werden zu Hause unterrichtet. Uns bleibt fast keine Wahl, weil wir pro Strecke zur Schule über eine Stunde fahren müssten«, erzähle ich und bin selbst überrascht, wie gefasst ich dabei klinge.
Er setzt sich auf, beugt sich vor und mustert mich scharf. »Das war aber keine Antwort auf meine Frage.« Er klingt nicht vorwurfsvoll, es ist eher eine sachliche Feststellung.
»Nein, es ist nicht einsam«, murmle ich. »Normalerweise ist mein bester Freund Holden dabei. Seine Mom hilft uns. Wir lernen entweder bei ihm zu Hause, oder er kommt rüber zu uns.«
Leo blinzelt, und ich füge hinzu: »Ich hab mal gehört, dass wir innerhalb von zwei Stunden einen ganzen Schultag abarbeiten können …«
Er knabbert kommentarlos an seiner Unterlippe herum.
»Deshalb haben wir nach dem Unterricht immer noch jede Menge Zeit, einfach abzuhängen und …« Ich verstumme, weiß nicht, was ich noch sagen soll.
»Und?«, drängt er.
»Und … keine Ahnung, irgendwas zu finden, womit wir uns beschäftigen können.«
Er seufzt, dann fährt er nach kurzem Schweigen fort: »Und dieser Holden ist also dein bester Freund?«
»M-hm.« Und mein einziger, aber das sage ich Leo nicht.
»Meine beste Freundin ist Laney«, erzählt er.
Unwillkürlich mache ich große Augen und hoffe noch im selben Moment, dass er es nicht gemerkt hat. Ich hatte angenommen, dass Laney zu Lucas gehört. Aber vielleicht habe ich mich geirrt.
»Ist er dein fester Freund?«
Die Frage verschlägt mir die Sprache, und ich ziehe mit gerümpfter Nase den Kopf ein. »Wer? Holden?«
Leo nickt.
Ich schüttle den Kopf. »Nein, wir sind nur beste Freunde.«
»Glaubst du, dass Jungs und Mädchen einfach nur befreundet sein können? Ohne dass Gefühle im Spiel sind?«, bohrt er weiter.
Dieses Gespräch übersteigt meinen Horizont. Klar, ich bin verknalltin Leo Preston, aber ich bin mir absolut darüber im Klaren, dass das nicht viel bedeutet. Ich fühle mich hingezogen zu einem Jungen in meinem Alter, weil ich glaube, dass er mich auf seine Dreizehnjährigen-Art vielleicht ein bisschen mag. Aber richtige … Gefühle?Wie sollte ich die haben,wo ich ihn doch kaum kenne? Und jetzt stellt er mir auf einmal solche großen Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Also kontere ich: »Hast du denn Gefühle für Laney?«
Er grinst.
Und da wird mir klar, dass ich vielleicht doch Gefühle habe – körperlicher Art.
Er beugt sich wieder vor. »Hast du denn einen Freund?«
Fast muss ich lachen. »Nein.«
Er nickt, dann lehnt er sich wieder in seinem Stuhl zurück, nimmt sein Buch zur Hand, und ich bin dankbar für die Pause, weil ich dringend meine Gedanken ordnen muss. Aber diese Pause dauert nicht lange. Diesmal schmeißt er sein Buch regelrecht auf den Tisch. »Was hat Vagina gekocht?«
Ich starre ihn mit weit aufgerissenen Augen an.
»Ups! Virginia«, haspelt er und kneift die Augen zu. »Ich meinte natürlich Virginia.« Er öffnet die Augen wieder. »Tut mir leid. Wir nennen deine Mom manchmal so, weil … weil wir ein bescheuerter Haufen sind. Entschuldige bitte, ich wollte nicht respektlos sein.«
Ich muss ein Kichern unterdrücken, weil das ein ziemlich witziger Spitzname ist. Aber er ist auch heftig, selbst für Preston-Verhältnisse. Ich hebe die Alufolie über der Auflaufform an und spähe darunter. »Hackbraten, würde ich sagen.«
Leo springt so hastig auf, dass sein Stuhl umfällt. »Warte hier!«, sagt er, verschwindet im Haus und kommt kurz darauf mit zwei Gabeln zurück. Als er sich wieder setzt, nimmt er nicht seinen alten Platz ein, sondern den direkt neben mir und zieht die Auflaufform zu uns. Dann reicht er mir eine Gabel, entfernt die Alufolie und haut rein. »Alter, deine Mom kann echt kochen«, schwärmt er mit vollem Mund.
Kann ich nicht beurteilen, will ich sagen, verkneife es mir aber.
»Willst du denn gar nichts?«
»Sollten wir nicht … Ich weiß nicht … Ist das nicht für …«
»Wir sind hier sechs Jungs plus Vater unter einem Dach, Mia«, sagt er in einem leicht spöttischen Tonfall, bei dessen Klang mein Magen einen Salto schlägt. »Was Essen betrifft, gilt das Recht des Schnelleren.«
Ich muss grinsen.
Er schaufelt sich drei weitere Gabeln in den Mund, während ich gerade mal eine schaffe. Wieder mit vollem Mund fragt er: »Dann hast du also nur zwei Stunden am Tag Schule?«
»M-hm.«
»Klingt mega.«
Ich kichere. »Ja, ist ziemlich cool.«
»Was für eine Art Farm hat dein Grandpa?«, fragt er weiter.
»Es war mal ein Milchhof, aber vor ein paar Jahren ist mein Grandpa in Ruhestand gegangen und hat das ganze Vieh und die Geräte verkauft. Behalten hat er nur das Haus und das Land.«
Leo scheint kurz über das Gehörte nachzudenken, dann lässt er die Gabel sinken und schluckt. Nachdem er sich mit dem Handrücken den Mund sauber gewischt hat, fragt er tonlos: »Und dein Dad? Ist er tot?«
»Nein«, entgegne ich leise und richte den Blick auf meine Hände. Das ist ein schwieriges Thema, und ich versuche, nie darüber nachzudenken, geschweige denn, darüber zu reden. Dass Leo sich so beiläufig danach erkundigt, versetzt mir einen Stich in die Brust – und zwar nicht meinet-, sondern seinetwegen. Ich weiß, was mit seiner Mom passiert ist. Deswegen glaube ich, dass er sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass etwas anderes als der Tod Eltern trennen kann.
»Aber wo ist er dann?«, will Leo wissen.
»Er wohnt in New York.«
»Und wieso?«
»Weiß ich nicht.«
Sein Blick scheint überall zugleich zu sein, bis er schließlich auf der Garagenwohnung zum Ruhen kommt. Dabei zuckt eine ganze Reihe von Gefühlsausdrücken über sein Gesicht. Mit einem verkniffenen Zug um den Mund lässt er den Blick dann von der Wohnung zu mir schweifen. Schaut mir unverwandt in die Augen. Und da sehe ich es. Zum ersten Mal. Eine klare Gefühlsregung von Leo Preston. Es ist Mitleid.
Und ich hasse es.
Meine Gabel landet mit lautem Klirren auf dem Tisch und durchbricht die Stille zwischen uns.
»Mein Grandpa liebt mich«, stoße ich hervor. Ich bereue meine Worte, kaum dass sie meinen Mund verlassen haben. Sie klingen so erbärmlich. So kindisch undverletzlich.
Er will gerade etwas erwidern, da durchschneidet die Stimme meiner Mutter die Abendluft. »Mia, komm sofort zu mir. Hör auf, dem Jungen auf die Nerven zu gehen!«
Leo springt auf, seine Kiefermuskeln mahlen. »Aber sie nervt mich gar nicht!«, knurrt er, und für einen Sekundenbruchteil verschlägt es mir den Atem.
Ich stehe auf und schiebe mich an Leo vorbei, der selbstsicher auf der Verandatreppe steht. »Ich sollte besser gehen«, flüstere ich, dann rufe ich meiner Mutter zu: »Komme schon!«
Im Stechschritt marschiere ich rüber zur Wohnung, als ich erst Schritte hinter mir höre und dann Leos Stimme: »Warte!«, und dreht mich am Ellenbogen zu sich herum. Meine Nase ist auf Höhe seiner Brust, und sein schwerer Atem streicht über meinen Scheitel. »Manchmal stehst du ganz früh auf und gehst aus der Wohnung«, sagt er hastig. »Das kann ich von meinem Schlafzimmerfenster aus sehen.«
Ich hebe das Kinn, schaue zu ihm auf. Atme stockend aus.
»Machst du das morgen auch?« Er wirft einen Blick rüber zur Wohnung, von der aus uns meine Mutter unter Garantie beobachtet. »Halb fünf. Wir treffen uns hier am Fuß der Treppe.«
Ich sage nichts, weil mein Herz so heftig gegen meine Rippen hämmert, dass ich unmöglich auch nur einen Ton herausbekommen kann.
Leo hebt die Brauen, sieht mich fragend an.
»Okay«, flüstere ich schließlich.
»Mia!«, keift meine Mutter.
Leo lässt meinen Ellbogen los und macht einen Schritt rückwärts. »Halb fünf«, flüstert er noch, dann grinste er, schaut hoch zu meiner Mom und tippt sich wie beim Salutieren mit zwei Fingern an die Stirn. »Gute Nacht, Vagina!«
Kapitel 3
MIA
Draußen ist es noch stockdunkel, als ich am nächsten Morgen aus der Eingangstür spähe. Leo ist schon da und wartet mit seiner Hoodie-Kapuze über dem Kopf unten an der Treppe. Er muss gehört haben, wie sich die Tür geöffnet hat, weil er aufsieht und lächelt. Seine Zähne bilden einen hellen Kontrast zum frühmorgendlichen Dunkel. Dann zieht er ein Fahrrad unter der Treppe hervor. »Lass uns fahren«, sagt er, und ich erstarre.
Ich habe keine Ahnung, was er vorhat oder wo wir hinwollen. Vor allem aber habe ich keine Ahnung, was seine Einladung zu bedeuten hat.
Gestern Abend hat er gesagt, dass er gesehen hat, wie ich morgens manchmal ganz früh das Haus verlasse. Bedeutet das, er beobachtet mich? Oder ist er nur extrem früh wach und starrt psychomäßig aus dem Fenster? Und jetzt kommt er hier mit einem Fahrrad an, was bedeutet, dass er mit mir irgendwohin will, nur er und ich. Vermutlich sollte ich besser nicht mitgehen, nicht dass er mich am Ende abmurkst und irgendwo im Wald verbuddelt, und niemand …
»Kommst du jetzt oder nicht?« Er scharrt mit den Füßen im Kies herum und rückt seinen Rucksack zurecht.
Na, toll. Ein Rucksack! Da hat er garantiert seine Serienkillerausrüstung drin. Mit der er bestimmt schon an haufenweise Tieren geübt hat, und … O Gott, nein, bitte nicht, die armen Tiere!
Doch während ich all das denke, bin ich schon wie ferngesteuert die Treppe nach unten gegangen und stehe meinem potenziellen Mörder von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Das muss an der Übermüdung liegen, denn ich hab mich die halbe Nacht lang hin- und hergeworfen und mir zig verschiedene Szenarien ausgemalt, was heute früh passieren wird. So ungern ich es auch zugebe – meine größte Sorge bestand darin, nicht zu wissen, in welchem Winkel ich den Kopf neigen soll, wenn Leo Preston mich küssen will. Ziemlich peinlich, ich weiß, ich weiß.
»Können wir?«, fragt er, und ich versuche, mir meine Nervosität nicht anmerken zu lassen, als ich zu ihm hochschaue und nicke.
Er reicht mir den Rucksack und steigt auf sein Rad, während ich verlegen danebenstehe und nicht weiß, worin meine Aufgabe besteht. »Na los, spring auf.« Er lächelt und deutet mit dem Daumen nach hinten. Als ich die Fußrasten bemerke, wird mir flau im Magen. Ich bin nicht gerade eine Elfe und deswegen sowieso schon unsicher genug.
Ernüchtert weiche ich einen Schritt zurück und hasple: »Wollen wir nicht vielleicht … einfach laufen?«
Leo mustert mich prüfend. »Wieso?«
Offenbar wird er nicht von selbst drauf kommen.
Ich räuspere den Kloß in meinem Hals weg und halte Leo den Rucksack wieder hin. »Weißt du, ich fühle mich gerade nicht so besonders …« Ich drehe mich um und will schon gehen, da packt er mich am Ärmel. Ich könnte im Boden versinken vor Scham, blinzle gegen die Tränen an.
»Hab ich was falsch gemacht?«, fragt er verunsichert.
»Nein«, entgegne ich hastig und drehe mich kopfschüttelnd zu ihm um. »Ganz und gar nicht.«
»Dann …« Er senkt den Blick. »Dann hast du nur einfach keine Lust, mit mir abzuhängen?«
»Doch!«, schießt es viel zu schnell aus mir heraus, und ich mache unwillkürlich einen Schritt auf ihn zu. Er wirkt ähnlich enttäuscht, wie ich mich fühle. Aber er ist gleichzeitig auch verwirrt, und ich will nicht, dass er das Gefühl hat, etwas falsch gemacht zu haben. Also atme ich tief durch und rücke mit der Wahrheit heraus. »Ich bin nur einfach nicht gerade …« Ich bringe den Satz nicht zu Ende, sondern deute bloß mit dem Finger meinen Körper rauf und runter.
Leo lacht leise auf, der Klang hallt durch die Luft bis in mein Herz. »Ich bin zwar dürr, aber stark. Ich bekomm das hin, versprochen! Außerdem bist du echt irgendwie zart.«
Wenn ich mich selbst mit drei Wörtern beschreiben müsste, würde ich mich für »klein«, »pummelig« und »unscheinbar« entscheiden.
Zart jedenfalls bin ich ganz sicher nicht. Aber aus irgendeinem Grund scheint er mich trotzdem so zu sehen. Und das … das bedeutet mir unendlich viel.
Viel mehr, als es sollte.
Ich weiß nicht, wie lange wir fahren, ehe er vor einem hohen Maschendrahtzaun anhält. Auf der Fahrt haben wir nicht geredet, und ich schweige weiter, als wir vom Rad steigen und Leo mir mit einer Taschenlampe in der Hand, die an seinem Lenker befestigt war, vorausläuft. Er leuchtet mir den Weg zu einem Loch im Zaun. Keine Ahnung, ob er es sogar zusammen mit seinen Brüdern hineingeschnitten hat. Ich weiß nur, was wir hier machen, ist aller Wahrscheinlichkeit nach verboten.
Er hebt das Drahtgeflecht ein wenig an, damit ich hindurchkriechen kann, und ich frage: »Geraten wir dafür in Schwierigkeiten?«
Leo seufzt auf, aber es klingt nicht so, als würde er es ernst meinen. »Hey, weißt du noch, vorhin, als du dachtest, dass ich das Rad mit dir hintendrauf nicht von der Stelle bekomme?«
Das weiß ich natürlich noch, schließlich ist es kaum mehr als eine Viertelstunde her. »Ähm … ja?«
»Trotzdem bist du aufgestiegen, oder?«
Ich nicke und knabbere mir auf der Unterlippe herum.
»Und warum?«
»Weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil ich einen klitzekleinen Sprung in der Schüssel habe?«
»O nein.« Er schüttelt den Kopf und richtet sich auf, strafft stolz die Schultern. »Du bist aufgestiegen, weil du mir vertraust.«
Wir schlagen uns durchs hohe Gras, während Leo mir erklärt, dass wir auf dem Weg zu einem stillgelegten Wasserturm sind. Am Wochenende gehen die älteren Jugendlichen wohl zum Feiern dorthin, aber so früh am Morgen hat er dort noch nie jemanden gesehen. Er gibt zu, dass man den Turm und das Gebiet drumherum eigentlich nicht betreten darf, aber die Cops drücken wohl ein Auge zu, solange nichts wirklich Illegales stattfindet, das über Alkohol hinausgeht. Offenbar war es Cameron, der Freund seiner Schwester, der ihm den Turm gezeigt hat. »Weil er weiß, dass ich die Stille mag«, sagt er achselzuckend. »Er ist Einzelkind, deswegen wird es ihm bei uns zu Hause manchmal ein bisschen zu viel.«
»Klar«, erwidere ich, als würde ich das nachvollziehen können. Manchmal essen Mom und ich zwar zusammen mit den Prestons, aber meistens bleiben wir bei uns in der Wohnung und wechseln während der Mahlzeiten, wenn’s hochkommt, zwei bis drei Sätze miteinander.
Als wir den Wasserturm erreicht haben, fragt Leo: »Du hast doch keine Höhenangst, oder?«
»Nein.«
»Und kommt du mit der Leiter zurecht?«
Ich pruste los. »Stell dir vor, wir haben auf der Farm sogar einen eigenen Wasserturm.«
Er hebt die Brauen und stichelt: »Klar, du mit deiner tollen eigenen Farm und deinem tollen eigenen Wasserturm.«
»Klappe!« Lachend versetze ich ihm einen leichten Schubs gegen die Schulter, er macht einen Ausfallschritt nach hinten und lacht mit, und aus irgendeinem Grund fühlt sich dieser Augenblick unendlich bedeutsam an. Es ist das erste Mal, dass ich woanders als zu Hause einfach ich selbst bin. Zulasse, dass mich jemand sieht, so wie ich eben bin.
Auf dem höchsten Sims des Turms holt Leo eine Thermoskanne, Snacks und das Taschenbuch, in dem er gestern Abend schon gelesen hat, aus seinem Rucksack. »Wovon handelt das Buch?«, frage ich.
Er stößt Luft aus und setzt sich mit baumelnden Beinen neben mich. »Weiß ich auch noch nicht so richtig.« Da er sich nicht weiter dazu äußert, belasse ich es dabei. »Ich wollte dich mal was fragen«, fährt er zögerlich fort, während er die Snacks zwischen uns aufteilt. »Du musst natürlich nicht antworten, wenn du nicht willst …« Er späht durch seine dichten Wimpern zu mir rüber. Eine dunkle Haarsträhne ist ihm in die Stirn gefallen.
Mein Puls beschleunigt sich, und ich werde nervös. »Okay …«
Er räuspert sich und blickt hinaus in die Dämmerung. Dann lässt er die Knöchel knacken und dreht sich anschließend zu mir. Sein Blick ist so durchdringend, dass mir angst und bange wird. »Gestern Abend hat dich mein Dad gefragt, ob meine Brüder und ich …«
»Tut mir leid«, unterbreche ich ihn und meide seinen Blick. »Ich hätte ihn nicht anlügen sollen.«
»Ich finde das nicht schlimm«, versichert er mir hastig. »Ich wollte nur wissen, warum du es getan hast.«
Achselzuckend antworte ich: »Weil ich nicht wollte, dass ihr Jungs Ärger bekommt.«
Er antwortet nicht, aber ich spüre seinen fragenden Blick auf mir ruhen.
Leo mag Stille schön finden, aber ich komme nicht mit Schweigen zurecht. Vor allem nicht, wenn er mich anschweigt. In der Hoffnung, dadurch Geräusche zu verursachen, lasse ich meine Beine wild vor und zurück schwingen und schiebe mir die Hände unter den Po, damit nicht auffällt, wie stark sie zittern.
Es verstreichen mehrere Minuten, in denen keiner von uns ein Wort verliert, und ich halte den Kopf gesenkt und die Augen geschlossen, bis Leo irgendwann sagt: »Bist du deswegen auch so mit deiner Mom?«
Ich öffne die Augen und fahre zu ihm herum. »Wie denn?«
Er sieht mich mit großen Augen an, als hätte er gerade etwas vollkommen Offensichtliches gesagt. »Na ja, sie behandelt dich absolut scheiße, und du wehrst dich nicht dagegen.«
Als er scheiße sagt, zucke ich zusammen. Ich schüttle den Kopf, bin gleichzeitig wütend auf ihn und so verletzt, dass mir die Tränen in den Augen brennen. »Darüber will ich nicht reden«, entgegne ich leise.
»Tut mir leid.« Seine Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern. »Ich wollte nicht …« Sein Tonfall ist so ernst, dass es mir einen Stich versetzt. »Ich wollte dich nicht traurig oder wütend machen. Ich … Ich hätte das nicht sagen dürfen.«
Ich antworte nicht.
Dafür bin ich zu beschäftigt damit, meine Gefühle in den Griff zu bekommen.
»Mia?«
»Hm?«
»Es tut mir echt leid.«
»Schon okay.« Ich sehe ihn an. »Es ist nur …«
Er unterbricht mich, indem er den Kopf schüttelt. »Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Ich werde dich nie wieder darauf ansprechen, okay?« Mit einem traurigen Lächeln auf den Lippen zeichnet er sich ein Kreuz übers Herz. »Ich schwöre.«
Ich reagiere mit einem dankbaren Nicken.
Dann stupst er mit dem Fuß gegen meinen. »Es ist so weit«, sagt er und deutet auf den Horizont. In der Ferne geht die Sonne auf, die Silhouetten von Bäumen zersplittern zwischen den ersten leuchtenden Streifen. Über dem Boden liegt Nebel, der alles, was unten ist, vor dem Oben verschwimmen lässt, und dieses Oben raubt mir den Atem. Dort, wo gerade eben noch Dunkelheit war, leuchtet der Himmel nun in den verschiedensten Schattierungen von Rot, Rosa und Lila, so weit das Auge reicht.
Es ist endlos, dieses Oben.
Grenzenlos.
»Als wäre die Welt entzweigerissen«, flüstere ich ehrfürchtig.
»Ich weiß.« Dann, nach einer kurzen Pause: »So wie du.«
Kapitel 4
LEO
Ich hab noch nie jemanden zum Wasserturm mitgenommen. Das ist immer mein Ort gewesen, eine Zuflucht vor dem Gebrüll und Geheule und dem allgemeinen Chaos bei uns zu Hause. Dad weiß, dass ich morgens manchmal herkomme, aber solange ich pünktlich zum Frühstück wieder zu Hause bin, scheint es ihm nichts auszumachen. Insgesamt scheint ihm vieles, was ich tue oder eben auch nicht tue, nichts auszumachen, solange ich nur anwesend bin, wenn es drauf ankommt. Und mit »anwesend« meine ich sowohl körperlich als auch geistig. Aber heute Morgen hab ich die Zeit aus den Augen verloren. Ich hätte den ganzen Tag lang auf dem Turm sitzen können, ohne ein Wort zu sagen, solange nur Mia bei mir wäre. Es hat sich angefühlt wie Sekunden, und ich wünschte, ich hätte daraus Minuten, Stunden, Tage machen können.
Als wir zu Hause ankommen, brennen meine Beine, und ich fluche leise in mich hinein, weil ich Dad in seiner Arbeitsmontur die Verandatreppe herunterkommen sehe. Als er uns sieht, bleibt er stehen, und ich bremse neben ihm. »Tut mir leid«, sage ich hastig und halte dabei das Rad stabil, damit Mia absteigen kann. Ihre Wangen sind gerötet, ob vom Fahrtwind oder vor Verlegenheit, kann ich nicht beurteilen.
»Morgen, Mr Preston … Tom«, sagt sie gefasst und nimmt dabei den Rucksack ab, den sie während der Rückfahrt wieder getragen hat. Ich vermisse schon jetzt das Gefühl ihrer Hände auf meinen Schultern.
Dad schenkt erst ihr, dann mir ein Lächeln. »Ihr wart doch nicht etwa die ganze Nacht lang weg, oder?«
»Nein, Sir.«
»Wasserturm?«
Ich nicke.
Auch er nickt knapp, dann sieht er wieder Mia an. »Weiß deine Mom, dass du das Grundstück verlassen hast?«
Mia starrt auf ihre Füße. »Nein, Sir.«
Dad gibt einen tiefen Seufzer von sich, sagt aber nichts weiter dazu, sondern steigt in seinen Truck und lässt den Motor an. »Die Großen schlafen noch«, ruft er mir zu. »Also iss lieber, so viel du kannst, ehe sie aufwachen.« Dann zwinkert er mir zu, eine wortlose Botschaft, die ich nicht recht verstehe.
Mia und ich sehen dem Truck nach, bis er um die Ecke verschwunden ist. Dann steige ich vom Rad und nehme ihr den Rucksack ab. »Wollen wir das morgen wieder machen?«
Sie knabbert sich auf der Lippe herum, und als ich ihren Blick suche, sind ihre Augen so hell wie nie. Da ist etwas an der Art und Weise, wie sie mich immer ansieht. Wie ihr Blick einen Sekundenbruchteil lang an mir haften bleibt, sobald wir uns im selben Raum aufhalten. Es sind Momente, die ich gleichzeitig liebe und fürchte.
»Wirst du auch keinen Ärger bekommen?«, fragt sie.
»Nö.« Zumindest nicht von Dad. Meine Brüder sind ein anderes Kapitel. Ich kann nur hoffen, dass Dad ihnen nichts von uns erzählt.
Ich hatte schon ein paar Freundinnen – so wie man in der achten Klasse eben Freundinnen hat. Wir haben Händchen gehalten, und ein paar von ihnen hab ich sogar geküsst. Aber nichts davon war richtig ernst, meistens, weil die Mädchen etwas in mir gesehen haben, das ich nicht bin. Sie wollten Dinge von mir, die ich nicht zu geben bereit war, und haben am Ende Schluss gemacht, ehe wir wirklich zusammen waren. Um ehrlich zu sein, war mir das nur recht so. Für keine von ihnen hatte ich richtige Gefühle. Dazu kam, dass meine Brüder es in der Regel schafften, mir alles zu versauen. Entweder gingen uns die Zwillinge auf den Keks, oder Lucas war einfach nur da, und das reichte, damit sich die Mädchen in ihn verliebten anstatt in mich, oder Logan spannte sie mir absichtlich aus, weil Logan eben Logan ist.
Mit Mia ist alles anders. Ich weiß nicht, warum, ich kann es nicht erklären. Nicht mal mir selbst. Ich habe panische Angst, dass ich irgendwas Falsches sagen könnte und sie mich nicht mehr mag, auch nicht als Freund. Deswegen war es bisher einfacher, nicht zu viel von mir preiszugeben. Aber vielleicht war es auch nicht genug.
Jedenfalls stecke ich jetzt bis zum Hals in der Sache drin.
Und das Letzte, was ich will, ist, dass meine Brüder mir alles kaputt machen. Was auch immer dieses Alles ist.
»Gleiche Zeit?«, fragt sie.
Ich nicke und verkneife mir mein erbärmlich-glücksduseliges Grinsen, bis sich unsere Wege trennen.
Den ganzen Tag über denke ich, dass ich glimpflich davongekommen bin, denn offenbar haben meine Brüder nichts von meinem gemeinsamen Morgen mit Mia mitbekommen. Bis Dad unvermittelt während des Abendessens sagt: »Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll, dass du dich mitten in der Nacht mit Mia aus dem Haus schleichst.« Da weiß ich, dass ich am Arsch bin. Eine Stahlklammer legt sich um meine Brust und quetscht mein Herz zusammen. Logan und Lucas brechen in schallendes Gelächter aus, bis Dad ihnen einen bösen Blick zuwirft. Die Zwillinge kichern miteinander, dann lachen sie mich offen aus. Lachlan schleudert Kartoffelbrei über den Tisch, der Logan mitten ins Gesicht trifft. »Du blöder kleiner Scheißer!«, brüllt Logan.
»Logan!«, knurrt Dad. »Er ist doch noch ein Baby.«
»Er ist drei!«, keift Logan und katapultiert mit seinem Löffel einen Klumpen Kartoffelbrei zurück auf Lachlan, trifft stattdessen aber einen der Zwillinge, und dann bricht die Apokalypse aus, und ich mache, was ich immer mache, wenn die Kacke am Dampfen ist.
Ich klinke mich aus.
Esse meinen Teller leer.
Spüle mein Geschirr ab.
Und gehe.
Oben in meinem Zimmer lasse ich mich aufs Bett fallen und starre mit geballten Fäusten an die Decke. Ich muss nicht lange warten, bis meine Tür auffliegt und Lucas und Logan hereinstürmen, ohne anzuklopfen.
»Mia?«, fragt Luke. »Nicht dein Ernst.«
»Und sie haben sich nachts davongeschlichen.« Logan lacht. »Ich dachte immer, ich bin hier das schwarze Schaf.«
Ich reagiere nicht.
Drauf einzugehen, macht alles nur schlimmer.
»Aber findest du sie nicht ein bisschen … merkwürdig?«, fragt Luke.
Logan schnaubt. »Untertreibung des Jahrhunderts. Aber es passt zu Leo.«
Lucas muss lachen. »Hast du sie geküsst?«
»Hast du sie gevögelt?« Logan gackert los.
In diesem Moment hasse ich sie aus tiefster Seele. Nicht wegen der Dinge, die sie sagen, sondern …
Sondern weil ich diese eine einzige Sache nur für mich wollte. Für mich allein. Diese eine einzige »Sache« namens Mia. Und die beiden ziehen die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, mit ihren Sprüchen in den Dreck.
Sie ziehen Mia in den Dreck.
Machen alles kaputt, so wie sie immer alles kaputt machen. Und ich weiß, dass sie von jetzt an keine Gelegenheit ungenutzt lassen werden, damit weiterzumachen.
Aber das werde ich nicht zulassen.
Nicht diesmal.
Dafür bedeutet sie mir zu viel. Ich will mein Gefühl von heute Morgen schützen, von gestern Abend, als da nur wir beide waren und niemand sonst, umso mehr, weil ich weiß … Ich weiß, dass es jetzt, wo meine Brüder davon wissen, niemals wieder einen solchen Moment zwischen uns geben wird.
Also will ich wenigstens die Erinnerungen daran am Leben erhalten.
»Raus aus meinem Zimmer.« Mehr sage ich nicht, auch wenn ich vermutlich sollte.
Lachend verziehen sie sich.
In dieser Nacht bekomme ich kein Auge zu. Nicht mal ein paar Sekunden lang. Und als um 4 Uhr 20 mein Wecker klingelt, stehe ich auf und sehe als Erstes aus dem Fenster. Ich warte, bis Mia die Tür aufmacht und nach draußen späht. Aus dem Dunkel beobachte ich, wie sie sich unten auf die Treppe setzt und immer wieder auf die Uhr schaut. Die Minuten verstreichen, die Zeit rinnt mir zwischen den Fingern davon, und ich spüre die Risse in meinem Herzen tiefer werden.
Nachdem sie eine ganze Stunde lang gewartet hat, gibt sie auf.
Und in mir gibt etwas nach.
Ich ziehe die alte Schuhschachtel unter meinem Bett hervor. Hebe den Deckel ab.
Hunderte und Aberhunderte von Fotos kommen zum Vorschein.
Ganz oben liegt das von ihr.
Ihre hellbraunen Augen starren mir von dem Stapel entgegen.
Ich halte das Foto in der Hand, während ich mit der anderen die restlichen Bilder durchsehe, sie umdrehe, um die Beschriftungen auf den Rückseiten durchzulesen.
Drei Wörter.
Alle anders.
Es ist das Einzige, worum mich meine Mutter gebeten hat.
Ein Jahr vor der Krebsdiagnose fing es an. Sie machte sich Sorgen um mich, das erkannte ich an den Blicken, die sie mir manchmal zuwarf. Meine Brüder sah sie nie so an. Die waren immer gut zurechtgekommen, sagten ihre Meinung. Beziehungsweise sagten überhaupt irgendwas.
Ich dagegen war still.
Zu still.
Außer, ich war es gerade nicht.
Manchmal hatte ich »Ausbrüche«, wie Mom das nannte. Manche waren verbal, andere körperlich. »Leo kann seine Gefühle nicht verarbeiten«, hörte ich sie eines Abends zu Dad sagen. »Er frisst sie so lange in sich hinein, bis er irgendwann einfach explodiert.«
Am nächsten Tag überreichte sie mir einen dicken Stapel willkürlich zusammengewürfelter Fotos, die größtenteils die Familie zeigten. Einige hatte sie aber auch aus Zeitschriften und Katalogen ausgeschnitten. Ich saß an meinem Schreibtisch und starrte aus dem Fenster. Mom schob mir ein Foto hin. Es zeigte mich mit den Zwillingen im Arm, da waren sie gerade erst geboren. Lucy saß neben mir und achtete darauf, dass ich nichts falsch machte. »Was würdest du sagen, wie du dich damals gefühlt hast, Leo?« Ihr Tonfall war sanft, weich. »Und wie fühlst du dich, wenn du das Foto jetzt ansiehst?«
Ich musterte das Bild kurz, dann sah ich zu ihr hoch. »Glücklich«, erwiderte ich leise.
Da lächelte sie und zog das Foto wieder zu sich hin, drehte es um und schrieb glücklich auf die Rückseite. »Und was noch?«
»Dankbar.«
Ihr Lächeln wurde noch eine Spur strahlender. »Dankbar wofür?«
»Für die Geburt der Zwillinge. Und dass sie gesund waren.«
Sie nickte und schrieb dankbar auf. »Eins noch.«
»Ängstlich.«
Ruckartig sah sie auf. Sie wirkte besorgt. »Jetzt oder damals?«
Ich zuckte mit den Achseln, sah wieder aus dem Fenster. »Beides.«
»Aber warum, Leo?«, fragte sie und legte mir eine Hand auf die Schulter.
Ich hielt den Blick weiter auf die Waldgrenze hinter dem Fenster gerichtet. »Weil ich nicht will, dass sie kaputtgehen.«
Einen langen Moment entgegnete meine Mutter nichts, aber ich spürte ihren Blick auf mir ruhen, und ich fragte mich, wie lange sie brauchen würde, um zu begreifen, dass ichder Kaputte hier war.
»Meinst du, du könntest noch ein paar mehr in dieser Art machen?«, fragte sie schließlich. »Für mich?« Dann schob sie hastig nach: »Oder auch einfach für dich. Du musst sie niemandem zeigen.«
Ohne meine Antwort abzuwarten, ging sie wieder Richtung Tür. »Überleg dir einfach drei Gefühle«, sagte sie noch. »Und dann schreibst du sie auf.«
Auf dem Foto sitzt Mia mit ihrem Telefon in der Hand unten auf der Verandatreppe. Sie war traurig, das konnte ich an ihren Augen ablesen. Daran, wie sich ihre Mundwinkel leicht nach unten bogen.
Ich weiß selbst mich mehr, was genau mich damals dazu bewegte, zu meiner Schwester zu rennen und sie zu bitten, mir ihr Handy zu leihen. Jedenfalls machte ich das Bild, schickte es per Mail an mich selbst und löschte es sofort von Lucys Telefon, um auch ja keine Spuren zu hinterlassen.
Es war der erste Sommer, den Mia bei uns verbrachte, und anfangs fühlte es sich seltsam an, dass jemand Fremdes bei uns wohnte. An ihre Mom hatten wir uns inzwischen alle gewöhnt, aber jetzt … jetzt war da noch dieses Mädchen, das in meinem Alter war und kam und ging, ohne dass es jemand bemerkte.
Außer mir.
Irgendetwas löste sie in mir aus. Als würde ihre Anwesenheit einen Schalter umlegen. Dann klinkte ich mich aus und hatte nur noch Augen für Mia.
Für Mia und nichts sonst.
Ich wusste damals nicht, was das bedeutet.
Weiß es bis heute nicht.
Vermutlich ist das der Grund dafür, dass noch immer nichts auf der Bildrückseite steht.
Kein einziges Wort.
Das Foto ist unbeschrieben.
Blank und leer.
Genauso wie ich.
Kapitel 5
LEO
An den darauffolgenden Tagen kommt Mia morgens nicht mehr aus der Wohnung. Das weiß ich, weil ich nach ihr Ausschau halte. Sie kommt nicht wie sonst manchmal zum Frühstücken oder Mittagessen vorbei, und auch im Garten sehe ich sie kein einziges Mal. Wenn sie die Wohnung überhaupt verlässt, dann so, dass ich es nicht mitbekomme. Ein Teil von mir ist dankbar, dass sie sich nicht blicken lässt und ich sie nicht vor den fiesen Sprüchen meiner Brüder schützen muss. Aber vor allem plagen mich Schuldgefühle.
Und so ungern ich es auch zugebe – ich vermisse sie.
Vermisse die ruhigen Gespräche, die Stille zwischen uns.
Der Tag, an dem wir beim Wasserturm waren, war ein Montag. Am Samstag bin ich kurz davor, den Verstand zu verlieren. Ich … ich will einfach nur mit ihr reden, mich entschuldigen. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß bloß, dass, was auch immer es ist, ich vorher gründlich darüber nachdenken muss. Und dafür muss ich aus einem Teil von mir schöpfen, der womöglich gar nicht existiert. Vor allem aber muss ich dafür sorgen, dass wir ungestört bleiben, wenn wir miteinander reden.
Und so liege ich im Bett, lausche den Vögeln, die draußen mit ihrem Gezwitscher einen neuen Tag willkommen heißen, und schmiede einen Plan. Ich werde so tun, als würde ich in der Garage unter der Wohnung an einem Projekt arbeiten. So bekomme ich es als Erster mit, wenn Mia das Haus verlässt, und kann sie abfangen. Und dann werde ich vier Wörter zu ihr sagen: Es tut mir leid. Ab da muss ich improvisieren. Selbst wenn ich mich bis auf die Knochen blamieren sollte, weiß sie danach wenigstens, was ich empfinde.
Der Plan ist wasserdicht, und zum ersten Mal seit Montag habe ich einen Grund zu lächeln.
Ich renne praktisch die Treppe nach unten – wo ich eine Vollbremsung einlege. Dad ist im Wohnzimmer. Zusammen mit Mia. Sie sitzen auf dem Sofa und unterhalten sich, verstummen aber schlagartig, als sie mich bemerken. »Gut, du bist wach«, sagt Dad und steht auf.
Ich werfe Mia einen kurzen Blick zu, habe Angst, dass sie Dad gesagt haben könnte, dass ich sie versetzt habe. Aber sie sieht mich gar nicht an, sondern hält den Blick gesenkt. Sie wirkt gefühlsleer, ein Zustand, den ich nur zu gut kenne.
Dad kommt mit einem Fünf-Dollar-Schein in der Hand auf mich zu. »Kannst du auf Lachie und die Zwillinge aufpassen?« Er deutet auf meinen jüngsten Bruder, der wie hypnotisiert vor dem Fernseher sitzt. »Die Zwillinge sind im Garten«, fügt Dad hinzu. »Mia und ich müssen was erledigen.«
Ich versuche, Mias Aufmerksamkeit zu erregen, aber es gelingt mir nicht. »Und was?«
»Nichts Wichtiges. In einer Stunde sind wir wieder da.«
Mia steht auf und nutzt meinen Dad wie einen Schutzschild.
»Leo?« Dad drückt mir das Geld in die Hand. »Das schaffst du doch, oder?«
Ich nicke. Die Reue lastet schwer auf meiner Brust. »Ja, klar.«
***
Ich passte noch keine fünf Minuten auf Lachie auf, da kommt schon Virginia zu uns nach drüben. Normalerweise arbeitet sie am Wochenende nicht, aber da sie mitgekriegt hat, dass ich mit den Kleinen allein bin, macht sie offenbar eine Ausnahme. »Wo ist dein Dad?«, fragt sie.
Ich mustere sie überrascht. »Er ist irgendwo hingefahren. Mit deiner Tochter.« Es kommt unfreundlicher rüber, als ich beabsichtigt habe, aber seit ich letzten Sommer Stunde um Stunde damit verbracht habe, Mia heimlich zu beobachten, und dadurch miterlebt habe, wie ihre Mutter sie behandelt, ist Virginia bei mir untendurch. Mir ist unbegreiflich, wie sie so liebevoll zu uns sein und gleichzeitig ihre eigene Tochter behandeln kann wie ein Ärgernis, eine Last.
Dabei ist Mia alles andere als das, und es macht mich stinkwütend, dass Virginia das offenbar nicht erkennt.