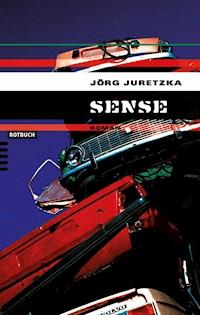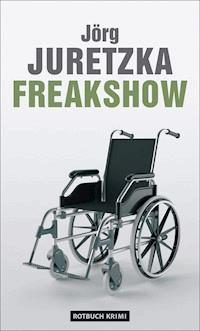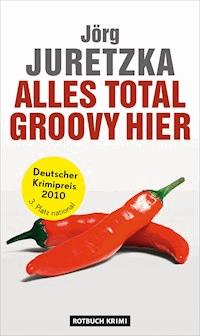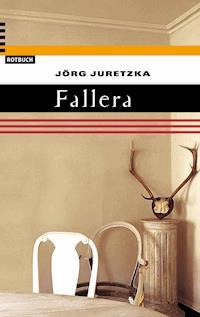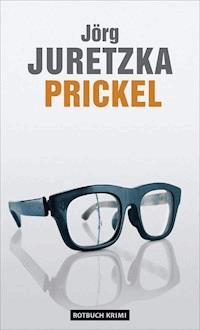
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BEBUG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Kristof-Kryszinski-Roman
- Sprache: Deutsch
Prickel ist ein bisschen langsam und spricht kaum mehr als drei Worte. Sein Freund Det ist schlauer und nimmt ihn nach einer Kneipentour mit zu Nina. Dann ist Nina tot, und Prickel sitzt mit einem blutigen Messer auf dem Dach. Von Det keine Spur, und "der Schlächter von Bottrop" wird bis auf weiteres in eine Irrenanstalt eingeliefert. Die schönste aller Anwältinnen Mülheims beauftragt den schäbigsten aller Privatdetektive, den dauerverkaterten Kristof Kryszinski, zu recherchieren ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
EPILOG
JörgJURETZKA
PRICKEL
Kriminalroman
Rotbuch Verlag
Von Jörg Juretzka liegen bei Rotbuch außerdem vor:
Freakshow (2011)
Fallera (2. Aufl. 2011)
Rotzig & Rotzig (2. Aufl. 2010)
Alles total groovy hier (2. Aufl. 2009)
Der Willy ist weg (4. Aufl. 2009)
eISBN: 978-3-86789-505-7
5. Auflage
© 2011 (1998) by Rotbuch Verlag, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Umschlagabbildung: Dudarev Mikhail (fotolia)
Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:
Rotbuch Verlag GmbH
Alexanderstraße 1
10178 Berlin
Tel. 01805 / 30 99 99
(0,14 Euro/Min., Mobil max. 0,42 Euro/Min.)
www.rotbuch.de
FÜR LUTZ.
UND, NATÜRLICH, FÜR CORA UND VERENA
Speziellen Dank an
Webb Wilder
für »Human Cannonball«
Sämtliche Figuren dieses Romans
sind frei erfunden.
Ich kann mich nicht entscheiden. Das heißt, natürlich entscheide ich mich irgendwann für oder gegen etwas, wie jeder. Bloß, bei mir dauert es.
Durch den Seitenausgang des Bahnhofs raus, linksrum, über die Straße, drei Stufen runter. Da stand ich und besah mir das Schaufenster. Dabei gab es da gar nichts zu sehen. Hätte ich mich umgedreht, hätte ich den Verkehr auf der Eppinghofer Straße betrachten können, die endlose Schlange der Autofahrer, immer in Eile, oder die Passanten, wie sie durch die Dunkelheit und den langsam fallenden Nieselregen hasteten, oder den fröstelnden Weihnachtsbaumverkäufer auf der Straßenseite gegenüber. Doch ich hatte mir schon lange angewöhnt, mich wegzudrehen, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe. Irgendwie scheint man mir das nämlich anzusehen. Wildfremde Leute bauen sich sonst plötzlich vor mir auf und fragen Sachen wie: ›Ist Ihnen nicht gut?‹ Oder: ›Kann ich Ihnen helfen?‹ Obwohl, das ist selten geworden. Meistens fragen sie heute: ›Gibt es ein Problem?‹ Oder, vertraulicher: ›Haben wir ein Problem?‹ Ein Problem? Richtig verliebt sind sie in dieses Wort, die Leute.
Ich stand also da und hielt meinen Blick auf die von innen rot gestrichene Scheibe gerichtet und dachte nach. Viel Geld hatte ich nicht mehr. Gleich, im Laden, wenn ich denn reinginge, würde ich es nachzählen. Auch so etwas, was ich mir angewöhnt hatte: mein Geld nicht mehr auf der Straße herauszuholen. Irgendjemand stoppt sonst, fragt: ›Haben Sie ein Problem?‹, und ehe ich mir die Worte zurechtgelegt habe, um eine Antwort zu formulieren, ist er weitergegangen, und gar nicht mal so selten ist mein Geld mit.
Eine Antwort formulieren, ja. Wenn ich ein Problem habe, dann das. Kein Mensch scheint zu begreifen, wie schwierig es ist, einen Satz zusammenzustellen. Allein die Auswahl an Wörtern ist ja immens. Und um überhaupt damit anzufangen, sich die richtigen herauszusuchen, muss man sich erst mal darüber im Klaren sein, was man sagen will. Und dann kommt auch schon das Wie. Man kann da nicht vorsichtig genug zu Werke gehen. Nehmen wir an, jemand fragt: ›Haben Sie ein Problem?‹ Was, bitte, soll ich darauf antworten? Sage ich ›Ja‹, kurz und knapp, obwohl das ja gar nicht stimmt, stimmen kann, niemand hat nur ein Problem, es sind immer Kombinationen, scheußlich schwierig zu entwirren, noch schwieriger zu erklären, doch, nur mal angenommen, ich sage ›Ja‹. Was ist das Resultat? Die Hölle bricht los. Tausend neue Fragen folgen auf dem Fuße, alle auf einmal. ›Was für ein Problem? Ist Ihnen schlecht? Haben Sie sich verlaufen? Hat man Sie beraubt? Stehen Sie unter Schock? Sollen wir die Polizei rufen? Einen Krankenwagen? Die Feuerwehr?‹ Immer schnell, schnell jemanden rufen. Jemand in Uniform wird sich des Problems schon annehmen. Es zumindest wegkarren. Nein, danke.
Antworte ich mit ›Nein‹, wird es nicht besser. ›Was, Sie haben kein Problem? Warum stehen Sie dann so verdutzt in der Gegend rum? Wieso halten Sie ihr offenes Portemonnaie in der Hand? Sind Sie sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen? Sind Sie sicher? SICHER? SICHER?‹
Nein, bin ich mir nicht. So gut wie nie. Und selbst wenn. Selbst wenn ich auch nur halb so schnell hätte antworten können, wie die Fragen der vier Jugendlichen, die mich aus dem Nichts heraus plötzlich umringt hielten, auf mich einprasselten, selbst dann glaube ich nicht, dass ich mit der Wahrheit herausgerückt wäre. Nämlich damit, dass ich dort stand, weil ich mir nicht sicher war. Langsam waren meine Augen die aufgeklebten weißen Buchstaben entlanggewandert. Sollte ich mein Geld für die Non-Stopp-Videokabine ausgeben oder für eines der nicht näher beschriebenen Magazine? Für beides, fürchtete ich, würde es nicht langen. Und für eines von beiden konnte ich mich, wieder mal, nicht entscheiden.
Draußen war es schon lange hell, doch bei mir begann die Dämmerung erst so langsam einzusetzen. Das musste mindestens eine Gehwegplatte gewesen sein, die man mir gestern Nacht über den Schädel gezogen hatte. Mindestens. Mühsam hebelte ich ein Lid so weit hoch, dass Licht in eine meiner Pupillen dringen konnte. Uuh, es drang mit Macht. Ich ließ das Lid wieder sacken.
Vorsichtig drehte ich den Kopf zur Seite, beschattete die Augen mit der Hand und wagte noch einen Versuch. Trotz der Schlieren auf meinen Linsen war es klar, dass ich nicht daheim war. Sondern irgendwo anders. Mit der freien Hand tastete ich um mich. Da war niemand sonst. Ich war allein. Allein in einem fremden Bett, platt auf dem Kreuz, mit der Sorte von Kopfschmerz, die einen über Migräne lachen lässt. Etwas spannte in meinem Rücken, und etwas anderes schnürte mir den dicken Zeh ab. Den rechten. Was zum T- …? Das Vorhaben, mich einfach aufzusetzen und nachzusehen, brach ich mit einem Aufschrei wieder ab. Es wäre eh zwecklos gewesen – ich kam nicht hoch, und ein infernalisches Brennen meinen Rücken hinunter ließ mich einen erneuten Vorstoß in dieser Richtung auf unbestimmte Zeit vertagen.
Wer jemals mit einem viehischen Klopfen in der Birne in völlig unbekannter Umgebung erwacht ist, nur um festzustellen, dass er mit seiner sich wie gehäutet anfühlenden Kehrseite am Laken festklebt, wird wissen, was mich die nächste Viertelstunde beschäftigte. In meinem Beruf nennt man so was ›den Versuch einer Rekonstruktion vorangegangener Ereignisse‹.
Was um alles in der Welt war denn bloß wieder los gewesen? Das Erste, was mir in den Sinn kam, war ›Gin‹. Ab da brach es dann über mich herein. Gin. O Gott. Gin. Ausgerechnet. Lauwarm und zwanglos, direkt aus der Pulle. Mich schauderte.
Eigentlich, erinnerte ich mich schwach, eigentlich hatte ich nur auf ein Bier bei Kottge hereinschauen wollen, war dann aber irgendwie in ein längeres Gespräch verwickelt worden. Auf dem Nachhauseweg hatte ich, wie es aussah, erst in den ›Rathsbuden‹ und danach, obwohl es nicht unbedingt genau am Weg lag, auch noch im ›Käse-Eck‹ einen kleinen Stopp eingelegt. Von da zur ›Endstation‹ war es ein logischer Schritt gewesen, schließlich wohne ich direkt darüber, doch muss es mich unterwegs noch ins ›Nachtcafé‹ gezogen haben, ich weiß gar nicht recht, warum.
Rausgekommen bin ich auf alle Fälle spät, sehr spät, und am Arm dieser Rothaarigen.
Sie waren allesamt kleiner als ich, trugen Baseballkappen und waren sehr flink auf den Füßen. Ihre Fragen waren gehässig, ihre Bemerkungen waren abfällig, ihr ganzes Auftreten bedrohlich. Sie machten, dass ich mich wie ein Bär in einem Bienenschwarm zu fühlen begann. Sie machten mir Angst.
Drängend und schubsend tanzten sie um mich herum und nannten mich einen Wichser. Einen schmierigen Wichser. Immer wieder ›Wichser‹. Dabei schoben sie mich vor sich her, weg von dem Laden, weg von der Eppinghofer Straße, weg von den Leuten. Ich sah mich um, niemand sah zurück. Wir kamen zu einem Spielplatz. Unbeleuchtet und verlassen im kalten Nieselregen.
Sie gingen meine Taschen durch. Fanden mein Notizbuch mit wichtigen Telefonnummern. Nummern, die ich anrufen konnte, sollte ich mich verlaufen. Oder sollte mir sonst was zustoßen. Es flog in den Dreck. Dann mein Portemonnaie. Das Geld war ihnen zu wenig. Mehr hatte ich aber nicht. Von Minute zu Minute wütender werdend, zerrten sie an meinen Sachen, rissen die Taschen heraus. Schließlich sagte ich, was ich immer sage, wenn mich etwas stört oder wenn ich mich fürchte, so wie da, auf diesem düsteren Spielplatz. Es ist ein dummer Satz, ich weiß das, und doch kommt er in unangenehmen Situationen immer wieder aus mir heraus.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!