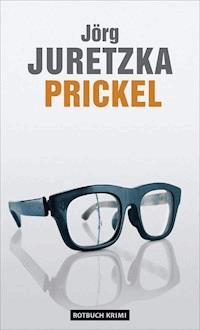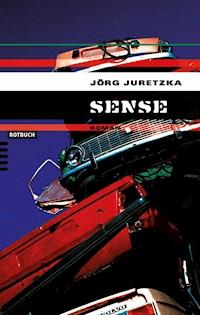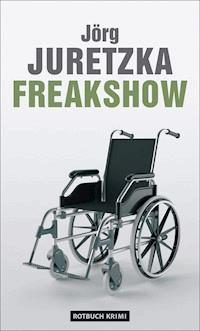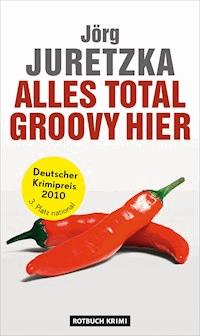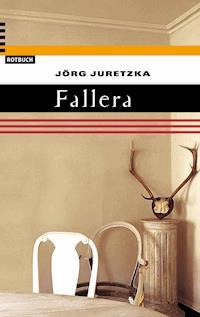Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotbuch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Kristof-Kryszinski-Roman
- Sprache: Deutsch
»Eins vorweg«, sagte ich und sah von einem zum anderen. »Keiner von euch wird jemanden umbringen müssen. Überlasst das mir.« – Offiziell für tot erklärt, lebt Kristof Kryszinski auf ›TauchStation‹. Er hat eine neue Identität, eine neue Bleibe im lauschigen Bottrop und einen neuen Job als ›Operativer Mitarbeiter‹ bei Europol. Er kann sich also einigermaßen sicher fühlen vor seinen Todfeinden von den Marseiller ›Chiens du Nord‹. Doch gleich bei seinem ersten Auslandseinsatz geht etwas schief, er wird erkannt und das bringt nicht nur ihn, sondern alle um ihn herum in akute Gefahr. Kryszinski muss sich diesem Problem stellen, endgültig. Doch: er allein gegen einen ganzen Mafia-Clan? Unmöglich. Notgedrungen wendet er sich an seine alte Gang, die ›Stormfuckers‹. Gemeinsam geht es auf eine Reise, deren Ausgang ungewisser nicht sein könnte … TauchStation ist Jörg Juretzkas 13. Kriminalroman mit Kristof Kryszinski und gleichzeitig der abschließende Teil der mit TaxiBar begonnenen und mit TrailerPark fortgesetzten Trilogie. Ein packendes Roadmovie voll trockenen Humors, gestochen scharfer Bilder und ebensolcher Dialoge, kurz: ein typischer Juretzka.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg
Juretzka
TauchStation
Kriminalroman
Rotbuch Verlag
Von Jörg Juretzka liegt bei Rotbuch außerdem vor:
TrailerPark (2015)
eISBN978-3-86789-843-0
1. Auflage
© 2017 by BEBUG mbH / Rotbuch Verlag, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Umschlagabbildung: Claudio Divizia/Fotolia
Rotbuch Verlag
Alexanderstraße 1
10178 Berlin
Tel. 01805/309999
(0,14 Euro/Min., Mobil max. 0,42 Euro/Min.)
www.rotbuch.de
FÜRCORAUNDVERENA
Spezieller Dank an Snoop Dogg für ›Round Here‹
Sämtliche Figuren dieses Romans und auch die meisten Orte sind wie immer frei erfunden.
Teil 1
Der Landcruiser war weiß, noch kein Jahr alt, aber schon gründlich zersemmelt, und er stank. Wir hatten alle Fenster runter und die Klimaanlage samt Gebläse auf Anschlag, und trotzdem stank die Karre, dass es einem hochkam. Es war dieser unverwechselbare, zutiefst dumpfe Geruch, der die Nase trifft wie ein Faustschlag, ein zäher, stehender Mief, der wirkt, als ob ihn nicht mal ein Orkan weggeblasen bekäme. Das Auto stank nach Kadaver, es stank nach Leiche, nach Tod.
»Ist es das, was ihr ›den frischen Wind der Scharia‹ nennt?«, fragte ich den Fahrer. Hinter mir hörte ich Mombassa scharf einatmen.
»Lass gut sein, Stockholm«, knurrte er halblaut und mit einem kaum merklichen Zittern in der Stimme. Wir kämpften beide mit Panik, gepackt von der Beklemmung völligen Ausgeliefertseins in einer – um es vorsichtig auszudrücken – verstörenden Umgebung, nur äußerte sich das halt bei jedem von uns anders. Der massige Kongolese wurde stoisch, fast schon katatonisch, ich sarkastisch. Vermutlich ein Reflex der Verleugnung, idiotisch in einer Situation wie der unseren, und trotzdem nicht zu ändern, da, tja, irgendwie zwanghaft.
Der Fahrer, ein schwarz vermummter, sonnenbebrillter Typ um die zwanzig, der uns am Busbahnhof direkt an der Grenze in einem Kauderwelsch aus Englisch, Deutsch und – ausgerechnet – Holländisch in Empfang genommen hatte, sagte nichts. Stattdessen starrte er mit gerunzelten Brauen nach vorn, wo gerade ein schreiender Mann aus einem Schuppen auf die Straße gestürmt kam, uns einen blutig bandagierten Armstumpf entgegenhielt und seine verbliebene Faust schüttelte. Er schien entschlossen, den Wagen zum Stehen zu bringen, seine Miene eine wilde Mischung aus Agonie, Rage und Entsetzen, und es fehlte nicht viel, und wir hätten ihn über den Haufen gefahren. Im letzten Augenblick sprang er schließlich beiseite, spuckte und trat gegen die Wagenflanke, während wir vorbeirollten.
»Wenn er goes on like this, we hakken hem de andere kant ook uit«, meinte der Fahrer. Und er meinte es ernst.
»Der frische Wind der Scharia, ich sag’s doch«, sagte ich, und Mombassa boxte in meine Rückenlehne.
*
»Um es kurz zu machen«, sagte der Arzt und sah von seinen Unterlagen auf, »Sie werden’s überleben.«
Ein Grunzen antwortete ihm. Spuren von Freude oder auch nur Erleichterung waren, selbst bei genauestem Hinhören, nicht darin auszumachen.
»Sie haben eine mittelschwere Gehirnerschütterung, ein ausgeprägtes Schleudertrauma im Bereich der Halswirbelsäule und zahlreiche Prellungen an den Extremitäten. Eine Woche Bettruhe, zehn Tage Halskrause, und Sie sollten wieder diensttauglich sein.«
Der Patient sah zur Seite und grunzte erneut. Er wirkte abwesend und machte einen unzufriedenen Eindruck. Ob mit der Diagnose oder etwas anderem war dabei nicht zu sagen. Vielleicht war das aber einfach nur eine Ausprägung von Unfallschock.
»Doch erlauben Sie mir eine Frage«, fuhr der Mediziner fort. »Wie schafft man es, sich an ein und demselben Tag gleich zweimal mit dem Auto zu überschlagen? Ich persönlich fahre seit über vierzig Jahren und ich habe noch nicht einen einzigen Wagen aufs Dach gelegt.«
Der Patient, ein kräftig gebauter, untersetzter Kriminalkommissar aus Mülheim an der Ruhr, schwang die Beine von der Behandlungsliege, blickte ausgesprochen finster drein und ließ sich Zeit mit der Antwort.
»Es ist ein Fluch«, grollte er schließlich. »Ich bin mit einem Fluch belegt, dessen erklärtes Ziel es ist, mir das Leben zur Hölle zu machen.«
»Sie meinen eine Verwünschung, wie im Voodoo-Kult?«
»Genau.« Der Patient nickte heftig, stöhnte auf und fasste sich mit der Hand ins Genick. Der Schmerzen zum Trotz wirkte er lebhafter, jetzt, fokussierter.
Der Arzt notierte etwas. »Können Sie das Wesen dieses Fluchs ein bisschen näher beschreiben?«
»Oh, ja. Und ob ich das kann. Größe, Alter, Gewicht, Vorstrafen. Ich kann Ihnen sogar seinen Namen sagen.«
»Der Fluch hat Vorstrafen und einen eigenen Namen?« Der Arzt fragte sich im Stillen, ob er nicht eine stationäre Aufnahme anordnen sollte. Für ein paar Tage. Zur Beobachtung.
»Ja, hat er.« Der Patient glitt von der Liege und griff ächzend nach seiner Hose. »Wollen Sie ihn hören?«
»Ja, das würde mich schon interessieren.«
»Er heißt Kryszinski. Kristof Kryszinski.«
*
Je weiter wir ins Land hineinfuhren, umso öder wurde die Gegend. Der Fahrer schien nicht gesprächig, mir fielen keine weiteren Sarkasmen ein und Mombassa und Ibrahim, unser, tja, Bewacher, ein etwas älterer wollbärtiger Finsterling, der seine Kalashnikov nicht eine Sekunde aus der Hand legte, schwiegen sowieso beharrlich.
Von hohen Mauern umgebene Gehöfte säumten in unregelmäßigen Abständen die Straße, dazwischen einzelne Dörfer. ›Oasen‹ schien nicht recht passend, dazu war die Landschaft nicht Wüste genug, zumindest nicht, wie man sie sich vorstellt. Keine Dünen, keine Palmen, nichts, nur konturloses, staubiges Brachland, unfassbar platt und eintönig und übersät mit Müll und, wie die Straße, Bombenkratern und immer wieder dem verkohlten und zerfetzten Schrott des Krieges. Tierkadaver verrotteten vor sich hin, nach Kräften unterstützt von Geiern, Krähen und streunenden Hunden.
Eine Zeitlang rollten wir durch große Felder mit brusthohen, dürren, unansehnlichen Pflanzen, gekrönt von widerspenstig aussehenden Knospen. Ich brauchte kein botanisches Lehrbuch mit dem Titel ›Nutzpflanzen des Nahen und Vorderen Orients‹, um zu wissen, dass es sich um Mohn handelte. Scharen von Frauen, wie alle, die wir seit der Überquerung der Grenze gesehen hatten, in Burkas, schnitten und schabten an den Knospen herum, auf Schritt und Tritt bewacht von Bärtigen mit Sturmgewehren.
Sobald wir in eine der Ortschaften kamen, drehten sich sämtliche Passanten von uns weg, drückten sich in den Schatten von Seitengassen oder Hauseingängen, verschwanden ohne auch nur einen Blick zurück.
»Alle zondaars hier leven in Angst«, meinte der Fahrer und klang höchst zufrieden dabei.
»Zondaars?«, fragte ich und spürte wieder Mombassas Faust in meinem Kreuz. Wenn es nach ihm ginge, hätte ich die Schnauze halten müssen, doch nach ihm ging’s nicht.
»Sinners«, antwortete der Fahrer. »Wie sagt ihr?«
»Sünder.«
»Ja. Alle Sünder ond alle Kuffar.«
»Richtig so«, fand ich. Mein Deckname war nicht umsonst ›Stockholm‹. Aus einem sonderbaren Grund übernehme ich gerne die Ansichten der Leute, in deren Hand ich mich befinde. Es erleichtert, ja, es erheitert mich, einer perversen, mir selbst fremden Logik folgend. Sollte ich hier festgehalten werden, verschleppt, eingekerkert, sah ich mich schon fröhlich meine Vorhaut mit der Nagelschere abschnippeln und anschließend eine Menge Koransuren auswendig lernen. »Der Tod«, sagte ich mit gravitätischem Ernst, »ist noch zu gut für diese Hunde.«
Zum ersten Mal drehte der Fahrer den Kopf zur Seite und sah mich an. Ich würde jetzt gerne behaupten, dass der Wahnsinn des Fanatismus in seinen Augen loderte wie die Flammen im Tor zur Hölle, oder sonst etwas Bildhaftes, dem Klischee Entsprechendes, doch sein Blick war ruhig, rätselnd, möglicherweise milde amüsiert. Ein bisschen wie der eines Lehrers, der sich einen Moment Zeit nimmt, abzuwägen, ob er einem vorlauten Schüler eine kleine Frechheit durchgehen lassen, oder ob er ihn an den Haaren packen, zur Schultoilette schleifen und in der nächstbesten Kloschüssel ertränken soll.
Momentan ernüchtert sah ich wieder aus dem Fenster.
*
»Die beiden Fahrzeuge werden ›Interceptor‹ beziehungsweise ›Getaway‹ genannt.« Stabsfeldwebel und Ausbilder ›Fahrtechnik‹ Neumeyer deutete auf ein Standbild auf der Videoleinwand. Eine Hubschrauberperspektive zeigte zwei dunkle Pkws von oben, die Dächer groß mit ›IC‹ beziehungsweise ›GA‹ beschriftet. »Die Aufgabenstellung bei den Trainingseinheiten ist diametral: Einmal soll Getaway dem Interceptor entkommen, etwa, um einem Anschlag zu entgehen, einmal soll Getaway vom Interceptor zum Stehen gebracht werden, um, zum Beispiel, eine Geiselnahme zu beenden. Nun denn. Ihre Abteilung hat uns zwei Trainees geschickt. Der eine ein Kommissar, der andere ein – wie ist noch mal Ihre interne Bezeichnung?«
»O. M.«, antwortete Hauptkommissar Menden und wand sich unbehaglich auf seinem Stuhl. Bundeswehr-basic. Wie fast alles beim Militär mit dem erklärten Willen konstruiert, hohe Kosten und geringe Funktionalität miteinander in Einklang zu bringen. »›Operativer Mitarbeiter‹.«
»Ah ja. Ein O. M. mit dem Decknamen ›Stockholm‹.« Neumeyer verschränkte die Arme vor der Brust und blickte eine Weile aus dem Fenster seines Büros. Seine Miene war auf eine gelassene Art säuerlich. »Wir haben die beiden Trainees also – nach ausführlicher Instruktion, nach zwei Tagen fahrphysikalischer Theorie, nach dem Studium von Beispielen anhand von Videoaufzeichnungen, nach Fahrübungen zur Eingewöhnung, letztendlich dann zum Manöver in die Autos gesetzt. Zuerst einmal Ihren Kommissar in den Getaway, Ihren O. M. in den Interceptor.« Neumeyer, im Kampfanzug seiner Einheit, der GSG9, pausierte erneut.
Obwohl von Vorahnungen geplagt, bemühte Menden sich um ein interessiertes Gesicht.
»Wie für Ihre Aufgabenstellung wichtig«, fuhr Neumeyer fort, und sein Tonfall verhärtete sich dabei, »ging es in der Übungseinheit darum, mit dem Getaway einem Angriff des Interceptors zu entkommen.« Neumeyer griff zu einer Fernbedienung und wandte sich der Videoleinwand zu. »Hier ist das Ergebnis, aufgenommen sowohl aus dem begleitenden Kommandofahrzeug als auch von Kameras entlang der Strecke und aus einem Hubschrauber.«
»Ich will Ihnen ja nicht den Spaß verderben«, sagte der Hauptkommissar, »aber mir schwant, was jetzt kommt.«
Die Aufnahmen wirkten äußerst professionell, auch vom Schnitt her, erstaunlich, wenn man bedachte, dass sie erst wenige Stunden alt waren. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um zwei schwere, schwarze BMW-Limousinen, nur zu unterscheiden durch die großen weißen Buchstaben auf ihren Dächern und – wie man jetzt sah – auch ihren Flanken.
Die Fahrstrecke war augenscheinlich Teil eines militärischen Flugfeldes, zweispurig angelegt mit aufgeklebten Mittelstreifen und Behelfs-Leitplanken auf beiden Seiten.
»Zu diesem Zeitpunkt sieht der Fahrer des Getaway, also Ihr Kollege, den Interceptor im Rückspiegel. Der Interceptor nähert sich mit hohem Fahrtüberschuss. Um ihn am Überholen zu hindern, zieht der Getaway nach links, direkt in den Weg des verfolgenden Fahrzeugs. Dessen Fahrer – Ihr O. M. – leitet allerdings nicht die vorgesehene Vollbremsung ein, sondern steuert, wie man hier sieht, ruckartig nach rechts, dann, auf Höhe des Getaway, reißt er das Lenkrad scharf nach links, betätigt – das haben uns die Telemetriedaten gezeigt – kurz die Handbremse, so dass das Heck des Interceptors ausbricht, und gibt augenblicklich wieder Vollgas. Als Resultat bohrt sich seine Front in den vorderen rechten Radkasten des Getaway, was einen scharfen Lenkeinschlag nach links bewirkt und gleichzeitig den Reifen von der Felge schneidet.«
Ein Feuerschweif schoss aus dem Radkasten, als sich die nackte Felge in den Asphalt fraß, während der Interceptor geschmeidig auf Abstand ging.
»Die daraus resultierende, abrupte punktuelle Verzögerung«, fuhr Neumeyer im trockenem Tonfall des Technikers fort, »hebelte das gesamte Fahrzeug aus, wodurch es zu einem dreifachen Überschlag um die Längsachse kam.«
Blechteile flogen, Glaspartikel, Staub und Funken stoben, bis das rundgewalzte Wrack schließlich wieder auf seinen Rädern zum Stehen kam. Fast augenblicklich war es umstellt von Rettungsfahrzeugen.
Neumeyer schaltete auf Standbild. »Das verkehrte die eigentliche Aufgabenstellung – Vermeidung eines Abfangens des Getaways – komplett ins Gegenteil. Beide Fahrer blieben mehr oder weniger unverletzt und wurden anschließend zum Rapport beordert. Ein Protokoll des Gesprächs finden Sie in meinem Bericht unter Anhang A/II. Nun zum zweiten Film …«
Menden wollte dankend abwinken, doch Neumeyer hatte sich schon wieder der Leinwand zugewandt und sprach weiter.
»Umgekehrte Vorzeichen, diesmal. Obwohl nach dem dreifachen Salto seitwärts leicht angeschlagen, brannte Ihr Kollege regelrecht darauf, das Steuer des Interceptors zu übernehmen. Seine Aufgabe war jetzt, den Getaway zum Stehen zu bringen und am Weiterfahren zu hindern.« Neumeyer drückte auf die Fernbedienung und der Film lief.
Man spürte förmlich den Ehrgeiz, mit dem der IC auf den anderen Wagen – diesmal ein silbermetallicfarbenes Fahrzeug, schwarz mit GA beschriftet – aufholte.
»Eigentlich sollte Ihr O. M. zu diesem Zeitpunkt versuchen, dem Interceptor den Weg abzuschneiden«, erklärte Neumeyer. »Also defensiv agieren.«
Stattdessen sah man, wie der GA kurz und heftig verzögerte, dann, als der IC ebenfalls bremste, nach links zog und das durch die Bremseinwirkung hochgereckte Heck des IC zur Seite drückte, was den Wagen komplett querschlagen ließ. Sofort rammte der GA die Flanke breitseits und brachte den Interceptor dadurch dazu, sich mehrfach über das Dach abzurollen. Stiebende Funken, fliegendes Glas, flackerndes Blaulicht, alles wie gehabt.
»Wie gesagt: eigentlich«, meinte Neumeyer trocken. »Zwei Komplettabschreibungen an einem Vormittag. Haben wir auch nicht alle Tage, so was.«
»Wo ist Hufschmidt jetzt?«
»Den haben wir sofort danach ins Bundeswehrkrankenhaus Koblenz geflogen. Wie der behandelnde Arzt sagt, sind keine wirklich ernsthaften Verletzungen festzustellen und keine bleibenden Schäden zu befürchten.«
»Wie lange werden sie ihn dabehalten?«
»Meines Wissens nach will Ihr Kollege heute noch entlassen werden.«
Menden stieß einen Seufzer aus.
»Nun zu dem anderen Trainee.« Neumeyer nahm ein Datenblatt auf, überflog es flüchtig. »›Stockholm‹, richtig. Für die Kategorien Fahrzeugbeherrschung, Reaktionsgeschwindigkeit und Entschlossenheit des Handelns muss ich Ihrem O. M. die volle Punktzahl geben. Doch was Disziplin oder gar Subordination angeht, frage ich mich ernsthaft, ob Sie sich mit der Beauftragung dieses Mannes einen Gefallen tun.«
»Ja, das frage ich mich auch, und, glauben Sie mir, nicht zum ersten Mal. Doch das entscheiden höhere Stellen.«
»Was ist – abgesehen von den genannten Qualitäten – so Besonderes an ihm?«
»Es gibt ihn nicht.«
»Sie meinen, er existiert nicht?«
»Richtig.«
Neumeyer dachte einen Moment lang nach. »Das hört sich für mich so an«, mutmaßte er dann vorsichtig, »als ob Sie einen verdammt heiklen Job vor der Brust hätten.«
»›Verdammt‹ trifft es genau«, sagte Menden.
*
Nach fast drei Stunden Fahrt unter einem tiefhängenden, drückend grauen Himmel passierten wir ein von Kugeln durchsiebtes Ortsschild und rollten mit reduziertem Tempo die Hauptstraße des Wüstenkaffs hinunter. Etwas sagte mir, dass wir uns unserem Ziel näherten. Zeit wurde es. Je weiter wir fuhren, desto länger zog sich der Weg zurück in die Zivilisation.
Die Bebauung des Ortes entsprach perfekt der sie umgebenden Landschaft in ihrer fast schon bedingungslosen Trostlosigkeit. Was auffiel, und nicht wirklich zur Aufhellung des Ambientes beitrug, war, dass die Häuser in diesem Landstrich keine Fenster hatten. Zumindest nicht zur Straße hin. Nur kahle Wände, mal rohes, nachlässig zusammengeklatschtes Mauerwerk, mal kratziger Putz, mal mit den Fingern gefurchter Lehm. Die Grundrisse der Bauten schienen fast alle u-förmig zu sein, der Blick in die Innenhöfe verwehrt von weit über mannshohen Toren, aus Holz die alten, aus Wellblech die jüngeren, aus Teilen grüner, militärischer Überseecontainer die neuesten.
Der Fahrer verlangsamte weiter, steuerte den Wagen in einen weiten Rechtsbogen und stoppte vor einem schwarzgestrichenen Stahltor, ohne Griff oder Klinke außen, die Oberseite gekrönt von Nato-Draht.
Ich wollte aussteigen, nur raus aus der stinkenden Karre, doch Ibrahim auf dem Rücksitz sprach sein erstes Wort an diesem Tag: »No.«
Irgendwo hinter dem Haus, weiter weg, wenn auch nicht wirklich weit genug weg, explodierte etwas mit einem bis ins Mark gehenden Knall, und nur Sekunden später fauchte ein Kampfjet im Tiefflug über uns hinweg.
»Wellkomm in Dschihad«, sagte der Fahrer.
*
»Wo warst du gestern?«, fragte Ela, wuchtete ihre Schultasche in den Fußraum des Transporters, zog sich hoch in den Kindersitz und schloss die Tür. »Wir wollten dich besuchen.«
»Ich war mit meinem, äh, Freund Hufschmidt in der Fahrschule«, antwortete ich und schnackte ihren Sicherheitsgurt zu.
»Fahrschule? Aber du kannst doch Auto fahren.«
»Ich schon«, bestätigte ich versonnen und startete den Motor.
Sie musterte mich mit gerunzelten Brauen. »Warum hast du dir den Bart abrasiert?«
»Weil mittlerweile jeder Idiot mit Vollbart herumläuft. Da frage ich mich dann: Will ich dazugehören?«
»Wüll üch zu den ganzen Üdüoten gehören?«, äffte sie mich nach und grinste. »Wohin fahren wir?«, wollte sie dann wissen, Beine ungeduldig zappelnd.
»Zu Yesus? Mittagessen?«
»Ja«, bekräftigte sie mit fester Stimme.
Seit der baumlange Eritreer die Küche übernommen hatte, lief die TaxiBar immer besser. Er bereitete in erster Linie Tapas und Snacks zu, Pommes und Burger, lauter unkomplizierte kleine Happen für zwischendurch, doch wenn Ela zum Essen kam, erwachte in ihm der Sternekoch.
Einen Moment lang fuhren wir schweigend, aber nur einen Moment lang.
»Wenn er dein Freund ist, warum nennst du ihn dann ›Hufschmidt‹?«
»Na, weil er so heißt«, antwortete ich unschuldig. Ein Gespräch mit Ela zu führen bedeutet regelmäßig, sich einem Kugelhagel von Fragezeichen stellen zu müssen.
»Hat er etwa keinen Vornamen?«
»Doch, doch. Natürlich.«
Ela wandte mir pointiert langsam den Kopf zu für einen pointiert bohrenden Blick. Mit ausweichenden Antworten kommt man bei ihr nicht weit. Sie und Menden, denke ich manchmal, sind aus ein und demselben Holz. Angefangen bei den Köpfen.
»Aber du weißt ihn nicht«, stellte sie nüchtern fest.
»Unsinn«, widersprach ich.
»Wie heißt er denn? Los, sag’s.«
»Er heißt, äh, Theophilus.« Wir näherten uns der Innenstadt und ich zog mir die Basecap tiefer in die Stirn und setzte die Spiegelbrille auf. Und fasste mich in Geduld. Zwangsweise.
»Theophilus Hufschmidt?«
»Ja, klar. Was gibt’s da zu lachen?«
»Du spinnst«, meinte sie gutmütig.
Rote Ampel für rote Ampel für rote Ampel krochen wir voran, wieder und wieder überholt von einer rüstigen Achtzigjährigen am Steuer ihres Rollators. Autofahrer, kommst du nach Mülheim, vergiss das Diazepam nicht.
»Du hast also einen Freund, von dem du nur den Nachnamen kennst.«
»Eigentlich ist er nicht wirklich mein Freund. Mehr ein Lieblingsfeind.«
Sie überging das. »Dein anderer Freund heißt Pierfrancesco Scuzzi und du bist schon genervt, wenn du ihn nur siehst.«
»Nein, nein, das ist nicht richtig.« Ich blickte ihr gerade in die großen Smaragdgrünen. »Erst, sobald er den Mund aufmacht.«
Sie überging auch das. »Hast du sonst noch Freunde?«
»Sicher. Jede Menge. Eine ganze Gang«, sagte ich und dachte an die Stormfuckers, und wie lange ich sie nicht mehr gesehen hatte.
»Sag mal ein paar.«
»Charly, Hoho, Pit Bull …« Lange genug, auf alle Fälle, um bei den meisten nur noch schwammige Vorstellungen davon zu haben, was die inzwischen so trieben.
»Du hast Freunde, die Hoho heißen? Und Pit Bull?«
»Charly, nicht zu vergessen.«
»Das hast du dir doch wieder ausgedacht.«
»Nein, es stimmt.«
»Ho-ho?« Ela lachte, dann wurde sie wieder ernst. »Und warum triffst du dich nie mit denen?«
»Wir haben uns irgendwie aus den Augen verloren.«
»Du bist immer nur allein, oder genervt. Warum besorgst du dir nicht endlich wieder einen Hund?«
»Tja. So, wie es momentan aussieht, kriege ich einen Job, bei dem ich viel unterwegs bin und wohl keinen Hund mitnehmen kann.«
»Dann bringst du ihn so lange zu uns.«
»Ich denke drüber nach.«
»Das sagst du immer und tust es dann doch nicht.«
»Unsinn.«
»Das sagst du auch immer, wenn’s eigentlich stimmt.«
»Unsinn.«
»Wann holst du Punky?«
»Punky?«
»Mein Pfeeerd! Tu nicht so dumm! Scuzzi hat ihm schon einen Stall gebaut.«
»Scuzzi hat was?«
»Einen Stall gebaut. Für Punky. Hinterm Haus.«
Bian-Tao hatte mit dem von mir geklauten und von ihr Schein für Schein durch die Kasse der TaxiBar geschleusten Drogengeld ein unauffälliges Zweifamilienhaus in Speldorf gekauft, einen Altbau mit drei Etagen, einer Wohnung für sie und Ela, einer für Scuzzi und einer für, tja, mich. Von der Straße führte eine Toreinfahrt in den dahinter gelegenen Garten, der an den Stadtwald grenzte. Punky von Portugal nach Mülheim zu holen war von Anfang an geplant gewesen, nur bei der Umsetzung hakte es nun schon eine ganze Weile.
»Ich hätte erhebliche Bedenken«, äußerte ich vorsichtig, »irgendetwas, geschweige denn ein lebendes Wesen, in einer Konstruktion unterzubringen, die Pierfrancesco Scuzzi zusammengefrickelt hat.«
»Yesus hat dabei geholfen.«
»Ah, das ist etwas anderes.« Mit dem jetzigen Koch hatte ich monatelang in Portugal auf einer Werft zusammengearbeitet. Monteyesus, so sein vollständiger Vorname, weiß um die Notwendigkeit der Aussteifung.
»Also, wann holst du Punky?«
»Bald. Willst du vielleicht mit? Jerusalé mal wieder besuchen?« Mit ›Jerusalé‹ meinte ich, dachte ich, aber sagte nicht: ›Das Grab deiner Mutter‹. Wir hatten Yara auf dem kleinen Friedhof oben auf der Klippe beerdigt, von wo aus man die Brandung hören und die Bucht und den Ozean überblicken kann. Ein Surfergrab, halt.
»Ich kann doch jetzt nicht wegfahren! Erst in den Ferien, ich bin doch jetzt ein Schulkind!«
»Ah, stimmt ja.« Ich ließ den Transporter die Rampe zur Tiefgarage hinunterrollen, öffnete das Rollgitter mittels Fernbedienung, fuhr in die dustere, kaum genutzte Katakombe mit ihren schauderhaften Erinnerungen und stellte den Wagen in eine Parkbucht nahe beim Treppenaufgang. Auf der Straße zu parken und die TaxiBar von vorn zu betreten verbot sich von selbst. Einer der Nachteile, tot zu sein ist der, dass man sich nirgendwo mehr blicken lassen kann.
»Vergiss deine Tasche nicht, Schulkind.« Wir stiegen aus, ich nahm ihr den Eastpak ab und schwang ihn über meine Schulter. Zusammen erklommen wir die Stufen hoch zum Erdgeschoss.
Egal ob ich Ela durch die Gegend fuhr oder sie mich in meinem neuen Zuhause besuchen kam, all diese Treffen blieben konspirativ. Es hatte seit Monaten niemand Fremdes mehr nach mir gefragt, schon gar nicht jemand Fremdsprachiges, doch ich traute dem Frieden nicht. Sobald dein Name einmal auf einer Todesliste steht, bist und bleibst du im Alarmzustand. Sie hatten mich schon mal gefunden, und so etwas vergisst man nicht.
»Wann ziehst du endlich zu uns? Dann können Scuzzi und ich dir abwechselnd auf die Nerven gehen.«
»Eine wirklich verlockende Vorstellung, Ela.«
»Du hängst immer alleine herum, und dir ist immer langweilig. Hol dir einen Hund. Los, hol dir einen Hund!«
»Erst mal hol ich dir dein Pferd.«
»Wann?«
»Nächste Tage.«
Ich klopfte an die Küchentür, den Hintereingang der TaxiBar, Yesus öffnete und strahlte Ela an. Tauche irgendwo mit der rastagelockten kleinen Krabbe auf und du erfährst aus erster Hand, wie es sich anfühlen muss, unsichtbar zu sein.
»Was gibt’s heute?«, wollte sie wissen und hopste auf den Hocker neben dem Herd.
»Aah-ah-ah«, gurrte Yesus und gestikulierte geheimnistuerisch. Ich reichte ihm die Schultasche, winkte Ela, schloss die Tür und machte mich auf den Heimweg. Ins nahe, idyllische Bottrop.
Vorerst. Ich war vorerst nach Bottrop gezogen, weil mich dort niemand kannte, und nur solange bis …? Ja, genau. Bis wann ließ sich nicht definieren, an keinem Datum festmachen. Deshalb war zurzeit kein Ende von ›vorerst‹ in Sicht.
Das Viertel in der Nähe des Kanals ist symptomatisch für den momentan rasant ablaufenden zweiten Strukturwandel in Teilen des Reviers. Alles in meiner Nachbarschaft ist in letzter Zeit irgendwie ehemalig geworden: Nebenan eine aufgegebene Tankstelle, nun im Besitz eines libanesischen Luxusmarken-Gebrauchtwagenhändlers, ständiger Anlaufpunkt ganzer Wagenladungen von dunklen Gestalten mit noch dunkleren Sonnenbrillen. Ab und zu verkauft er sogar mal ein Auto, wie es aussieht. Aber vielleicht parkt er sie auch nur geschickt um.
Zwei Ecken weiter beginnt eine Zechensiedlung, leer gezogen, um einer Umgehungsstraße zu weichen, für die dann kein Geld mehr da war, nun zur Begeisterung des ganzen Viertels eine von Polizei, Müllabfuhr, Ordnungs-, Jugend-, und Gesundheitsamt in gleichermaßen enger Taktung frequentierte Durchgangsstation für konfliktfreudige Romasippen in ständigem Kommen und Gehen, rund um die Uhr. Dann ist da noch die frühere Friedrich-Fröbel-Grundschule, jetzt Behelfsunterkunft für Flüchtlinge aus allen Krisengebieten der Welt, schräg gegenüber die einst buntbemalte Stadtteilbücherei, inzwischen eine schwarzgestrichene, hauptsächlich von Salafisten genutzte Moschee, bis weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt für ihre mitreißenden Predigten.
So ziemlich das einzige unveränderte Relikt vergangener Jahre, gleichzeitig letzte urdeutsche Bastion unter leicht fransig wehendem Schwarzrotgold, eingezäunt und stacheldrahtbewehrt, ist der Kleingartenverein Concordia 1914 Bottrop samt angeschlossener ›Gastwirtschaft mit durchgehend kalter und warmer Küche‹. Hmmm.
Tja, und dann hätten wir da noch die ohne Nachfolger gebliebene ›Autowerkstatt Wilfried Schultheiss, Meisterbetrieb, Reparatur und Wartung sämtliche Marken‹. Mein neues Zuhause hinter Stahltor und von klassischen Glasscherben gekrönten Mauern. Tisch, Bett, Sofa, Herd, Spüle, Kühlschrank, Hebebühne, Werkbank, Stahlspind, 77er Toyota Carina, alles untergebracht in den blassgrün gekachelten vier Wänden der Werkstatt. Ein perfekter Ort für jeden, der eigentlich immer schon in trauter Zweisamkeit mit seinem Auto zusammenleben wollte. Seit ich hier eingezogen bin, ertappe ich mich des Öfteren dabei, dass ich mit dem Toyota spreche, und sehe mit, na ja, gemischten Gefühlen dem Tag entgegen, an dem er anfängt, mir zu antworten.
Ich hatte gerade eine Maschine Buntes angeworfen und nach einem langen, nachdenklichen Blick auf das einsame Senfglas im Kühlschrank begriffen, dass es wohl mal wieder Zeit wurde, einkaufen zu gehen, als es draußen am Hoftor klopfte und eine Stimme »Polizei, aufmachen« … tja, ›bellte‹ wäre das absolut falsche Verb, ›befahl‹ ebenfalls, selbst ›forderte‹ würde den Tonfall übertrieben darstellen. Die Stimme sagte einfach »Polizei, aufmachen«, als ob ihr das Öffnen des Tores dabei kein wirkliches Anliegen wäre. Der müde Nachsatz ›Oder auch nicht, mir doch egal‹ schwang genauso atonal wie unüberhörbar mit.
Ich schlurfte raus zum Tor, zog es ein Stückweit auf, und aus einer hohlwangigen, knitterigen Magenfaltenvisage heraus starrten mich zwei blassgraue Hagelkörner an, wie sie es schon immer getan haben, seit unserem ersten Treffen vor vielen, vielen Jahren: verdrießlich. Bis in die tiefsten Tiefen eines unauslotbar tiefen Schachts hinab verdrießlich.
»Hauptkommissar Menden!«, rief ich in billig gemimtem Überschwang und zog das Tor zur Gänze auf. »Was für eine Freude, Sie mal wieder hereinbitten zu dürfen«, log ich mit einer Geschmeidigkeit, die einen Aal vor Neid gebleicht hätte.
Menden verzog keine Miene, sondern ging wortlos an mir vorbei in die Werkstatt, wo er stand und schwieg, bis ich das Tor und auch die drahtverglaste Eingangstür hinter uns geschlossen hatte. Und dann stand und schwieg er noch ein bisschen, während er sich umsah wie jemand, der sich zum Kauf gedrängt fühlt, aber nicht will.
»Und, wie ist die Arbeit bei Europol? Endlich raus aus dem Mülheimer Kleinstadtmief, was?«
Er legte den Kopf schräg, bevor er antwortete. »Der Apparat ist größer, die Wege sind länger, die Kompetenzen undurchsichtiger. Doch die wahre Prüfung ist die Kooperation mit bestimmten … Mitarbeitern.«
Mühsam rang ich den Impuls nieder, ihm freundschaftlich auf die Schulter zu klopfen. »Glauben Sie mir, den Mitarbeitern fällt das auch nicht leicht«, meinte ich tröstend.
Menden nickte ein Weilchen vor sich hin. »Sie fahren morgen Ihren ersten Transport«, erinnerte er mich schließlich und betrachtete mit gerunzelten Brauen das Dach des Toyotas. Und dort vor allem das etwa Zehncentstück große Loch über der Beifahrerseite, Blechrand scharf nach unten gewölbt. »Eine Bewährungsprobe. Also verbocken Sie’s nicht. Ihr Verbleib im Programm hängt direkt von den Berichten ab, die ich über Sie verfasse.«
»Seien Sie unbesorgt«, sagte ich, was mir einen kurzen, ungläubigen Blick einbrachte. »Zur Not greife ich Ihnen bei der Formulierung ein bisschen unter die Arme.«
Menden nickte wieder in schmallippiger Resignation. »Warum ich hier bin«, rang er sich nach einer weiteren, schwangeren Pause ab: »Man hat mir aufgetragen, Ihnen im Anschluss einen zweiten, wesentlich heikleren Job anzubieten.« Er griff in die Innentasche seines Mantels und zog einen Kugelschreiber heraus, schob ihn durch das Loch im Autodach, beugte sich vor und folgte der Richtung des Stifts mit suchenden Augen. »Einen Job«, betonte er, »den anzunehmen ich Ihnen dringendst abraten muss.«
Ich spürte mein Interesse erwachen. »Gutbezahlt?«, fragte ich.
»Ein Himmelfahrtskommando«, antwortete Menden, öffnete die Beifahrertür und begann mit dem Stift im Sitz herumzuporkeln, »da ist die Bezahlung ja wohl irrelevant.«
»Ich bin dabei«, sagte ich, und sei es nur, um ihn zu nadeln.
»Sie hören nicht zu!« Menden richtete sich wieder auf, eine Gewehrkugel zwischen Daumen und Zeigefinger der Rechten, die er prüfend ins Licht hielt.
»Ich muss hier raus. Die Langeweile bringt mich um.«
»Die Langweile«, echote der Hauptkommissar und rollte die Kugel zwischen seinen Fingern hin und her.
»Bian-Tao möchte, dass ich sie heirate und mit ihr und Scuzzi zusammen Ela großziehe, aber …« Ich wusste nicht weiter, wusste nicht in Worte zu fassen, was mich abhielt.
»Bian-Tao ist eine wunderbare Frau«, stellte Menden fest, offenbar hingerissen von akuter Altersmilde.
Ich konnte mich nicht entsinnen, ihn jemals etwas vergleichbar Positives über einen Menschen äußern gehört zu haben.
»Auch wenn ich nie verstehen werde, was sie ausgerechnet in Ihnen sieht«, fing er sich wieder in bewundernswerter Manier. »Doch wenn Sie mich fragen, ist eine Heirat und die damit einhergehende familiäre Bindung und Verantwortung Ihre letzte, ihre allerletzte Chance, Ihr Leben noch mal in den Griff zu bekommen.«
»Haben Sie schon mal mit Pierfrancesco Scuzzi unter einem Dach gewohnt?«, fragte ich. »Der Mann redet über nichts anderes mehr als seine Nachtwächtertätigkeit.«
»Sie lenken ab. Sie hören nicht zu und Sie lenken ab.«
»Und er hört Katy Perry!«
Menden stutzte. »Ist das nicht diese Heulboje?«, entfuhr es ihm dann. »Ich hatte mal einen Song von der im Ohr … Morgens im Radio gehört, furchtbar … Gegen Mittag war ich nahe dran, mir meine Dienstwaffe an den Kopf zu halten und abzudrücken, nur damit es aufhört … Doch Sie lenken ab«, wiederholteer heftig. »Kryszinski, in Ihrem Umfeld türmen sich die Leichen. Erst rings um Ihre TaxiBar in Mülheim, dann auf diesem TrailerPark in Portugal. So kann es nicht weitergehen! Zinksarg oder Vollzug, wollen Sie wirklich unbedingt so enden? Haben Sie nicht gerade erst eine schwere Schussverletzung auskuriert? Und immer noch nicht genug? Ich werde Ihnen jetzt etwas sagen: Ich erkläre meinen Vorgesetzten, dass Sie den Auftrag aus gesundheitlichen Gründen ablehnen müssen, und Sie gehen los und bringen endlich Ihr Leben in Ordnung.«
»Wie viel, sagten Sie, zahlen die?«
»Kryszinski«, blaffte er und knallte die Gewehrkugel mit flacher Hand auf das Wagendach, »Sie mögen sich für die sprichwörtliche Katze halten, aber glauben Sie mir: Auch neun Leben sind irgendwann mal aufgebraucht.«
»Eigentlich sehe ich mich eher als Hund«, gestand ich.
»Ich dachte, du wärst noch krankgeschrieben?« Ich lehnte mich mit dem Arm auf die offene Tür des Taxis und versuchte besorgt zu klingen, bekam aber einen entnervten Unterton nicht wirklich aus der Stimme verbannt. Es hat wohl seine Gründe, warum sie mich an der Schauspielschule nicht genommen haben.
»All deiner aufopferungsvollen Bemühungen zum Trotz«, sagte Hufschmidt, zählte das Wechselgeld nach, faltete die Quittung ordentlich in der Mitte und verstaute alles in seiner Geldbörse, »bin ich ab heute wieder dienstfähig.« Dann erst stieg er ächzend aus, schloss die Tür und das Taxi brummte davon.
»Darf ich dich erinnern«, mahnte ich, »dass du es warst, der unbedingt einen zweiten Fahrversuch wollte?«
»Willst du die Wahrheit wissen?«, fragte er zurück. »Ich habe mich geopfert. Denn weißt du, was passiert wäre, wenn man mich zum Fahrer erkoren hätte? Sie hätten dich an der Schusswaffe ausgebildet.« Eine Vorstellung, die ihn eine ganze Weile schaudern ließ.
Hufschmidt, fiel mir auf, hätte Möbelpacker werden sollen. Der beigefarbene Overall stand ihm bombe, hundertmal besser als seine übliche diarrhöbraune Kunstlederjacke und diese Jeans, die an ihm grundsätzlich so wirken, als ob er sie aus dem Sanitätshaus beziehen würde. Mal abgesehen von Modefragen war ich mir obendrein sicher, dass Umzugskisten zu schleppen so ziemlich die einzige Tätigkeit darstellte, die ihm nicht schon im Ansatz die Grenzen seiner geistigen Fähigkeiten aufzeigte.
Fertig mit Schaudern, sah er sich suchend um. Wir standen zur verabredeten Zeit auf dem Parkplatz eines Aldi-Marktes in Duisburg-Duissern, und Frau Kaufmann war nicht da.
Unser Auftrag – unser erster gemeinsamer Auftrag für Europol – war, sie sicher in ihr neues Domizil zu eskortieren, und um das möglichst unauffällig zu gestalten, fuhren wir ihr auch ein paar Möbel, die ich schon bei einer Spedition abgeholt hatte, und waren entsprechend kostümiert. Der Sprinter trug eh schon seit langem die Aufschrift ›Internationale Transporte Husuf Acin‹. Sein Laderaum war fensterlos, doch die Trennwand hatte man entfernt und eine Sitzbank in zweiter Reihe montiert.
»Auf Weiber muss man doch immer warten«, murrte Hufschmidt, ein Mann mit reichlich entsprechender Erfahrung, ich war mir sicher.
Eine Türkin mit bodenlangem Rock, weiter, buntbedruckter Bluse und einem ihre Sonnenbrille umrahmenden Kopftuch kam tütenbepackt aus dem Laden, auf uns zu, blieb stehen und räusperte sich. Hufschmidt sah sie irritiert an, ich blickte rätselnd, bis sie ihre Einkäufe auf den Boden stellte, die Brille abnahm, uns aus hellblauen Augen ausgesprochen kühl musterte und »Können wir los?« fragte.
Hufschmidt half ihr mit den Tüten, wir stiegen ein, Hufschmidt zog die Schiebetür zu, nahm auf dem Beifahrersitz Platz und hantierte mit seinem Gurt. Frau Kaufmann ließ sich hinter uns in das Polster fallen und begann augenblicklich, regelrecht vehement, sich aus ihrer Verkleidung zu schälen. Was darunter zum Vorschein kam, war kinnlang aschblond, blass, nervös und möglicherweise etwas zu schlank. Ah, und vollständig bekleidet mit einem dunkelblauen Kaschmir-Pullover über einer weißen Bluse und einem karierten Rock, was zusammen an britische Schuluniformen erinnerte und den Dirty Old Man in mir beide Hände tief in die Hosentaschen schieben ließ. Sie begegnete meinem Blick im Rückspiegel und ein frostiger Hauch überzog das Glas.
»Wieso dieser plötzliche Umzug?«, wollte sie wissen und klang alles andere als begeistert dabei.
»Geänderte Gefährdungslage«, antwortete Hufschmidt. »Wir haben Experten, die so was einschätzen, und handeln dann entsprechend bestimmter Richtlinien.«
»Geht das auch ein bisschen konkreter?«
»In Ihrem Fall: Umzug unter strenger Geheimhaltung in eine völlig neue Umgebung.«
»Ich meinte die Gefährdungslage.«
»Ihre Aussage hat ein neues Gewicht bekommen. Die juristische Anfechtbarkeit schwindet, das Schutzbedürfnis der Zeugin wächst.« All das heruntergebetet in dem typischen Ordnungsbehörden-Monoton.
Ich startete den Motor.
»Bitte anschnallen«, sagte Hufschmidt, und ich trat das Gas und fädelte uns in den Verkehr Richtung Autobahn.
»Wer ist das?«, fragte sie und meinte mich.
»Unser Fahrer«, antwortete Hufschmidt betont. »Ein Künstler am Lenkrad, ein Virtuose. Sie sollten den Abschlussbericht seines Ausbilders lesen. Reine Poesie.«
»Damit gibt es dann bei wachsender Gefährdungslage gleich noch einen weiteren Mitwisser. Stehen Sie unter Eid?«, wandte sie sich mit einiger Schärfe an mich.
»Eher so was wie Bewährungsauflagen«, antwortete ich und fuhr mit Neunzig auf den Starenkasten an der Mülheimer Straße zu.
»Pass auf!«, kam es vom Beifahrersitz und Fump! kam der Blitz. »Ja, Scheiße«, murrte Hufschmidt, an dem der Papierkram hängenbleiben würde. Tot zu sein hat nicht nur Nachteile.
»Bewährungsauflagen?«, fragte Frau Kaufmann konsterniert.
»Wirksamer als jedes Gelübde, glauben Sie mir.«
»Wollen Sie damit andeuten, dass Sie kriminell sind?«
»Hufschmidt, erklär du’s ihr.«
»Stockholm ist selber Teil des Programms, steht unter unserem Schutz. Allerdings«, fügte er mit einem Seitenblick auf mich hinzu, »nur solange er sich an sämtliche Auflagen hält.« Hufschmidt wirkte bei diesen Worten plötzlich so zufrieden wie eine fette, satte Katze.
»Augenblick, Augenblick, Augenblick! Ich hocke hier in einem Auto und werde chauffiert von jemandem, dem – genau wie mir – die Ermordung droht? Sind Sie bescheuert? Ist Ihnen nicht klar, dass sich damit das Risiko verdoppelt? Ich will hier raus!«
Wenn sie sprach, schmiegte sich ihre Oberlippe um die mittleren Schneidezähne, die größer ausfielen als die anderen, fast schon Hasenzähne, dabei aber eigenartig sexy. Doch das war’s auch schon an erotischer Ausstrahlung. Das restliche Paket verströmte eine desinteressierte Höhere-Tochter-Kühle, die zum Bleiben entschlossen schien, bis sie eines schönen Tages nach langer und strenger Auswahl den in sämtlichen Kriterien vom Erscheinungsbild über Bildungsgrad bis zum Einkommen absolut Richtigen gefunden hatte, vermutlich bei Elite-Partner.
»Stockholm ist offiziell für tot erklärt. Dem droht momentan gar nichts. Absolutes Wohlverhalten vorausgesetzt.«
Ich fragte mich nicht das erste Mal, was für einen Scheiß-Deal ich da eingegangen war. Auf TauchStation von Hufschmidts Gnaden? Das nahm dem Gedanken, von einem Killerkommando niedergemäht zu werden, mit einem Schlag einen Gutteil seines Schreckens. Unsere Passagierin war allerdings noch nicht so weit. Na ja, sie kannte Hufschmidt ja auch erst seit kurzem.
Eine Weile rollten wir schweigend dahin. Erst über die A2/A3 bis zum Kreuz Bottrop, dann weiter auf der A31 Richtung Emden. Fünfter drin und sturheil hoch nach Norden.
Frau Sibylle Kaufmann, so ihr neuer Name – den richtigen wusste ich nicht, bestimmte Details behielt man bei Europol strikt für sich –, kramte in ihren Einkaufstüten herum, ich hörte ein mir wohlbekanntes, blechernes Knrk, blickte in den Spiegel und sah, wie sie den Deckel von einer Cognacflasche schraubte, die sie sich ohne Umschweife an den Hals setzte. Einen langen Schluck aus der Pulle später keuchte sie kurz, tupfte sich den Mund mit dem Handrücken ab, begann zu reden und hörte nicht wieder auf.
»Ich schlafe nicht mehr, ich esse nicht mehr. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie das ist, wenn einem eine zu allem fähige Organisation nach dem Leben trachtet?«
»Vage«, antwortete ich. »Lässt einen zärtlich an früher zurückdenken, was? An Tage der Selbstvergessenheit und Nächte des tiefen, ungetrübten Schlafs.«
»Verschonen Sie mich mit Ihrem Galgenhumor! Mein Leben ist im Arsch! Ich wollte eine Familie gründen, Kinder kriegen! Der Aufenthalt im Kongo sollte mein praktisches Jahr werden, anschließend wartete eine Stelle in Hamburg auf mich. Dann bin ich mitten im Dschungel Zeugin dieser … dieser Unmenschlichkeiten geworden, und seither …«
Das war jetzt, soviel ich wusste, etwa anderthalb Jahre her, doch sie schien es noch immer nicht richtig fassen zu können.
»Ich wünschte, ich hätte Jura studiert, oder sonst was Trockenes, – aber nein! Es musste ja Medizin sein, nicht nur das, sondern Tropenmedizin, mit vollkommen kindischen Vorstellungen von segensreicher Tätigkeit in einem Wellblechkrankenhaus im Urwald. Bloß hat sich dann schon im Studium gezeigt, dass Tropenmedizin hierzulande in den meisten Fällen bedeutet, tagein, tagaus Spinner zu behandeln, die zur Aufplusterung ihrer Facebook-Profile lauter möglichst exotische Reiseziele abklappern müssen, oder alternde Perverse, die schorfige, juckende, übelriechende und oft genug multiresistente Souvenirs von ihren Sexreisen in schwülwarme Elendsgebiete mit nach Hause bringen.« Mit angewidertem Gesicht setzte sie die Flasche für einen weiteren Schluck an. Keuchte. »Und um zu beweisen, dass ich trotz allem zu meinen Idealen stehe, musste ich dann losziehen, und nicht nur in den Urwald, sondern gleich mittenrein in die gottverdammte Steinzeit! Wenn ich geahnt hätte, was ich da …« Sie brach ab, und ich sah, wie sie sich mit zitternden Fingern eine Zigarette ansteckte.
»Es wäre mir lieber …«, begann Hufschmidt, doch sie fuhr ihm ins Wort.
»Das ist mir egal, was Ihnen lieber wäre. Ich rauche, weil das das Einzige ist, was mich davor bewahrt, einen Nervenzusammenbruch zu kriegen, und das, glauben Sie mir, wollen Sie nicht.« Sie nahm einen Zug, unterdrückte ein Husten und spie den Rauch mehr von sich als dass sie ihn ausatmete. »Doch vor allem wünschte ich, ich hätte mich niemals auf diesen Scheiß hier eingelassen«, fuhr sie unter Husten fort.
Damit sind wir schon zwei, dachte ich und schaltete die Wischer an. Ein leichter, beständiger Regen hatte eingesetzt und ließ die Reifen Schaumspuren hinter den Autos herziehen. Wie praktisch immer, wenn ich unterwegs bin, behielt ich die ganze Zeit unser Umfeld im Auge, mobil wie immobil. Fahrzeuge in den drei Rückspiegeln wechselten unregelmäßig, völlig natürlich, bogen von der Autobahn ab, fielen zurück oder holten auf und zogen vorbei. Niemand folgte uns, niemand lauerte im Vorder- wie im Hintergrund, ich war mir einigermaßen sicher.
»Dass die Mafia so agiert, dass marodierende Banden und Milizen in rechtsfreien Räumen sich so verhalten, das erwartet man heutzutage ja schon nicht mehr anders – aber ein Konzern wie Asturias?«
Bis zu dem Briefing im Rahmen des Fahrtrainings für Hufschmidt und mich hatte ich, ehrlich gesagt, noch nie von diesem Laden gehört. Und doch war es den Beamten ernst gewesen, als sie Asturias als den möglichen ›Gefährder‹ dieses Transports einstuften. Noch gab es keine belastbaren Fakten, aber es sah ganz so aus, als ob der angestrengt um ein positives, ›faires‹ Image bemühte Mischkonzern unter der strahlenden Oberfläche ein verflochtenes Gewirr von obskur arbeitenden Tochterfirmen unterhielt. Offiziell ganz auf politische Korrektheit gebürstet, befanden sich in seinem Portfolio ökologisch ausgerichtete Landwirtschaftsbetriebe, Müllentsorger mit Blauem Engel, Handelsgesellschaften im Fairtrade-Verbund und so weiter. Der Auftritt war so überzeugend, dass es regelrechte Fanclubs mancher dieser Firmen gab. Trotzdem hielten sich hartnäckige Gerüchte, das ganze, in Monaco beheimatete Konglomerat sei in Wahrheit eine riesige Geldwaschanlage für mafiöse Strukturen. Asturias, so wurde vermutet, investierte Gewinne aus der organisierten Kriminalität im Ausland, und da, dank inniger Beziehungen zu einigen dortigen Regierungskreisen, vor allem in Afrika. Landkauf, Schürfkonzessionen, Suche und Förderung von Seltenen Erden, Mineralien, Gold. Finanziert wurde der ganze Segen augenscheinlich vor allem aus der Südhälfte Europas. Größere Klarheit über die Umstände und Strukturen wollte sich nicht recht einstellen, da allzu neugierige Rechercheure sich immer mal wieder als ausgesprochen glücklose Autofahrer, fatal ungeschickte Fensterputzer oder plötzlich und mit unbekanntem Ziel verzogen erwiesen. Und zu guter Letzt hatte man uns noch eingeschärft, dass Asturias zweifellos verhindern will, ausgerechnet mit einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit weltweites Aufsehen zu erregen.