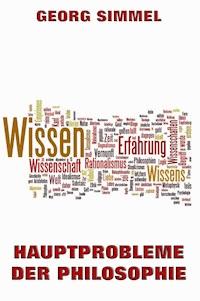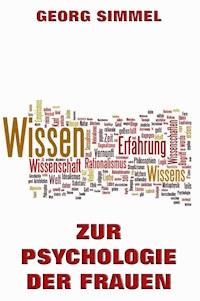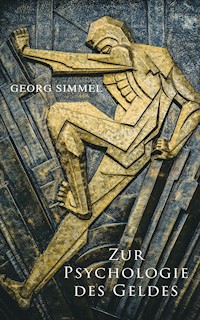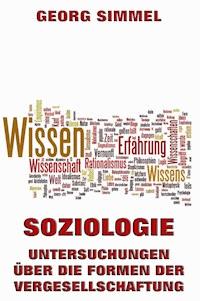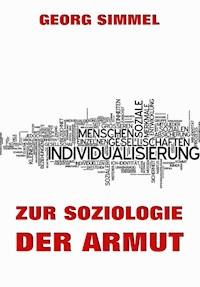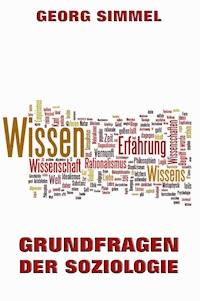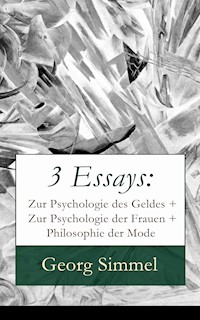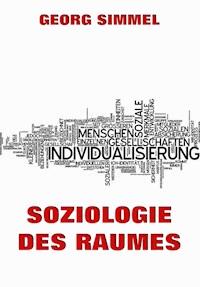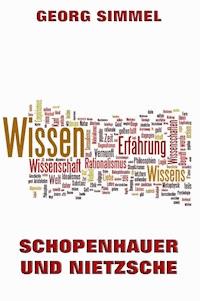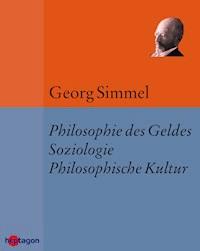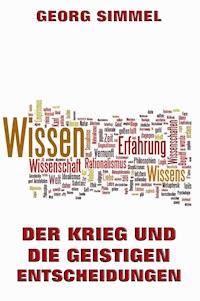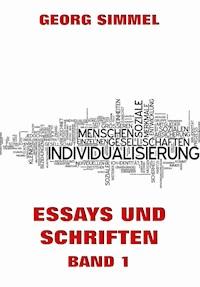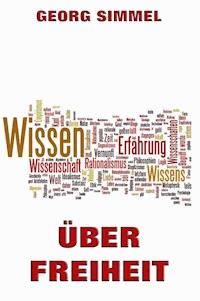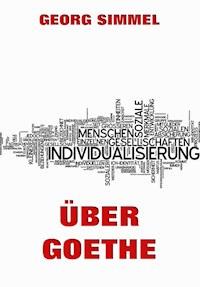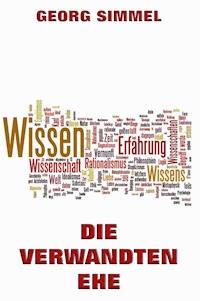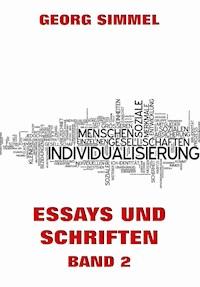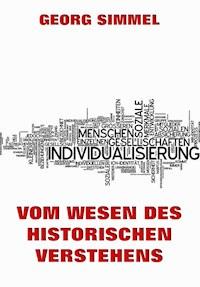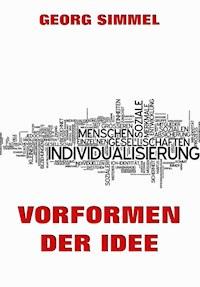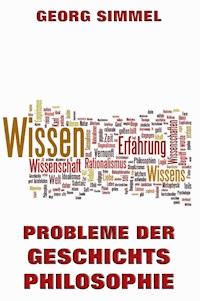
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine erkenntnistheoretische Studie im Sinne von Kants Vernunftkritik.
Das E-Book Probleme der Geschichtsphilosophie wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Probleme der Geschichtsphilosophie - Eine erkenntnistheoretische Studie
Georg Simmel:
Inhalt:
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Probleme der Geschichtsphilosophie - Eine erkenntnistheoretische Studie
1. Kapitel: Von den psychologischen Voraussetzungen der Geschichtsforschung
2. Kapitel: Von den historischen Gesetzen
3. Kapitel: Vom Sinn der Geschichte
Probleme der Geschichtsphilosophie, Georg Simmel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849617264
www.jazzybee-verlag.de
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Geb. 1. März 1858 in Berlin, gest. 26. September 1918 in Straßburg.
S. verbindet die psychologisch-genetische, evolutionistische mit einer logisch-idealistischen, an Kant und Hegel orientierten, vielfach »dialektischen« Betrachtungs- und Denkweise. Das Erkennen enthält apriorische Faktoren, die aber (als Kategorien) eine Entwicklung durchmachen, nicht unverändert bleiben. Alle Formen und Methoden des Erkennens haben sich im Verlaufe der menschlichen Geistesgeschichte entwickelt und entwickeln sich weiter, so aber, daß das Erkennen eine formende, gesetzgebende Aktivität des Geistes bleibt, welche aus dem Chaos der Erlebnisse erst einen sinnvollen, verständlichen, einheitlichen Zusammenhang gestaltet. Die Kategorien usw. stammen aus »der dem Geiste eigenen Fähigkeit, zu verbinden, zu vereinheitlichen«, können aber als historische Gebilde die Totalität der Weltinhalte nie völlig adäquat aufnehmen. Das Ich hat die Funktion der Einheitsetzung, das Streben zur Einheit. Die Wahrheit ist, rein logisch, etwas Zeitloses, Absolutes, vom subjektiven Denken Unabhängiges, sie gehört dem »dritten Reich«, dem »Reich der ideellen Inhalte« an; diese Inhalte sind wahr, gleichviel ob sie gedacht werden oder nicht. Das Geistige bildet inhaltlich einen geschlossenen Zusammenhang, den unser individuelles Denken unvollkommen nachzeichnet. Die ideellen Inhalte sind nicht, sie gelten, sie sind nicht mit den psychologischen Vorgängen zu verwechseln. Anderseits hat die Wahrheit auch eine biologisch-evolutionistische Seite. Wahr sind hier jene Vorstellungen, die, als reale Kräfte in uns wirksam, »uns zu nützlichem Verhalten veranlassen« (vgl. James). Durch Selektion haben sich bestimmte Vorstellungen als wahr erhalten, nämlich jene, »die sich als Motive des zweckmäßigen, lebenfördernden Handelns erwiesen haben« (vgl. Nietzsche). »Die Nützlichkeit des Erkennens erzeugt zugleich für uns die Gegenstände des Erkennens.« Es gibt so viele prinzipielle »Wahrheiten«, als es verschiedene Organisationen und Lebensanforderungen gibt. Das Objektive und Wahre bedeutet die »gattungsmäßige Vorstellung«.
Auch in der Ethik verbindet S. die genetisch-relativistische Betrachtungsweise betreffs der empirischen Einzeltatsachen mit einem gewissen Apriorismus und Idealismus. So ist das Sollen etwas Ursprüngliches und Objektives, als eine Forderung, die mit der Sache selbst gegeben ist, als ein »in dem Verhältnis von Seele und Welt präformiertes Sollen, das einer besonderen, aber nicht weniger übersubjektiven Logik unterliegt, wie das Sein«. Unser Bewußtsein empfindet Forderungen an sich, die es durch den Willen realisieren kann. Das Sollen schlechthin ist eine »Urtatsache«, eine »ursprüngliche Kategorie«, mag auch der Inhalt des Sollens noch so wechseln und sozial-historisch bedingt sein. Tatsächlich sind es immer »historische Zustände der Gattung, die in dem Einzelnen zu triebhaftem Sollen werden«. Der »Wille der Gattung« kommt in uns zum Ausdruck, kündigt sich imperativisch an. Ein ungeheurer Teil der an uns gestellten Ansprüche ist sozialen Inhalts, ohne daß dadurch die Unbedingtheit des idealen Sollens überhaupt, die »innere Logik ideeller Ansprüche« beeinträchtigt wird. Das sittlich Gute besteht nicht im Anstreben des Glücks u. dgl. (gegen den Eudämonismus), sondern es ist eine »unmittelbare Qualität und Lebensform des Willensprozesses«. Etwas ist gut, weil und wofern es Inhalt eines an sich guten Willens ist. Die moralischen Imperative sind »Ausmündungen, Ausformungen, Substantialisierungen des guten Willens«. Die Sittlichkeit liegt nicht im Material des Willens, sondern in diesem selbst, in dessen Funktion. Das Ideal des sittlichen Verhaltens liegt im Unendlichen. Das Sollen kann sich an den verschiedensten Inhalten verwirklichen; die Einheit des Zieles ist nicht notwendig, es genügt die Einheit der psychologisch-ethischen Funktion, die den Zweck trägt. Ursprünglich ist das sozial Erforderte die Norm des Verhaltens der Einzelnen. Den »kategorischen Imperativ« Kants kritisiert S. nach der Richtung der Versöhnung des Individualismus mit der Allgemeinheit des Handelns. Das Gewissen ist nach S. gleichsam ein »rückwärts gewandter Instinkt«; es ist die.Lust oder Unlust der Gattung über die Tat, die in uns zum Ausdruck kommt. Der Altruismus ist ebenso primär wie der Egoismus, er ist »Gruppenegoismus«, ein vererbter Instinkt. Sehr oft. »machen die Motivierungen unserer Handlungen... an Punkten Halt, die völlig und definitiv außerhalb unser selbst liegen«. Auch enthält das Ich noch eine Fülle von Motiven außer dem »Glück«. – Die Freiheit des Willens bedeutet, daß sich der Charakter des Ich ungehindert im Wollen ausprägen kann, das Vermögen, das für uns wertvolle Wollen realisieren zu können. Freiheit ist »Selbstbestimmung«, sie ist zugleich, weil das Ich nur so sein kann, wie es ist, Notwendigkeit. Die Verantwortlichkeit ist nicht aus der Willensfreiheit abzuleiten, sondern umgekehrt: »Derjenige ist frei, den man mit Erfolg verantwortlich machen kann.« Zurechnungsfähig ist jemand, wenn die strafende Reaktion auf seine Tat bei ihm den Zweck: der Strafe erreicht.
Die Grundfrage der Geschichtsphilosophie ist die: wie ist Geschichte möglich? Geschichte ist nur durch Kategorien, apriorische Verbindungsformen möglich, sie ist kategorial verbreitete Wirklichkeit und daher hat die Geschichtsphilosophie die »Aprioritäten festzustellen und zu erörtern, durch welche aus dem Erleben... Geschichte als Wissenschaft wird«. Die Kompliziertheit des historischen Geschehens gestattet nicht die Aufstellung eigener historischer Gesetze, wenn auch das Historische auf (biologisch-psychologischen) Gesetzmäßigkeiten beruht. Das ganze Spiel der Geschichte ist die Folge, Erscheinung oder Synthese dieser primären Gesetzmäßigkeiten, geht aber nicht aus einem besonderen Gesetz hervor.
Die Soziologie ist die »Wissenschaft vom Gesellschaftlichen als solchen, von den Formen der Vergesellschaftung, von den Beziehungsformen der Menschen zueinander«. Die Soziologie ist keine Universalwissenschaft vom Menschen u. dgl., sondern eine besondere Methode; sie abstrahiert vom Inhalt des Gesellschaftlichen, achtet nur auf dieses, wie der Mathematiker etwa nur auf die geometrische Form, nicht auf das Material der Körper achtet. Die Soziologie, hat die »Kräfte, Beziehungen und Formen zum Gegenstand, durch die die Menschen sich vergesellschaften«, sie ist die »Lehre von dem Gesellschaft-Sein der Menschheit«. »Gesellschaft im weitesten Sinne ist offenbar da vorhanden, wo mehrere Individuen in Wechselwirkung treten. Die besonderen Ursachen und Zwecke, ohne die natürlich nie eine Vergesellschaftung erfolgt, bilden gewissermaßen den Körper, das Material des sozialen Prozesses; daß der Erfolg dieser Ursachen, die Förderung dieser Zwecke gerade eine Wechselwirkung, eine Vergesellschaftung unter den Trägern hervorruft, das ist die Form, in die jene Inhalte sich kleiden.« Solche Formen sind Über- und Unterordnung, Konkurrenz, Arbeitsteilung usw.; wichtig sind besonders auch die kleinen, flüchtigen Wechselwirkungen von Person zu Person. Die sozialen Verbindungen erwachsen aus bestimmten Trieben oder Willenstendenzen (Zielen), sind etwas Psychisches, aber nichts Psychologisches, denn die Soziologie hat es nicht mit psychologischen Vorgängen, sondern mit Inhalten solcher zu tun, mit Kombinationen soziologischer Kategorien, mit etwas Sachlichem. Es gibt keinen Gesamtgeist, wohl aber eine seelische Beeinflussung der Individuen durch ihre Vergesellschaftung. In der Gesellschaft herrscht Arbeitsteilung und Differenzierung, verbunden mit Integrierung, indem jede Befreiung zu einer neuen Bindung führt. Die Religion wurzelt in den Gesamttendenzen der Persönlichkeit und ihrer Beziehung zum All.
SCHRIFTEN: Das Wesen der Materie nach Kants physischer Monadologie, 1881. – Über soziale Differenzierung, 1890; 3. A. 1906, – Einleit. in die Moralwissenschaft, 1892-93; 2. A. 1901. – Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 1892; 2. A. 1905; 3. A. 1907. – Philosophie des Geldes, 1900; 2. A. 1907. – Vorlesungen über Kant, 1904; 2. A. 1905. – Die Religion, 1906. – Schopenhauer u. Nietzsche, 1906. – Soziologie, 1908. – Hauptprobleme der Philosophie, 1910. – Das Problem der Soziologie, Schmollers Jahrbücher, Bd. 18, 1894. – Skizze einer Willenstheorie, Zeitschr, f. Psychol. d. Sinnesorgane, Bd. 9, – Beitrag zur Erkenntnistheorie der Religion, Zeitschr. f. Philos., Bd. 118. – Über eine Beziehung der Selektionslehre zur Erkenntnis, Archiv f. systemat, Philos., 1895. – Über die Grundfrage des Pessimismus, Zeitschr. f. Philos., Bd. 90. – Zur Psychologie der Frau, Zeitschr. f. Völkerpsychol, 1890, u. a.
Probleme der Geschichtsphilosophie - Eine erkenntnistheoretische Studie
Meiner Mutter gewidmet
Vorwort
Die Einleitung zu diesen Untersuchungen kann sich darauf beschränken, ihre Charakterisierung als rein erkenntnistheoretische zu betonen.
Wie allenthalben die Theorie der menschlichen Dinge sich scharf gegen die Normgebung für sie abzugrenzen hat, so liegt der Theorie des Erkennens nur eine immanente Analyse desselben ob, nur eine Feststellung seiner Elemente, des Verhältnisses zu seinen selbstgesetzten Zielen und der Stellung des einzelnen im Zusammenhänge des anderweitigen Wissens.
1. Kapitel: Von den psychologischen Voraussetzungen der Geschichtsforschung
"Es schien der Mühe wert, in dem Gewordenen aufbewahrte Spuren des Werdens ? durch die Phantasie, welche wie aller Poesie so auch aller Historie Mutter ist, nicht zu einem Ganzen, aber zu dem Surrogat eines solchen zusammenzufassen."
Mommsen, Römische Geschichte, V, 5.
Wenn Erkenntnistheorie überhaupt von der Tatsache ausgeht, daß das Erkennen, formal betrachtet, ein bloßes Vorstellen und sein Subjekt eine Seele ist, so wird die Theorie des historischen Erkennens weiter dadurch bestimmt, daß seine Materie das Vorstellen, Wollen und Fühlen von Persönlichkeiten, daß seine Objekte Seelen sind.
Alle äußeren Vorgänge, politische und soziale, wirtschaftliche und religiöse, rechtliche und technische würden uns weder interessant noch verständlich sein, wenn sie nicht aus Seelenbewegungen hervorgingen und Seelenbewegungen hervorriefen.
Soll die Geschichte nicht ein Marionettenspiel sein, so ist sie die Geschichte psychischer Vorgänge, und alle äußeren Ereignisse, die sie schildert, sind nichts als die Brücken zwischen Impulsen und Willensakten einerseits und Gefühlsreflexen andererseits, die durch jene äußeren Vorgänge ausgelöst werden.
Daran ändert auch die materialistische Geschichtsauffassung nichts, die die Bewegungen der Geschichte aus den physiologischen Bedürfnissen der Menschen und ihrem geographischen Milieu ableiten will.
Denn zunächst würde aller Hunger niemals die Weltgeschichte in Bewegung setzen, wenn er nicht wehthäte, und aller Kampf um die ökonomischen Güter ist ein Kampf um die Empfindungen der Behaglichkeit und des Genusses, von denen als Zwecken aller äußere Besitz seine Bedeutung entlehnt. Und die Beschaffenheit von Boden und Klima würde für den Lauf der Geschichte so gleichgültig bleiben, wie Boden und Klima des Sirius, wenn sie nicht direkt und indirekt die psychologische Verfassung der Völker beeinflußte.
Gäbe es eine Psychologie als Gesetzeswissenschaft, so würde Geschichtswissenschaft in demselben Sinne angewandte Psychologie sein, wie Astronomie angewandte Mathematik ist.
Wenn es die Aufgabe der Philologie ist, Erkanntes zu erkennen, so bildet die Geschichtskunde nur eine Erweiterung davon, indem sie neben dem Erkannten, d.h. dem theoretisch Vorgestellten, auch das Gewollte und Gefühlte zu erkennen hat.
Dieser Charakter der Innerlichkeit der historischen Vorgänge, der für alle Schilderung ihrer Äußerlichkeit den Ausgangspunkt und den Zielpunkt gibt, fordert nun eine Reihe spezifischer Voraussetzungen, die die Erkenntnistheorie der Historik darzustellen hat.
Hinter dem absoluten Apriori des Intellekts nämlich, von dem wir ausgingen, steht ein zweites, innerhalb des Intellekts geltendes und relatives Apriori.
Wenn vielerlei Einzelvorstellungen zu einem Allgemeinbegriff zusammengefaßt werden, ein Subjekt und ein Prädikat zu einem Urteil, mehrere Urteile zu einer Maxime, so ist hier das Material von der Gestalt abtrennbar, die es so erhält, und jedes von beiden ist für sich allein vorstellbar.
Wie viel oder wenig Apriorisches und Spontanes nun in diesem Material selbst schon stecken mag, in der hier in Betracht kommenden Beziehung ist es gegebener Inhalt, an dem der Intellekt eine weitere Funktion vollzieht, die nun ihrerseits jenem gegenüber a priori ist; in dem Inhalt selbst liegt sie nicht, sondern wird zu ihm hinzugebracht.
Wenn es aber nach der Kantischen Schematisierung nur dreierlei Arten von Apriori gibt: das der Sinnlichkeit, das die Empfindungen, des Verstandes, das die Anschauungen, der Vernunft, das die Urteile zum Material hat ? oder eigentlich nur eine einzige, da die anderen auf das Apriori des Verstandes zurückzuführen sind ? so zeigt die empirische Betrachtung leicht die ungerechtfertigte Enge dieser Einteilung.
Es gibt offenbar sehr viele Stufen des Apriori und sehr verschiedenartige Mischungen der hinzugebrachten Form mit dem vorgefundenen Inhalt. Und insbesondere gibt es keine Methode, die uns zu einem festgeschlossenen, gegen Grenzverrückung gesicherten System der Verbindungsfunktionen führte, mit denen wir das jeweils gegebene Erkenntnismaterial formen.
Nicht scharfe, systematische Scheidungen, sondern allmählichste Übergänge bestehen zwischen den allgemeinsten, jedem Material zugänglichen und selbst über die Einzelerfahrung erhobenen Formen und den speziellen, selbst empirisch gewonnenen und als Apriori nur für gewisse Inhalte anwendbaren: also etwa zwischen dem Kausalgesetz oder der Zusammenschließung des Gleichen an verschiedenen Gegenständen zu einem Begriff einerseits und den methodischen oder sonstigen Voraussetzungen für ein besonderes Lebensgebiet, für eine besondere Wissenschaft andererseits.
Alle Rechtsbildung z.B. setzt die Erwünschtheit eines bestimmten Zustandes voraus.
Daß die menschlichen Verhältnisse die Erreichung eines solchen nur durch festgesetzte Normen und durch Strafbestimmungen für deren Überschreitung ermöglichen, ist ein sehr allgemeines Apriori, das eine gewisse Gestaltung, d.h. Verbindung vorgefundener Vorstellungen zur Folge hat.
Allein diese Verbindungsform zur Bildung von Gesetzen ist doch nicht so allgemein, wie etwa die Kausalverbindung zwischen psychischer Motivierung und äußerlicher Handlung, die gleichfalls, für die Rechtsbildung erforderlich, zwischen den Erscheinungen gestiftet, aber nicht unmittelbar aus ihnen abgelesen werden kann. Andererseits aber ist das Apriori, das die Rechtsform überhaupt bildet, wieder ein allgemeines gegenüber den Voraussetzungen, aus denen die Rechtsfindung im einzelnen hervorgeht.
So bewirkt z.B. der Grundsatz, daß dem Kläger der Beweis obliegt, oder die verschiedene Geltung des Gewohnheitsrechts eine Formung der Tatsachen zum Zweck der Erkenntnis, was Rechtens sei ? eine Formung, die in dem tatsächlichen Material selbst nicht liegt, sondern erst seine Deutung an ihm vollzieht.
Kant hat mit vollem Recht seinen kritischen Scharfsinn gegen die Empiristen aufgeboten, welche ihre Forschungen auf das bloße Aufnehmen von sinnlichen Eindrücken, auf das Registrieren unmittelbar beweislicher Tatsächlichkeiten beschränken wollten; er hat gezeigt, daß sie, ohne es selbst zu merken, fortwährend von unbewiesenen metaphysischen.
Grundsätzen Gebrauch machen und vermittelst solcher erst denjenigen Zusammenhang zwischen den sinnlichen Gegebenheiten stiften, der diese zu einer verständlichen Erfahrung macht.
Allein der Einfluß und die Notwendigkeit der unbewußten und unbewiesenen Voraussetzungen erstreckt sich sehr viel weiter, als die Kantischen Untersuchungen zeigen.
Die Praxis wie die Theorie machen in jedem Augenblick von Verbindungsformen für das empirische Material, von jenem eigentümlichen plastischen Vermögen des Geistes Gebrauch, das jeden gegebenen Inhalt durch die Art, ihn anzuordnen, zu stimmen und zu betonen, in die mannigfaltigsten definitiven Gestalten gießen kann.
Diese Verbindungen, die, in Satzform ausgesprochen, als apriorische Voraussetzungen erscheinen, bleiben in dem Maße unbewußt, in dem sich überhaupt das Bewußtsein mehr auf das Gegebene, relativ Äußerliche, als auf seine eigne innerliche Funktion richtet.
Unermeßlich viele Denkinhalte gehen durch den Geist, ehe er überhaupt ein Bewußtsein darüber hat, daß er denkt; die Gegenstände der Außenwelt beobachtet er lange vor den Vorgängen in ihm selbst, und je innerlicher, man möchte sagen, je psychischer der Vorgang ist, desto später gewinnt er das auf ihn selbst zurückgewandte Bewußtsein für sich, das vielmehr an seinen äußeren Erregungen haftet; und an diesen um so mehr haftet, als sie durch die Buntheit ihres Wechsels und die Schärfe ihrer Gegensätze die Unterschiedsempfindlichkeit der Seele fortwährend reizen, während die formalen Funktionen dieser selbst von beschränkterer Zahl sind, den mannigfaltigsten Inhalten sich in immer gleicher Weise darbieten und durch ihre Existenz von jeher wie durch ihre endemische Allgemeinheit jene Gewöhnung an sich erzeugen, die das Bewußtsein darüber wie über ein absolut Selbstverständliches weggleiten läßt.
Auch hier gilt die tiefe Beobachtung von Aristoteles, daß dasjenige, was in der rationalen Ordnung der Dinge das erste ist ?Erkenntnisfunktion des Geistes ? für unsere Beachtung und Beobachtung das letzte ist. Wieweit sich aber diese unbewußte Herrschaft der Verbindungsformen über das Tatsachenmaterial ausdehnt, das hat Kant wegen seiner scharfen Trennung des Apriori von allem Empirischen nicht in vollem Umfange erkannt.
Indem wir heute die Erfahrung sich viel höher hinauf erstrecken lassen, als er es tat, erstreckt sich uns das Apriori viel tiefer hinunter.
Im Verkehr der Menschen untereinander muß jeder in jedem Augenblick das Vorhandensein geistiger Vorgänge an Anderen voraussetzen, die er unmittelbar nicht konstatieren kann, ohne die aber die Handlungen dieser Anderen als eine sinn? und zusammenhangslose Zusammenwürflung sprunghafter Impulse erscheinen müßten; wir ergänzen sie hinzu, wie wir den blinden Fleck ergänzen, der unser Gesichtsbild unterbricht, ohne daß wir wegen der Selbstverständlichkeit der Ergänzung die Unterbrechung merkten.
Wie wir das Innere nur nach Analogie des Äußeren verstehen, was die Sprache schon andeutet, wenn sie alle seelischen Vorgänge nur durch Worte bezeichnet, die aus der Welt der äußeren Anschauung genommen sind ? so verstehen wir andererseits das Äußere der Menschen nur nach untergelegten Innerlichkeiten.
Ebendeshalb ergänzen wir aber auch das Äußere so, wie der einmal angenommene innerliche Zusammenhang es verlangt, bez. so, daß es überhaupt einen innerlichen Zusammenhang ergibt.
Man kann wohl behaupten, daß kaum ein Berichterstatter uns von der mitangesehenen Entwicklung eines Ereignisses genau das erzählt, was er gesehen hat. jede gerichtliche Zeugenvernehmung, jede Erzählung von einem Straßenauflauf bestätigt dies.
Mit dem besten Bestreben, bei der Wahrheit zu bleiben, setzt der Erzähler zu dem unmittelbar Gesehenen Glieder hinzu, die das Ereignis in dem Sinne vervollständigen, den er aus dem wirklich Gegebenen herausgelesen hat ? wie ja auch der Hörer, nach dem Maße seiner Erfahrungen und der durch sie bestimmten Phantasie, immer mehr im Geiste sehen muß, als ihm tatsächlich gesagt wird.
Die Sinnesphysiologie hat uns unzählige Fälle nachgewiesen, in denen wir an einzelnen Objekten und Bewegungen die fragmentarischen Eindrücke der Sinne unbewußt so ergänzen, wie unsere bisherigen Erfahrungen es verlangen.
Bei zusammengesetzten Ereignissen ist dies genau das Gleiche, und beiden von der Geschichte berichteten wird die äußerliche Ergänzung im wesentlichen durch psychische Annahmen bestimmt, durch die Erfahrungen über Kontinuität und Entwicklung des Seelenlebens, über die Korrelation unter seinen Energien, über den Ablauf der teleologischen Prozesse.
Alles dieses wird nicht nur auf Anregung durch die äußeren Verhältnisse hin vorausgesetzt, sondern, nachdem es vorausgesetzt ist, werden die äußeren Ereignisse soweit ergänzt, daß sie nun auch, gemessen an den Erfahrungsgesetzen über den Zusammenhang des Innern mit dem Äußern, eine den innern Vorgängen ununterbrochen parallele Reihe ergeben.
Gerade diese spontane Ergänzung des Äußerlichen ist einer der stärksten Beweise dafür, daß auch das Innerliche nicht einfach aus den Tatsachen abgelesen, sondern auf Grund allgemeiner Voraussetzungen zu ihnen hinzugebracht wird.
Aus dem rein Äußerlichen, das einer dem anderen bietet, wird auf unzählige unbewußte Voraussetzungen hin der Schluß auf die Gedanken und Gefühle jenes gezogen, der doch höchstens ein Schluß von der Wirkung auf die Ursache ist.
In den alltäglichen Angelegenheiten haben wir allerdings hinreichende Gelegenheit, die Richtigkeit dieses Schlusses nachzuprüfen, indem unserem auf ihn hin eintretenden Handeln das vorausberechnete äußere Verhalten des Anderen wirklich ausnahmslos antwortet.
Allein für höhere und kompliziertere Seelenvorgänge fallen diese Schlüsse sofort ins Ungewisse, führen zu unzähligen Irrtümern und liefern eben damit den Beweis, daß sie auch in jenen sichereren Fällen doch nur Voraussetzungen sind, die an das Gegebene herangebracht werden und ihre Sicherheit der praktischen Brauchbarkeit, aber nicht einer inneren Notwendigkeit verdanken, die sie aus jenem Gegebenen rational hervorgehen ließe.
Diese Voraussetzungen des täglichen Lebens nun wiederholen sich vollständiger und einflußreicher in der Geschichtsforschung, als in irgend einer anderen Wissenschaft, ja als in der Psychologie selbst.
Denn diese macht die fraglichen Voraussetzungen selbst zu Gegenständen der Untersuchung.
Die Historie aber nimmt die psychologischen Voraussetzungen ungeprüft und unmethodisch auf.
Schon wenn diese Voraussetzungen so selbstverständlich wären, daß jede äußere Tatsache sich unweigerlich und völlig eindeutig unter die für sie passende rangierte, würde die Feststellung derselben eine bedeutsame Aufgabe sein.
Sie gewinnt aber an Feinheit und Schwierigkeit außerordentlich dadurch, daß wir an das gleiche innere Ereignis manchmal ganz verschiedene äußere Folgen geknüpft sehen.
Dies ist uns nur durch eine Verschiedenheit der seelischen Begleitungen oder Folgen jenes ersten Ereignisses verständlich, das demgemäß bald unter die eine, bald unter die andere ganz entgegengesetzte psychologische Norm gebracht werden muß. z.B. erzählt Sybel (Gesch. d. Revolutionszeit II, 364) von dem Verhältnis des Wohlfahrtsausschusses zu den Hebertisten im Jahre 1793: "Sie (die Hebertisten) waren bisher mit Robespierre vortrefflich ausgekommen, weil dieser sich auf ihre Kräfte gestützt und folglich ihre Wünsche befördert hatte.
? Aber was sie von nun an unwiderruflich trennte, war der einfache Umstand, daß Robespierre der Lenker der höchsten Staatsgewalt geworden, die Hebertisten aber in einer untergeordneten Stellung geblieben waren.
" Die äußerlichen Tatsachen: Robespierre befördert die Wünsche der Hebertisten; sie schließen sich an ihn an; jetzt gewinnt er die herrschende Stellung; sie fallen von ihm ab ? diese Tatsachen bilden nach den untergelegten psychologischen Voraussetzungen eine durchaus verständliche Reihe. Und doch sind diese Voraussetzungen keineswegs so zwingend und unzweideutig, wie sie zunächst scheinen. Daß man durch das Befördern der Wünsche jemandes, durch ihm erzeigte Guttaten seine Zuneigung und praktische Hingebung erwirbt, kommt oft genug vor, aber doch auch das Gegenteil.
So wird uns aus den blutigen Geschlechterfehden des Trecento von einem vornehmen Ravennaten erzählt, der seine gesamten Feinde in einem Hause zusammen hatte und sie ohne weiteres vernichten konnte; statt dies zu Tun, entließ er sie und beschenkte sie noch reichlich.