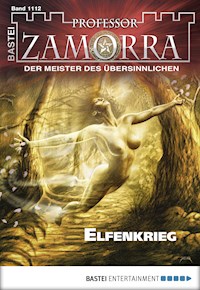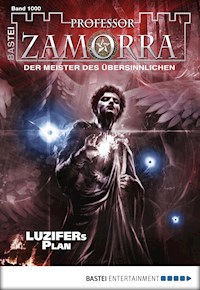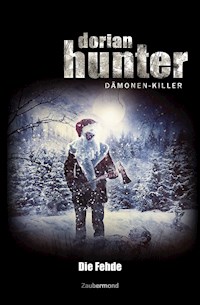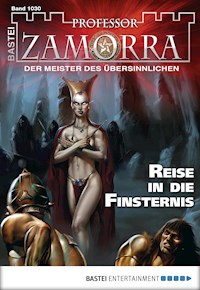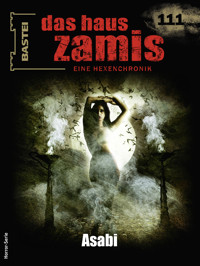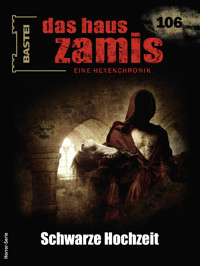1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Madame Claire schob ihr Fahrrad auf die Zugbrücke von Château Montagne zu. Hundert Meter noch, dann hatte sie es geschafft. Ein ungewohntes Geräusch drang durch das Keuchen an ihr Ohr und veranlasste sie, nach oben zu schauen. Erstaunt blieb die Köchin stehen. Auf dem Nordturm, zwischen zwei Zinnen, stand jemand. Ein Mann wohl. Er schaute, leicht nach vorne gebeugt, herunter und sprach anscheinend mit jemandem, der sich hinter ihm befand. Plötzlich sprang er! Madame Claire schrie entsetzt, als der Mann mit rudernden Armen und Beinen in die Tiefe stürzte - und sich im Flug entzündete! Wie ein flammender Komet fiel er dem Boden entgegen. Und schlug auf. Das Feuer erlosch. Madame Claire warf das Fahrrad hin und hastete zu dem Selbstmörder hin ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Craotoan
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Jwan Reber
Datenkonvertierung E-Book: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-8387-4910-5
www.bastei-entertainment.de
Croatoan
von Christian Schwarz
Madame Claire schob ihr Fahrrad auf die Zugbrücke von Château Montagne zu. Hundert Meter noch, dann hatte sie es geschafft. Ein ungewohntes Geräusch drang durch das Keuchen an ihr Ohr und veranlasste sie, nach oben zu schauen. Erstaunt blieb die Köchin stehen.
Auf dem Nordturm, zwischen zwei Zinnen, stand jemand. Ein Mann wohl. Er schaute, leicht nach vorne gebeugt, herunter und sprach anscheinend mit jemandem, der sich hinter ihm befand.
Plötzlich sprang er!
Madame Claire schrie entsetzt, als der Mann mit rudernden Armen und Beinen in die Tiefe stürzte – und sich im Flug entzündete! Wie ein flammender Komet fiel er dem Boden entgegen. Und schlug auf. Das Feuer erlosch. Madame Claire warf das Fahrrad hin und hastete zu dem Selbstmörder hin …
Das Herz der beleibten älteren Frau schlug wie rasend. So ein Schreck in dieser frühen Morgenstunde, in der es noch dunkel war!
Tausend Gedanken gleichzeitig schossen ihr durch den Kopf. Der Mann war ihr irgendwie bekannt vorgekommen – ohne dass sie ihn wegen der großen Höhe wirklich erkannt hätte. Was war da nur mit ihm passiert? Sie hatte schon Artikel über diese geheimnisvollen Selbstentzündungen gelesen. War sie gerade Zeugin einer solchen geworden? Oder war das etwa ein Dämon gewesen, den der Professor vernichtet hatte? Unmöglich, die M-Abwehr hätte jedem Schwarzblütigen längst vorher den Garaus gemacht.
Oder hatte der Professor mal wieder magisch experimentiert und deswegen den Abwehrschirm außer Kraft gesetzt? Von derart verantwortungslosem Tun hatte ihr William schon einige Male berichtet!
Madame Claire bekam kaum noch Luft, so schnell rannte sie auf den Verletzten zu. Als ihr schlagartig klar wurde, dass es, im Falle eines Dämons, äußerst gefährlich war, sich diesem zu nähern, stoppte sie abrupt. Im selben Moment erkannte sie den Mann.
Dylan McMour!
Nein, korrigierte sie, als sich der Kerl stöhnend aus dem Gras erhob. Es musste sich um eine zufällige Ähnlichkeit handeln. Der Mann, der gerade auf den Hosenboden zurückfiel, sich mit den Armen nach hinten abstützte und den Kopf schüttelte, sah wie ein Junkie aus. Totenbleich, ungewaschen, unrasiert, die Augen tief in den Höhlen, von dunklen Ringen umgeben, die so tief wie die die Schluchten von Les Baux wirkten. Immerhin besaß die Gestalt die gleichen Strubbelhaare wie Dylan McMour, aber sonst hatte sie nichts mit dem smarten Schotten gemein; dem Sunnyboy, der sie mit seiner lockeren Art immer so begeistert hatte, mit seinen nicht ganz hasenreinen Kraftausdrücken, dank denen er bestens in ihr Dorf gepasst hätte.
Aber irgendetwas sagte ihr, dass er es doch war.
Madame Claire ging ein paar weitere zögerliche Schritte auf ihn zu. Der Mann beugte den Oberkörper nach vorne, stöhnte und presste die Handflächen gegen die Schläfen. Dadurch rutschten die Ärmel des schwarzen Seidenhemds, das sie schon mal in des Professors Kleiderschrank zu sehen geglaubt hatte, hoch.
Madame Claire erschrak. Es lief ihr eiskalt den Rücken hinunter. Der linke Unterarm McMours war tiefschwarz. Hautfarbene Schlieren trieben auf oder in der Schwärze, das konnte sie nicht so genau erkennen. Dass diese Schlierenmuster aufgeregt waren, hingegen schon. Sie wusste einfach, dass es so war. Möglicherweise hing es damit zusammen, dass die Schwärze leuchtete. McMours rechter Unterarm schien sich zum linken spiegelbildlich zu verhalten. Hier gab es schwarze Muster auf hautfarbenem Untergrund.
Nicht, dass das angenehmer ausgesehen hätte. Beide – Dinger? Tattoos? Oder wie das hieß - wirkten extrem bedrohlich, ja gefährlich.
Erst jetzt wurde es der Köchin bewusst, dass der Mann ja eigentlich am ganzen Körper schwarz verbrannt hätte sein müssen. Sie blieb erneut stehen. Nur noch rund zehn Meter war sie von ihm entfernt.
Jetzt schien er sie zu bemerkten. Sein Kopf ruckte hoch. Die Augen, die sie von unten herauf anstarrten, wirkten derart gemein und tückisch, dass sie sicher war, ihr Herz werde umgehend stehen bleiben. Gleichzeitig glaubte sie, Wahnsinn in ihnen glänzen zu sehen.
McMour begann zu röcheln, verdrehte die Augen und drückte die Handballen erneut gegen die Schläfen. Dabei bewegte er den Kopf hin und her. Mit einem Ächzen schien er sich zu entspannen. Seine Augen wirkten nun, als sei er wieder in diese Welt zurückgekehrt.
»Madame Claire«, krächzte er. »Kommen Sie bloß nicht näher. Das könnte gefährlich werden. Noch besser, hauen Sie ab, so schnell Sie können.«
»Monsieur McMour, ich …«
»Hast du nicht verstanden? Hau ab, solange du’s noch kannst!«, brüllte er. Um im nächsten Moment leise schluchzend in sich zusammenzufallen. Sein ganzer Körper bebte, als er die Hände vors Gesicht schlug.
Madame Claire fühlte sich vollkommen überfordert. Es kam ihr wie ein Geschenk des Himmels vor, dass in diesem Moment Geräusche im Château-Innenhof laut wurden. Professor Zamorra und Nicole Duval erschienen und rannten über die geöffnete Zugbrücke direkt auf sie zu! Der Professor im Morgenmantel, Mademoiselle Duval im Jogging-Anzug.
Der Meister des Übersinnlichen ging neben seinem ehemaligen Dämonenjäger-Lehrling in die Knie, während Mademoiselle zehn weitere Meter auf sich nahm und sich um Madame Claire kümmerte – wofür ihr die Köchin im Übrigen äußerst dankbar war.
»Madame Claire«, sagte Mademoiselle und sah sie so besorgt an, dass es der Köchin ganz warm ums Herz wurde. Umso mehr, als Mademoiselle auch noch fürsorglich den Arm um sie legte. »Haben Sie das alles mit angesehen? Was ist passiert?«
»Monsieur McMour, er … er hat plötzlich gebrannt. In der Luft ist er angegangen. Und beim Aufschlag hat’s die Flammen plötzlich wieder ausgeblasen. Ich schwör’s, dass es so war.«
»O Kacke, ja«, erwiderte McMour, der sich gerade mit Zamorras Hilfe erhob und dann etwas wackelig auf den Beinen stand. Als gehöre er nicht zu ihm, hielt er seinen linken Arm in die Luft und starrte das Tattoo an, dessen schwarzer Teil nun nicht mehr leuchtete. Auch die träge wandernden Schlieren, die fast psychedelische Gefühle in Madame Claire weckten, schienen nicht mehr aufgeregt zu sein.
»Dieser verfluchte Feuerreif war das. Er hat meinen Tod verhindert.« Der junge Schotte biss sich fast die Unterlippe blutig.
Zamorra legte väterlich den Arm um seine Schultern. »Du Vollidiot«, sagte er inbrünstig. »Seien wir dem Feuerreif alle dankbar, dass er dich gerettet hat. Glaub mir, wir finden eine Lösung, dass du die Dinger wieder loswirst.«
»Das funktioniert nicht.«
»Jetzt reiß dich zusammen, Dylan«, antwortete Zamorra scharf. »Los, schau mich an. In die Augen. Ich hab’s dir vorhin schon zu verklickern versucht, dass ich vielleicht eine Lösung habe. Aber du musstest ja unbedingt vom Turm springen.«
»Ich glaub’s nicht, dass da was zu machen ist.« Trotzig starrte McMour zurück. »Verstehst du, Zamorra, ich spür’s einfach, zumindest der Schattenreif hatte achthundert Jahre lang Zeit, mit mir zu verwachsen. Und die Zeit hat er gründlich genutzt. Dass ich jetzt halbwegs normal mit dir reden kann, liegt wahrscheinlich daran, dass ich den Feuerreif noch nicht so lange trage. Aber wie auch immer – ich bin am Arsch. Aber so was von!«
»Du hast mich ja noch nicht mal angehört. Und das wirst du jetzt gefälligst tun. Los, mein Lieber, wir gehen rein. Und dann leihst du uns mal für ein paar Minuten dein Ohr oder ich reiß dir den Arsch auf. Das schaffe ich trotz deines Feuerreifs spielend. Verstanden?«
»Als ich auf dem Boden lag, da … da sind sie schon wieder gekommen, die Visionen, der Wahnsinn«, flüsterte Dylan so leise, dass die Köchin Mühe hatte, ihn zu verstehen. »Für einen Moment wollte ich Madame Claire umbringen, weil ich dachte, sie will mir Böses …«
Madame Claire erschrak zutiefst.
»Und jetzt?«, fragte Zamorra.
»Im Moment ist es fast weg. Ich bin stärker. Aber ich weiß nicht, wie lange noch …«
»Also, gehen wir rein. Komm.«
»Ich muss erst noch mein Fahrrad holen«, intervenierte Madame Claire.
»Sie sind mit dem Radl da?«, fragte Mademoiselle. »Das ist ja ganz neu. Wollen Sie die Tour de France gewinnen, Claire?«
»Das wäre ja mal was«, erwiderte sie, als sie den unbefestigten Weg zurück zum Fahrrad gingen. »Aber nein. Ich lasse meinen Twingo jetzt öfters mal zu Hause stehen und nehme das Fahrrad, weil ich ein paar Mal solche komischen stechenden Schmerzen in der Brust hatte, wissen Sie. Und mein Arzt sagt, dass Übergewicht zum Herzinfarkt führen kann. Und da ich ja auch ein paar Pfund zu viel auf den Rippen habe und dann dieses Stechen, da dachte ich, tue ich mal was. Wissen Sie, ich will ja nicht durch Dämonenhand sterben, das hab ich mir fest vorgenommen, aber durch einen Herzinfarkt auch nicht!«
Mademoiselle blieb stehen und sah sie forschend an. »Wie geht’s Ihnen im Moment, Claire? Alles klar? Ich meine, nach diesem Schreck in der Morgenstunde. Und ganz allgemein gesprochen: Brauchen Sie vielleicht mal Urlaub? Bekommen Sie, soviel Sie wollen.«
»Nein, nein«, wehrte Madame Claire ab. »Ich nehme lieber ab. Profilektisch.«
»Sie meinen prophylaktisch.« Mademoiselle lächelte. »Aber überanstrengen Sie sich nicht dabei. Sind Sie jetzt den ganzen Weg hoch gestrampelt?«
»Nicht ganz.« Madame Claire spürte Verlegenheit in sich aufsteigen. Leichte Röte schoss in ihr Gesicht. »Ich hab’s vom Dorfrand bis zur alten Eiche geschafft.«
Mademoiselles Lächeln verstärkte sich. »Das sind, lassen Sie mich mal schätzen, fünfhundert Meter? Na, immerhin.«
»Nicht wahr?« Madame Claire strahlte. »Schon ganz gut für den Anfang. Ich versuche jetzt jedes Mal, hundert oder zweihundert Meter mehr zu fahren. Den Rest muss ich eben schieben. Aber spazieren ist ja auch gut.«
»Bingo.«
Mademoiselle hob das alte rostige Fahrrad für sie auf und runzelte die Stirn. »Auf dem fahren sie keinesfalls mehr, Claire. Das ist ja lebensgefährlich. So schnell, wie da die Kette runterspringt und Sie umfallen, kann ein Infarkt gar nicht sein. Sie bekommen hiermit ein brandneues Fahrrad von mir. Wir gehen es gleich heute Abend in Lyon holen. Was meinen Sie?«
Madame Claire war gerührt. »Aber … aber das kann ich doch keinesfalls annehmen, Mademoiselle.«
»O doch. Sonst werde ich nie wieder Ihre Bouillabaisse anrühren.«
»Dann kann ich ja nicht Nein sagen. Vielen Dank, Sie sind so gütig. Aber sagen Sie, Mademoiselle Duval, was ist denn bloß mit dem jungen McMour los? Ich bin zu Tode erschrocken, als ich ihn so gesehen hab. Und diese Tattoos, schrecklich. Sie machen mir Angst. Wo hat er die her?«
Mademoiselle zögerte einen Moment. »Es handelt sich um Armreife«, sagte sie dann. »Den Feuer- und den Schattenreif. Monsieur McMour hat sie von zwei Männern bekommen. Zuerst dachte er – und wir übrigens auch – dass es sich um starke magische Waffen handelt, aber das stimmt nur zum Teil. Die Reife sind überaus gefährlich. In ihnen sind alle möglichen Gefühle ihrer Vorbesitzer gespeichert, wenn ich’s richtig verstanden habe. Und der Träger der Reife kriegt das alles hautnah ab, das ganze Chaos. Das muss einen auf Dauer ja wahnsinnig machen.«
»Der arme Kleine. Sie müssen ihn retten.«
Duval nickte. »Wir arbeiten dran, klar. Der Kleine liegt uns schließlich auch am Herzen. Aber ganz leicht wird das nicht. Eine Zeit lang hat Monsieur McMour diesen Gefühlsmischmasch aus Hass, Glück, Wahnsinn und was weiß ich nicht alles für seinen eigenen gehalten und wollte uns heute Nacht deswegen umbringen. William hat uns gerettet.«
Madame Claire erschrak zutiefst. »Das ist ja schrecklich. So gefährlich ist er?«
»Scheint so. Deswegen sollten Sie ihm in nächster Zeit nicht vollkommen arglos begegnen. Andererseits werden wir ihn wahrscheinlich ohnehin mit auf eine größere Reise nehmen.«
***
Roanoke Island, 1581
Tussacca kniete in seinem Kanu und trieb es mit dem Paddel, das er abwechselnd links und rechts ins Wasser stach, unaufhaltsam auf die Insel der Roanoke zu. Sie schälte sich bereits als dunkler Schatten aus dem Dunst, der schon den ganzen Tag über dem Wasser und den Inseln lag.
Tussacca konzentrierte sich auf den Rhythmus des Ruderns, auf das Geräusch des eintauchenden Paddels, aber den Knoten in seinem Magen bekam er dadurch nicht weg. Auch nicht den Gedanken an das, was ihn so sehr quälte und dessentwegen er diese Reise unternahm.
Tussacca hatte nun dreiundzwanzig Sommer erlebt. Da sein Vater Wanasse, legendärer Werowance[1] der Pamlico, alt war und immer gebrechlicher wurde, bereitete sich Tussacca nun darauf vor, als ältester Sohn schon bald selbst an der Spitze seines Volkes zu stehen.
Doch beim Grünmaisfest vor drei Tagen hatte er zu seinem Entsetzen erfahren, dass sich der Rat der Ältesten gegen ihn als neuen Häuptling und für seinen jüngeren Bruder Manteo aussprechen würde. Fünf von sieben hielten ihn für nicht geeignet, weil er bis jetzt – im Gegensatz zu Manteo – noch keine Großtat in seinem Leben begangen hatte.
Genau das wollte Tussacca nun nachholen; indem er ganz alleine dem Croatoan entgegentrat und den bösen Geist besiegte. Der Schamane, mit dem er von jeher ein gutes Verhältnis pflegte, hatte ihm nicht nur den Erfolg geweissagt, sondern ihm auch noch eine starke magische Waffe überlassen. Unwillkürlich wanderte Tussaccas Blick zu der unterarmlangen Kewa, einer aus Holz geschnitzten Götterstatue, in der die Kräfte von gleich drei guten Göttern vereint waren, etwas, das noch niemals zuvor einem Schamanen gelungen war.
Und nur so konnte es überhaupt gelingen, den Croatoan zu besiegen. Die Kewa stand aufrecht im Bug des Bootes, neben dem pfeilgefüllten Köcher und dem Langbogen. Ihr ständiger Anblick gab dem Pamlico die Kraft, diese schwere Mission durchzuziehen.
Aber was blieb ihm auch übrig? Bei seiner Nichtwahl wäre er aus dem Stamm verstoßen worden, ein Schicksal, das auch nicht viel besser war. Und so tauchte er das Paddel wieder und wieder ein, bis die Ufer Roanokes im dichter werdenden Nebel als undeutliche Schatten an ihm vorbei glitten. Beinahe jedes Geräusch aus den verwunschen scheinenden Uferwäldern ließ ihn innerlich zusammenzucken. Dabei war es lediglich das Röhren eines Weißwedelhirsches, das Huschen von Waschbären und Eichhörnchen im Unterholz und das Singen und Rufen verschiedener Vogelarten. Das plötzliche Platschen am Ufer, das viele kreisförmige Wellen auf das Wasser zauberte und einen sich entfernenden Strich darauf hinterließ, war einem Alligator zuzuschreiben.
Unter normalen Umständen hätte sich Tussacca an diesen Geräuschen erfreut. Nun vermutete er hinter jedem einzelnen den Croatoan.
An einem breiten Sandstrand lenkte der junge Pamlico das Kanu auf Grund und zog es vollends an Land. Die Kühle störte ihn nicht und so hängte er sich Bogen und Köcher über den nackten Oberkörper. Den hölzernen Brustpanzer ließ er weg, da ihm dieser gegen den Croatoan ohnehin nichts nützen würde. Und auf feindlich gesinnte Krieger traf er hier im Moment garantiert nicht.
Tussacca zog das lederne Lendentuch zurecht und hängte sich den Beutel mit dem Trockenfleisch an den Gürtel. Nur für alle Fälle. Denn er war sicher, dass er den Croatoan nicht suchen musste. Der Strandwanderer würde ihn finden! So wie er jeden fand, der in sein bevorzugtes Revier eindrang.
Und ihn dann tötete.
Vor fünf Tagen erst war der Croatoan gesehen worden. Das hieß, dass der böse Geist wieder da und eine Begegnung infolgedessen unausweichlich war.
Ich will diese Begegnung, machte sich Tussacca Mut und nahm die Kewa an sich. Ganz kurz kam ihm dieser seltsame Fremde mit der weißen Haut und den magischen Zeichen darauf in den Sinn. Der hatte die Schamanen verschiedener Stämme mit seinen Behauptungen und Angeboten ziemlich unter Druck gesetzt.
Tussacca verzichtete darauf, etwas zu essen. Er hätte ohnehin nichts hinunter bekommen. Stattdessen ging er los, am nebligen Strand entlang, über den plötzlich ein kalter Wind wehte. Es war später Nachmittag und er hoffte, dass die schreckliche Begegnung bis zum Einbruch der Dunkelheit stattgefunden hatte und entschieden war.
Barfuß bewegte sich Tussacca an der Wasserlinie entlang. Die rauschenden Wellen kamen höher auf den Strand und umspülten seine Füße. Er musste keine drei Speerwürfe weit gehen, als er vor sich im Nebel eine Bewegung sah.
Etwas kam auf ihn zu!
Schemenhaft. Gefährlich. Der Indianer spürte es mit all seinen Sinnen.
Tussacca stoppte und umklammerte die Kewa mit der rechten Hand. »Wer bist du?«, rief er, während er sein Herz hoch oben im Hals pochen hörte. Die Angst kroch eisig in seine Glieder. Sich etwas vorzustellen – und es dann tatsächlich zu erleben, waren zweierlei Dinge.
Der Schemen kam näher, wurde nun, da er immer weiter aus den Nebeln trat, etwas deutlicher. Tussacca glaubte einen groß gewachsenen Mann zu erkennen, dessen Körper hinter einer Kutte verborgen war. Eine Kapuze bedeckte den etwas nach vorne geneigten Kopf, ein Gesicht konnte Tussacca nicht erkennen.
Ansatzlos kam Bewegung in den Fremden. Er hob den Kopf. Trotzdem sah Tussacca hinter der Kapuze nur wallende Schwärze. Und zwei schwach gelb leuchtende Augen, die an jene von Rotluchsen erinnerten.
Nur dass sie ungleich grausamer und brutaler wirkten.
Ein entsetzliches Zischen löste sich aus der Schwärze, während sich die Augen auf unglaubliche Weise verwandelten.
Tief in ihnen schien es plötzlich unheilvoll zu glühen. Das Glühen verdichtete sich zu einem dunkelgelben Leuchten, nahm schnell an Intensität zu und strahlte schließlich in einem grellen Gelb.
Das war er, der böse Geist.
Der Strandwanderer.
Denn nichts anderes hieß Croatoan.
Tussacca zitterte am ganzen Leib. Am liebsten hätte er alles fallen lassen und wäre davon gesprungen. Aber das wäre jetzt ohnehin zu spät gewesen. Jetzt gab es nur noch den Kampf.
Siegen oder sterben.
Tussacca riss sich zusammen. Er wollte ein würdiger Häuptling sein. Wie es ihm der Schamane im Schnellverfahren beigebracht hatte, begann er die alten Formeln zu zitieren und damit die Montoac, die guten Götter in der hölzernen Statue, um Hilfe anzurufen.
Rauch quoll nach allen Seiten aus der Kutte des Strandwanderers und formte sich zu einer Säule. Schlagartig wuchs sie zur vierfachen Größe Tussaccas an.
Die Furcht brachte den Pamlico fast um, aber er rief unbeirrt weiter die Götter an.